|
Tender und Abmessungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die
Lokomotive musste, um die Vorräte mitzuführen, einen
Tender
mitnehmen. Dieser wurde mit kräftigen Stangen mit der Lokomotive
verbunden. Eine betriebliche Trennung war nicht vorgesehen. Dank den
Zugstangen
konnte jedoch der Tender in einer Werkstätte abgekoppelt werden. So war
theoretisch auch ein Wechsel des Tenders möglich geworden. Ein Punkt, der
immer wieder umgesetzt wurde. So konnten die Fahrzeuge auch getrennt
gewartet werden.
Die einzelnen Bauteile wurden aber auch hier mit her-kömmlichen
Nieten verbunden. Neue Punkte beim Aufbau wurden auch hier nicht
umgesetzt, da
Tender
selten verändert wurden. Hinten wurde der Tender mit einem üblichen Stossbalken versehen. Dieser hatte, wie der Stossbalken der Lokomotive zwei seitliche Stangenpuffer mit runden Puffertellern erhalten. Auch die Anordnung und Ausstattung der Zugvor-richtungen entsprach mit Zughaken und Schrauben-kupplung jener des vorderen Stossbalkens.
Daher können wir ruhig von einem identischen
Stossbalken
sprechen, denn damals wurde noch nicht viel in aufwendige
Schutzeinrichtungen investiert.
Mit den hinteren
Stossvorrichtungen
können wir die Länge der
Lokomotive bereits bestimmen. Dabei hatte die Lokomotive
selber eine Länge von 12 685 mm erhalten. Der
Tender
hatte eine Länge von 7 070 mm. Damit ergäbe sich eine rechnerische Länge
von 19 755 mm. Da sich jedoch im Bereich der
Kupplung
Überlappungen ergaben, wurde die komplette Lokomotive mit 19 195 mm
gemessen. Die geforderten 20 Meter wurden daher eingehalten.
Um den Rahmen abschliessen zu können müssen wir den vorderen Bereich
genauer ansehen. Hier wurden die beiden seitlichen Leitern zum
Führerstand
angebracht. Diese hatten drei Trittstufen erhalten. Dabei wurde der
unterste Tritt nach hinten leicht verlängert. Für den notwenigen Halt beim
Aufstieg sorgten die
Griffstangen, die sowohl an der
Lokomotive, als auch
am
Tender
angebracht wurden. Eine Türe verschloss zudem den Zugang zum
Führerstand.
Beim
Tender
wurden
Achsen und
Räder von Wagen
verwendet. Daher kamen hier Scheibenräder mit
Bandagen
und einem
Durchmesser von 1 080 mm zur Anwendung. Da diese jedoch innerhalb des
Rahmens zu liegen kamen, waren sie nicht gut zu erkennen. Gelagert wurden die Achsen des Tenders, wie das bei Wagen üblich war, in aussenliegenden Gleitlagern. Diese hatten Lagerschalen aus Weiss-metall erhalten und mussten, wie die Achsen der Lokomotive, mit Öl geschmiert werden.
Dabei kam auch hier eine Sumpfschmierung mit Schmierkissen zur
Anwendung. Der Vorrat wurde unmittelbar bei der
Achse angeordnet. Es kamen
hier spezielle für
Tender
entwickelte Lösungen zur Anwendung. Zur Abfederung der Achsen kamen auch hier Blattfedern zur Anwendung. Im Gegensatz zur Lokomotive waren hier die hochliegenden Federn-pakete aussen am Rahmen gut zu erkennen.
Dabei wurde die
Federung der zweiten und
dritten
Achse mit einem Ausgleichshebel verbunden. Lediglich die erste
Achse konnte sich unabhängig bewegen. Damit konnte auch der
Tender
problemlos Kuppen und Senken befahren.
Die
Achsen des
Tenders waren, wie bei der
Lokomotive, nicht gleichmässig
im Rahmen gelagert worden. Diese Verteilung war bei Dampflokomotiven
üblich und war immer wieder etwas anders. Daher lohnt es sich, wenn wir
nun einen genaueren Blick auf die vorhandenen Abstände der Achsen werfen.
Bei der kompletten Lokomotive wurde ein totaler Achsstand von 15 855 mm
angegeben. Dieser verteile sich auf die Lokomotive und den Tender.
Dabei betrug der Abstand der Laufachse zur ersten Triebachse 2 350 mm.
Dieser Abstand wurde nur noch zwischen der
Lokomotive und dem
Ten-der
überschritten. Dort betrug der Abstand 3 155 mm. Wobei das kein Problem
bildete, da es sich um zwei gekuppelte Fahrzeuge handelte, die sich
unabhängig bewegen konnten und ein
Gelenk
besassen.
Unterschiedlich waren die Abstände der
Triebachsen. Dabei gab es zwischen
der ersten und zweiten Triebachse einen Abstand von 1 750 mm. Wobei das
bei den mit einem
Krauss-Helmholtz-Drehgestell versehenen Maschinen bis
zur Nummer 2969 nur im geraden
Geleise stimmte. Bei den folgenden
Achsen
verringerte sich der Abstand auf 1450 mm. Nur bei der letzten Triebachse
steigerte man den Wert wieder auf 1 800 mm.
Damit ergab sich für die
Lokomotive ein totaler Achsstand von 8 800 mm und
uns fehlt nur noch der
Tender. Dieser hatte zwischen der ersten und
zweiten
Achse
einen Abstand von 2 200 mm erhalten. Mit einem Abstand zur
dritten Achse von 1 700 waren die Achsen nicht gleichmässig verteilt
worden. Ein Punkt, der wegen den Aufbauten des Tenders so gewählt werden
musste und der so gleichmässige
Achslasten ermöglichte.
Markantestes Bauteil des
Tenders war der
Wasserkasten. Dieser wurde nach
der
Bauart
Gölsdorf aufgebaut. Er nahm nahezu den gesamten Platz auf dem
Tender ein. Dabei wurde die Höhe des Wasserkastens zur
Lokomotive hin
etwas nieder, auch wenn man das dem Aufbau nicht ansehen konnte. Der
gewonnene Platz wurde für zwei Werkzeugkisten benötigt. Hier lag auch der
Grund für die unterschiedlichen Achsstände des Tenders.
Befüllt werden konnte der
Wasserkasten
über zwei seitlich auf demselben
eingebauten Deckel. Diese waren so gross ausgeführt worden, dass das
Wasser problemlos von einem Wasserkran eingefüllt werden konnte. Im
Wasserkasten hatten 18 m3 Wasser Platz. Damit war der
Wasserkasten in seiner Grösse mit den Lokomotiven der Baureihe
C 4/5
identisch ausgeführt worden. Jedoch war nun eine Anzeige für den
Wasserstand vorhanden.
Nach vorne konnten die
Kohlen mit Brettern,
die entfernt werden konnten, im
Kohlenfach gehalten werden. So war es
möglich, auf dem
Tender sieben Tonnen Kohlen zu verladen. Dank dem nach
oben offenen Kohlenfach konnte dies mit
Kränen erfolgen. Für die Grösse der Lokomotive waren die Vorräte eher gering ausgefallen. Mit einem längeren Tender, wie man ihn bei der Baureihe A 3/5 700 verwendete, hätten diese vergrössert werden können.
Jedoch war das wegen
der maximalen Länge der
Lokomotive nicht mehr möglich. Da in der Schweiz
jedoch bei
Güterzügen eher kurze Distanzen gefahren wurden, reichten diese
Vorräte durchaus. Gerade bei den
Kohlen war das wichtig.
Zwar fehlen uns noch die
Antriebe und die
Dampfmaschinen, trotzdem können
wir nun einem Blick auf die
Achslasten werfen. Diese durften bestimmte
Werte nicht überschreiten. Die Verteilung dieser Lasten zeigt zudem auf,
wie gut die Erbauer gearbeitet hatten und wie ausgewogen ein Fahrzeug war.
Dabei gab es innerhalb dieser Baureihe durchaus Unterschiede, wobei diese
keine grossen Auswirkungen auf die einzelnen Achslasten hatten.
Bei der
Laufachse wurde eine
Achslast von zehn Tonnen gemessen, damit
hatte man hier die maximalen Werte nicht erreicht. Die
Triebachsen hatten,
mit Ausnahme der ersten Triebachse, die 15 Tonnen Achslast hatte, mit 15.3
Tonnen ausgeglichene Achslasten. Damit wurden auch hier die maximal
möglichen Werte von 16 Tonnen nicht ausgeschöpft. Die
Lokomotive war
ausgeglichen aufgebaut worden. Das galt auch für den
Tender, der 13.9
Tonnen Achslast hatte.
Wie schon erwähnt, es gab beim Gesamtgewicht der
Lokomotive
unterschiedliche Werte. So wurden Gesamtgewichte von 125.6 bis 129.5
Tonnen angegeben. Für das wichtige
Adhäsionsgewicht der Lokomotive ergab
das Werte zwischen 74.8 und 77.5 Tonnen. Daher wurden von der Differenz
von 3.9 Tonnen lediglich 2.7 Tonnen bei den
Triebachsen umgesetzt. Die
oben angegebenen
Achslasten galten dabei für ein durchschnittliches
Gewicht von 127.9 Tonnen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Tragendes
Element des
Tragendes
Element des
 Der Rahmen des
Der Rahmen des
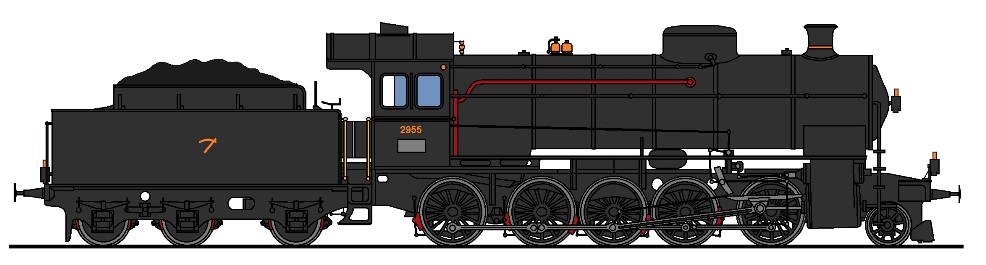 Beginnen wir die Betrachtung der vorhand-enen Abstände mit der
Beginnen wir die Betrachtung der vorhand-enen Abstände mit der
 Innerhalb des
Innerhalb des