|
Dampfmaschine und deren Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der im
Kessel
erzeugte und im
Dampfdom
gesammelte Dampf wurde für den
Antrieb
genutzt. Dazu wurde der erzeugte
Nassdampf
beim Dampfdom mit einem als
Regulator
bezeichneten
Ventil
entnommen in die Leitung zu den beiden
Zylindern
zugeführt. Diese Leitungen waren sehr kurz ausgefallen, damit der Dampf in
diesem Bereich nicht zu stark abkühlte. Nur so konnte die
Leistung
des Kessels optimal genutzt werden.
So entstanden wirklich sehr kurze
Dampfleitungen.
Geendet haben diese bei den
Schieberkästen,
welche die Dampfzufuhr zur der
Dampfmaschine
regulierten und diese so betrieben werden konnte. Die Position der Schieber wurde durch die Steuerung geregelt. Diese werden wir anschliessend noch ge-nauer ansehen, denn der Nassdampf aus dem Kessel gelangte bei offenem Schieber in den Zylinder. Dort wurde mit der Kraft des Dampfes ein
Kolben
verschoben. Da an diesem
Kolben der
Antrieb
ange-schlossen wurde, bewegte sich die
Lokomotive
wegen den drehenden
Rädern
und die Steuerung sorgte dafür, dass nun auf der anderen Seite Dampf
zugeführt wurde. Durch diese Änderung bei der Zufuhr wurde
der frische
Nassdampf
nun auf der anderen Seite in den
Zylinder
gelassen. Der
Kolben
bewegte sich die die andere Richtung und der sich dort befindliche Dampf
wurde über den
Schieber
aus dem Innenraum in eine zweite Leitung entlassen. Ein Vorgang, der sich
wiederholte, bis die Zufuhr von neuem Dampf nicht mehr vorhanden war. Wir
haben eine übliche
Dampfmaschine
erhalten. Der verbrauchte Dampf aus dem
Zylinder
wurde anschliessend in eine weitere Leitung geführt und gelangte so in die
Rauchkammer.
Dort wurde der Abdampf schliesslich über die
Blasrohre
mit hohem Druck in den
Kamin
und damit in die Umwelt entlassen. Eine weitere Ausnutzung, des Dampfes
fand jedoch nicht mehr statt. Damit haben wir hier, wie es damals üblich
war, eine einfache Lösung erhalten.
Welche Seite es war, spielte keine Rolle,
denn nur der Zeitpunkt der genauen Zufuhr des Dampfes war leicht
unterschiedlich, was aber eine direkte Folge des
Versatzes
bei den
Antrieben
war. Wichtigstes Bauteil einer Dampfmaschine war deren Zylinder. Die hier verbauten Modelle hatten einen Durchmesser von 220 mm erhalten und der Kolben hatte einen Hub von 350 mm bekommen. Eine im Vergleich zu anderen Baureihen eher
kleine
Dampfmaschine,
die auf der
Lokomotive
kaum zu sehen war. Aber das war auch eine Folge davon, dass die
Schieberkästen
hier unter dem
Zylinder
an-geordnet wurden. Wegen den unten liegenden
Schieberkästen
wirkten die
Zylinder
sehr klein. Jedoch hatte diese Anordnung einen grossen Vorteil, denn der
in der
Dampfmaschine
abgekühlte
Nassdampf
schied Feuchtigkeit in Form von Wasser aus. Das musste aus der Maschine
entfernt werden. Durch den Aufbau war nun gesichert, dass dieses einfach
in die Leitung mit dem Abdampf lief. Dort sorgte im Betrieb der
Dampfmaschine dafür, dass das Wasser in das
Blasrohr
gezogen wurde. So konnte hier auf die sonst bei
Dampfmaschinen
vorhandenen
Schlemmhähne verzichtet werden. Ein Punkt, der auch die Kosten
für die
Lokomotive
verringerte und der zudem den Betrieb vereinfachte, was
eine Forderung der
Gotthardbahn war. Wir haben daher eine für den
Rangierdienst ausgelegte Maschine erhalten, die sehr einfach aufgebaut
war. Doch uns interessiert eher die
Leistung der beiden Dampfmaschinen.
Diese hatte damals bereits
eine
Leistung von 160 PS erhal-ten, was mehr als das doppelte bedeutet.
Daher war die A I der
Gotthardbahn wirklich sehr kleine und nur für den
Rangierdienst geeignete
Lokomotive. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Damals kannte man die Angabe der Leistung in Kilowatt noch nicht. Daher wurde auch hier auf diesen Hinweis verzichtet und die etwas höheren Werte in Pferdestärken angegeben. Ein Punkt, der auch die Maschine etwas besser präsen-tierte,
denn mit rund 55 Kilowatt war wirklich keine gute
Leistung vorhanden. Aber
bei einem Preis von 29 000 Schweizer Franken war nicht mehr zu erwarten. Dampfzylinder funktionierten jedoch nur, wenn die Zufuhr des Dampfes korrekt erfolgte. Dazu mussten die Schieber anhand der Stellung des Kolbens verstellt werden. Zu diesem Zweck wurde die Steuerung
vorgesehen. Diese war hier kaum zu erkennen, da sie hinter dem Umlaufblech
platziert wurde und weil auch eine sehr einfache Steuerung verbaut worden
war. Es lohnt sich daher, wenn wir diesen Teil der
Dampfmaschine genauer
ansehen. Bei der
Lokomotive
kam an Stelle einer aufwendigen
Steuerung ein Brownsches Balanciersystem zur Anwendung. Speziell bei
dieser Art der Steuerung einer
Dampfmaschine war ihr geringer Platzbedarf.
Ein Punkt, der hier dazu beitrug, dass ausser den
Zylindern von der
eigentlichen Dampfmaschine kaum etwas zu erkennen war. Dem Aussehen der
Reihe AI hatte das jedoch nicht geschadet, auch wenn sie durch noch
schlichter aussah, als sie wirklich war.
Das stimmt nicht, denn diese Einrichtung war damals bei Lokomotiven mit geringen Leistung durchaus üblich. Sie konnte mit einer Stange aus dem
Führerhaus
durch
das
Lokomotivpersonal
beeinflusst werden. Wobei auch jetzt nicht der Luxus
anderer Steuerung vorhanden war. Mit dieser Steuerstange konnte die Fahrrichtung der Lokomotive verändert werden. Dabei waren jedoch nur die Stellungen für vorwärts und rückwärts vorhanden. Nicht vorhanden war jedoch die Regelung der Dampfzufuhr zum Zylinder, der einfach nur erfolg-te, oder verhindert wurde. Daher wurde hier die
Zugkraft nur mit dem
Regu-lator und damit dem
dort entnommenen
Nassdampf geregelt. Die Maschine war leicht zu bedienen. Da auch der als Vorlauf bezeichnete Effekt einer
aufwendigen Steuerung nicht so gut eingestellt werden konnte, lief der
Zylinder nicht optimal. Nur eine deutlich aufwendigere Steuerung hätte das
verbessern können. Jedoch musst dazu gesagt werden, dass gerade die
Steuerung ein ausgesprochen teures Bauteil war. Das war natürlich auch ein
Punkt, denn der Hersteller musste ja zusehen, dass er auch noch etwas
verdienen konnte. Damit können wir auch die
Dampfmaschine mit der
Steuerung abschliessen. Wir haben die
Lokomotive
der Baureihe AI damit
aufgebaut. Klar fehlen Ihnen vermutlich noch einige Punkte, die waren hier
entweder nicht vorhanden, oder sie werden in der anschliessend
vorgestellten Bedienung der Maschine noch erwähnt. Die Balancier der
Gotthardbahn, sollte auch bei der Bedienung einfach aufgebaut sein.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bei
der geringen Heizleistung des
Bei
der geringen Heizleistung des
 Wir
haben den Weg des Dampfes damit bereits ab-geschlossen und können uns nun
die eigentliche
Wir
haben den Weg des Dampfes damit bereits ab-geschlossen und können uns nun
die eigentliche
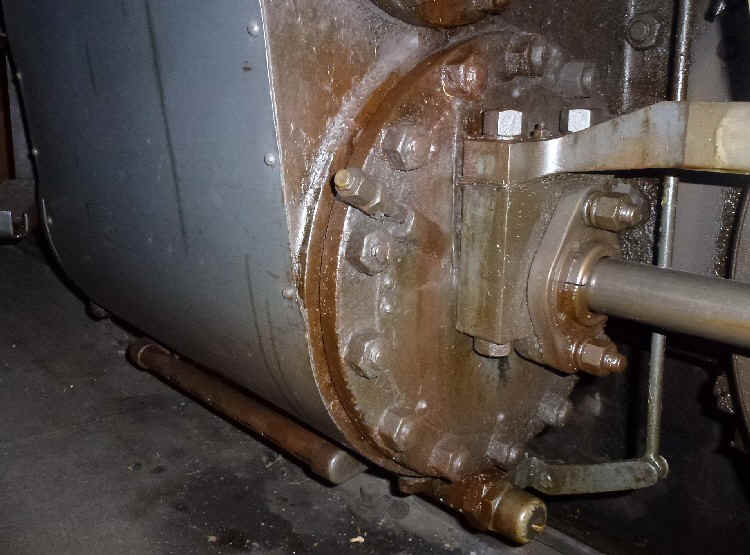 Zusammen konnten diese beiden
Zusammen konnten diese beiden
 Wegen der verbauten Steuerung wurde bei der Bau-reihe
AI auch von der Balancier der
Wegen der verbauten Steuerung wurde bei der Bau-reihe
AI auch von der Balancier der