|
Inbetriebsetzung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die kurz nach dem Krieg fertiggestellte erste
Lokomotive der neuen Baureihe Re 4/4 stand lange Zeit im
Schatten der grossen Zerstörungen im Ausland. So berichtete das
Nachrichtenblatt der SBB in jedem Monat von einem anderen Land und den
damit verbundenen Arbeiten. Im Jahre 1945, als die Lokomotive vermutlich
erstmals vor den Toren der Halle in Seebach zu sehen gewesen sein musste,
fand sich jedoch nichts in den Unterlagen.
Diese gab es jedoch bei der ersten Inbetriebnahme einer neuen
Lokomotive immer wieder. Entweder knallte es irgendwo
oder aber es bewegte sich schlicht nichts. All das gehört zur ersten
Inbetriebnahme und darüber wird kaum berichtet.
Auf jeden Fall endete das Jahr 1945 mit den üblichen Feiertagen,
die seit langer Zeit erstmals wieder ohne die Auswirkungen des Krieges
gefeiert werden konnten. Eine Zeit der Besinnung und so ruhten die
Arbeiten im Werk in der Folge sollte es erst im Jahre 1946 zur
Auslieferung kommen. Eine Situation, die man schon von anderen Baureihen
kannte und hier nicht so extrem waren, wie bei der fertigen
Lokomotive Fc
2x 3/4.
Die erste
Lokomotive der neuen Baureihe wurde am 21. Januar 1946
in Oerlikon den Schweizerischen Bundesbahnen SBB übergeben. An diesem Tag
fanden jedoch keine umfangreichen Fahrten mehr statt und die neue Maschine
wurde ins
Depot
Zürich überstellt. Dort hatte man eine Waage und konnte die einzelnen
Achslasten
genau kontrollieren. Die Stunde der Wahrheit sollte daher erst nach der
ersten kurzen Fahrt kommen.
Die Waage der
Staatsbahnen
brachte in Zürich an den Tag, was vermutlich einige Konstrukteure bereits
vermuteten. Die durchschnittliche
Achslast
wurde mit 14.25 Tonnen angegeben. Hochgerechnet ergab das ein
Betriebsgewicht von 57 Tonnen. Die neue Maschine war um eine Tonne zu
schwer geraten. Nicht viel, aber die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
waren darüber nicht besonders glücklich, denn man wollte die
Zugreihe R.
Dieser sollte in der Nacht kleine Mängel ausbessern und versuchen
eine Tonne beim Gewicht der
Lokomotive ein-zusparen. Da dies jedoch nicht gelang,
unternahm die Maschine die erste Fahrt unverändert. Somit fand die erste Probefahrt der neuen Baureihe zwischen dem elektrischen Ausrüster und dem Hersteller des mechanischen Teils statt. Dabei traten keine grös-seren Probleme mit der Lokomotive auf.
Die Fahrt muss zur Zufriedenheit der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB verlaufen sein, denn vorerst kehrte die Maschine nicht mehr zum
Hersteller zurück. Man konnte mit den ersten Fahrten beginnen und dabei
sollte es schnell werden. So kam es, dass diese Lokomotive nur drei Tage später das erste im öffentlichen Fahrplan enthaltene Zugspaar von Bern nach Interlaken und wieder zurück, führte.
Somit gelangte die neue
Lokomotive bereits kurz nach der Ablieferung auf die
Strecke der BLS, wo sie auf die nur wenige Jahre ältere Baureihe
Ae 4/4,
ihrem technischen Vorbild traf. Auch diese Fahrt verlief ohne nennenswerte
Probleme, so dass die Züge den
Fahrplan
einhalten konnten.
Es muss erwähnt werden, dass die Strecke der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB immer wieder für Versuche genutzt wurde. Der Grund war
einfach, denn dort verkehrten die
Lokomotiven der Reihe Ae 3/6 I mit 110 km/h. Beim
Personal handelte sich die Strecke daher den Namen «Rennbahn» ein. Ob mit
der neuen Baureihe bis zur
Höchstgeschwindigkeit
beschleunigt wurde, ist nicht überliefert worden, es kann jedoch
angenommen werden.
Jedoch waren auch die Journalisten des SBB Nachrichtenblattes
anwesend. So sollte «Die neue leichte
Lokomotive der Serie Re 4/4» in der Ausgabe des Monates
März dem Personal vorgestellt werden.
Der Artikel umfasste nicht weniger als sechs Seiten. Mit Bildern
und technischen Details wartete das Fachorgan auf und selbst über eine
Probefahrt
mit Schüler der Lehrwerkstätte Bern nach Genève wurde eingebaut. Besonders
beeindruck war man vom neuen
Drehgestell
und dem neuartigen
Luftgerüst.
Es fehlte natürlich nicht an Superlativen. Wer konnte es dem internen
Nachrichtenorgan der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verdenken.
Dabei wurden auch die Angaben zu den Geschwindigkeiten der ersten
Fahrten aufgeführt. Speziell war, dass man für die Strecke von Bern nach
Thun und somit für 31.2 km nur 17 Minuten benötigte. Dabei erreichte die
Lokomotive eine durchschnittliche Geschwindigkeit von
110 km/h. Die schnellsten Tempi dieser Fahrt sollten daher über diesem
Wert liegen. Dieser Durchschnitt wurde sogar zwischen Genève und Lausanne
mit 113 km/h übertroffen.
Abgeschlossen wurde der Artikel des Nachrichtenblattes mit den
Worten. «Damit werden die Schweizerischen Bundesbahnen ein weiteres Mittel
in der Hand haben, um den Reisezugsverkehr weiter auszubauen und zu
beschleunigen, und es ist zu hoffen, dass diese
Lokomotiven auch dazu beitragen können, dass die Bahnen
imstande sind, den nun wieder einsetzenden Konkurrenzkampf mit Erfolg zu
bestehen.»
Die Fachleute wollten schnell wissen, was dort für Werte erreicht
werden konnten. Werte, die sich jedoch durchaus sehen konnten, denn für
die 129,5 Kilometer zwischen Zürich und Bern benötigte man, ohne
Heitersbergtunnel und Bornlinie, 84 Minuten. Das ergab für die Fahrt eine durchschnittliche Geschwin-digkeit von 93 km/h. Mit den dort eingesetzten Maschinen vom Typ Ae 4/7 erreichte man diesen Wert lediglich, wenn mit Höchstgeschwindigkeit gefahren wurde.
Viele
Kurven
verhinderten dies jedoch. Aus diesem Grund benötigte der planmässige Zug
mit einer älteren Baureihe für diese Fahrt deutlich länger. Ein Umstand,
der so deut-lich nur mit Ausbauten an der Anlage erreicht werden soll-te.
Ab dem 07. März 1946 hatte man die zweite Maschine im Bestand. Dieser folgten im März zwei weitere Lokomo-tiven und am 26. Juni 1946 wurde der letzte Prototyp ausgeliefert.
Wie eilig man es bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatte,
zeigte sich, dass zu diesem Zeitpunkt die erste Serie dieser neuen
Baureihe schon im Bau war. Noch standen jedoch die weiteren
Versuchsfahrten
auf dem Programm und die hatten nur ein Ziel.
Diese Fahrten liessen schnell erkennen, dass die neue
Lokomotive die Bedingungen des
Pflichtenheftes
auch mit etwas Übergewicht erfüllte. Nur bei diesem Gewicht mussten einige
Abstriche gemacht werden. Das war insofern ein kleines Risiko, da man noch
nicht sicher wusste, ob die Lokomotive nach
Zugreihe R
und damit mit 125 km/h verkehren darf. Die neu definierten Grenzwerte für
diese Zugreihe mussten noch überprüft werden.
Die
Versuchsfahrten
zur
Zulassung
zur
Zugreihe R
zeigten jedoch deutlich, dass auch hier alle Bedingungen erfüllt wurden.
Das leichte Übergewicht wirkte sich nicht negativ auf die Kräfte im
Gleis
aus. Damit war nun klar, dass diese Baureihe bei der Auslieferung korrekt
mit Re 4/4 bezeichnet worden war. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
besassen die erste
Lokomotive der Schweiz mit Zulassung zur Zugreihe R.
Ein Meilenstein in der Geschichte der Entwicklung von
Lokomotiven in der Schweiz war somit geschafft und die
Reihe Re 4/4 durfte mit bis zu 125 km/h verkehren. Damit war sie mit
Abstand die schnellste Lokomotive der Schweiz. An diesem Ansatz sollte
sich die ersten Jahre sogar nichts ändern und die erste nachfolgende
Lokomotive war die Reihe
Ae 6/6. Diese besass zwar
auch 125 km/h, konnte diese Geschwindigkeit jedoch nie ausfahren.
Damit man diese testen konnte, benötigte man bekanntlich eine
zweite
Loko-motive. Erst jetzt konnten die Verbindungen
hergestellt werden. Dabei waren die Ergebnisse durchaus befriedigend. Nur
soweit war man seinerzeit bei der Reihe
Ae 4/6 auch. Weil die Schweizerischen Bundesbahnen SBB noch nicht von dieser Ein-richtung überzeugt waren, wurden die in Reihe gebauten Lokomotiven ohne diese Vielfachsteuerung ausgeliefert.
Jedoch verschloss man dabei nicht alle Türen, denn die Maschinen
sollten dazu vorbereitet werden. Mit anderen Worden, die Anschlüsse waren
vorhan-den, die Kabel und Steckdosen jedoch noch nicht gezogen,
beziehungsweise montiert worden. Der Schock bei der Baureihe Ae 4/6 muss wohl gross gewesen sein. Anders konnte man sich nicht erklären, dass man, nachdem im Pflichtenheft eine solche Einrichtung verlangt wurde, bei der Lieferung wieder davon Abstand genommen hatte.
Die Tonne zu viel auf den Rippen war sicherlich nicht die Ursache
für diesen Entscheid, den man später auf eigene Rechnung korrigieren
musste. Vielmehr können finanzielle Aspekte angeführt werden.
Die
Vielfachsteuerung
der ersten sechs
Lokomotiven wurde jedoch eingehend erprobt. Dabei wurden
die
Verbindungen
bei unterschiedlicher Witterung gekuppelt und getrennt. Danach ging es auf
die Fahrten. Auch nach dieser Tortur funktionierte die Einrichtung sehr
gut und es kam bei der Vielfachsteuerung Typ III zu keinen nennenswerten
Störungen. Damit hätte sich aber auch wieder die Möglichkeit von
Pendelzügen
ergeben.
Diesen Führerstand montierte man an einen Wagen, der aus der Lieferung der Leichtstahl-wagen genommen wurde. Noch war dieser provisorische Wagen nicht als CFt4 bezeichnet wor-den.
Das Fahrzeug trug jedoch für die Versuche bereits die
ent-sprechende Nummer. Niemand war daher für
Pendelzüge
be-reit. Die Fahrten mit Pendelzügen und in Vielfachsteuerung zeig-ten aber schnell, dass mit dem neuen Kabel vom Typ III keine grossen Probleme zu erwarten waren.
Die
Vielfachsteuerung
der Bau-reihe Re 4/4 funktionierte sehr gut und neige kaum zu Stör-ungen,
so dass man die rest-lichen
Lokomotiven mit den Nummern 407 bis 426 auch damit hätte
ausrüsten können. Dazu fehlte jedoch noch der entsprechende Entscheid aus
Bern.
Wie gut die
Vielfachsteuerung
der Baureihe Re 4/4 wirklich war, zeigt die Tatsache, dass das hier
erstmals eingesetzte Kabel auch bei weiteren Baureihen verwendet wurde.
Erst die Reihe Re 450 sollte eine neue Einrichtung in den Wagen erhalten.
Alle bis dahin ausgelieferten
Triebfahrzeuge
besassen das Kabel vom Typ III. Die Belegungen wurden mit a bis e als
Ergänzung geführt. Die Reihe Re 4/4 hatte damit die Vielfachsteuerung Typ
IIIa.
Auch wenn bei den
Probefahrten
immer wieder von den Erfolgen berichtet wurde, standen diese nicht immer
unter einem guten Stern. So kam es bereits während den ausgedehnten
Versuchsfahrten
zu ersten
Kurzschlüssen
im
Transformator.
Noch erkannte man deren Ursache nicht und die Explosionen verhinderten
anfänglich die Forschung nach den Ursachen. Man konnte sich die
Kupferspritzer in den
Wicklungen
schlicht noch nicht erklären.
Die neue
Lokomotive hatte ihre ersten Tests jedoch erfolgreich
bestanden und konnte daher dem Betrieb übergeben werden. Das war kein zu
grosses Risiko und schliesslich waren bis Ende 1946 die ersten elf
Lokomotiven der Baureihe Re 4/4 abgeliefert worden. Dabei besassen jedoch
nur die ersten sechs Lokomotiven, die als
Prototypen
angesehen wurden, eine
Vielfachsteuerung
und konnten damit mit
Pendelzügen
eingesetzt werden.
Dazu fehlte jedoch noch der passende
Steuerwagen.
Dieser wurde erst im Jahre 1948 ausgeliefert und so konnte die beraubte
Lokomotive wieder normalisiert werden. Die Versuche
konnten jetzt mit einem vollwertigen Steuerwagen erfolgen und dieser
zeigte die Vorteile durchaus auf. Nur noch fehlte der Auftrag aus Bern und
die
Vielfachsteuerung
der Reihe Re 4/4 wurde ausserhalb der Versuche schlicht nicht verwendet.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
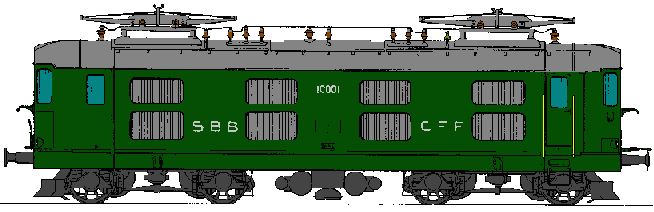 Auch
sonst wurde wenig von den ersten im Werk ausgeführten Ver-suchen
berichtet. Der Hersteller liess sich nicht so schnell in die Karten
blicken, wie wir das erhoffen. Natürlich will niemand über Misserfolge
berichten.
Auch
sonst wurde wenig von den ersten im Werk ausgeführten Ver-suchen
berichtet. Der Hersteller liess sich nicht so schnell in die Karten
blicken, wie wir das erhoffen. Natürlich will niemand über Misserfolge
berichten. Am
darauf folgenden Tag unternahm die
Am
darauf folgenden Tag unternahm die 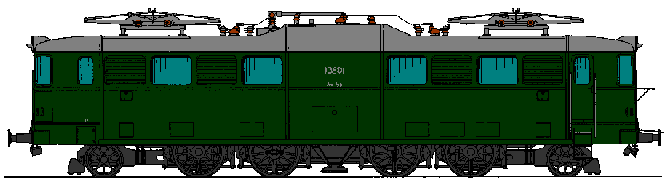 Bevor
es mit den Versuchen weitergehen konnte, wurde die neue Maschine zum
Pressetermin aufgeboten. Nach den herben Rück-schlägen bei der Reihe
Bevor
es mit den Versuchen weitergehen konnte, wurde die neue Maschine zum
Pressetermin aufgeboten. Nach den herben Rück-schlägen bei der Reihe
 Anschliessend
folgte dann eine lange Reihe von
Anschliessend
folgte dann eine lange Reihe von
 Mit
der grösseren Anzahl
Mit
der grösseren Anzahl  Damit
man einen
Damit
man einen