|
Druckluft und Bremsen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Seit bei den Bahnen die
Druckluftbremsen
eingeführt wurden, geht auf einem neuen Fahrzeug nichts mehr ohne
komprimierte Luft. Um einen langfristigen Vorrat zu erhalten, musste diese
Druckluft
auf dem
Triebwagen
hergestellt werden. Dazu wurden bei den elektrischen
Triebfahrzeugen
unterschiedliche Ausführungen von passenden
Kompressoren
verbaut. Angetrieben wurden diese mit einem einfachen Motor.
Das war bei einem
Triebwagen
besonders wichtig, denn dort wurden diese mit wenigen Ausnahmen unter dem
Boden aufgehängt und so war jede Vibration von den Leuten zu spüren. Der Rotationskompressor verdichtete die angesaugte Luft in zwei Schritten. In der ersten Kammer entstand ein Enddruck von zwei bar. In der zweiten Kammer wurde dieser Wert jedoch auf den zum Fahrzeug passenden Enddruck erhöht.
Je nach dem Verbrauch konnte dieser höher oder
tiefer liegen. Das führte nun aber zu einem ungewollten Effekt. Die
komprimierte Luft schied bei Abfall des
Luftdruckes
Wasser aus. Dieses musste aus den Leitungen entfernt werden, denn Flüssigkeiten konnten nicht komprimiert werden. Hinzu kam, dass bei kaltem Wetter des Wasser gefrieren konnte. Dadurch wurden Leitungen verstopft und auch gesprengt. Daher wurde das Wasser mit einem üblichen Wasser-abscheider entnommen und in einem Behälter aufgefangen. Eine Entlassung ins Gleisbett war nicht möglich, da sich in der Emulsion auch Schmiermittel befand.
So aufbereitet gelangte die
Druckluft
schliesslich in die
Hauptluftbehälter.
Diese waren als
Puffer
vorgesehen und so konnten kurzfristig hohe Verbräuche leicht aufgefangen
werden. Waren diese jedoch geringer, stieg der
Luftdruck
an und zwar so, dass diese Behälter ohne Schutz bersten konnten. Dazu
wurde in der Zuleitung ein
Überdruckventil
verbaut. Dieses beschränkte den Luftdruck im System auf einen Wert von
zehn
bar.
Dazu war gegen den Kompressor ein einfaches Rückschlagventil verbaut worden. In den von diesen Behältern weiter führenden Leitungen waren hingegen Absperrhähne eingebaut worden.
So konnte die
Druckluft
in diesem
Kessel
eingeschlossen und auch über eine längere Zeit gespeichert werden. Wichtig war das, weil der Triebwagen ohne Druckluft nicht in Betrieb ge-nommen werden konnte.
Für den Fall, dass dieser Vorrat nicht mehr
ausreichte, war auf dem Fahr-zeug eine
Handluftpumpe
vorhanden. Diese versorgte jedoch nur die notwendigen Bauteile mit
Druckluft.
War der
Triebwagen
eingeschaltet, lief der
Kompressor
und der Luftvorrat wurde durch diesen weiter auf die normalen Werte
ergänzt.
Damit kommen wir zu den Verbrauchern der
Druckluft.
Die zu Beginn erwähnten
Bremsen
waren nur ein Teil. Mit der vorhandenen Druckluft konnte viel mehr gemacht
werden und daher wurde sie auch anders genutzt. Jedoch gab es bei den
Bauteilen Unterschiede. Einige benötigten einen stabilen
Luftdruck
von sechs
bar.
Andere konnten mit einem Wert von bis zu zehn bar betrieben werden. Früher
waren dazu zwei Leitungen erforderlich.
Diese gab es nicht mehr. Um das Gewicht zu
reduzieren, wurde nur eine Leitung verbaut, die mit einem Druck von acht
bis zehn
bar
arbeitete. Bauteile, die einen geringeren
Luftdruck
erforderten, wurden einfach über ein
Druckreduzierventil
an dieser Leitung angeschlossen. Das ging, da nur wenige Verbraucher der
elektrischen Ausrüstung auf einen stabilen Wert angewiesen waren. Später
werden wir diese kennen lernen.
Zu diesen gehörte die auf dem Dach montierte
Lokpfeife.
Da
sie mit einem veränderlichen Druck arbeiten konnte, war sie direkt dieser
Leitung ange-schlossen worden. Diese Leitung sollten wir uns ansehen, denn
bei dieser gab es ein besonderes Problem. Bezeichnet wurde diese Leitung als Apparateleitung. Das war nicht ganz korrekt, denn sie wurde mit einer veränderlichen Luftdruck betrieben. Daher hätte man hier korrekterweise von einer Speiseleitung gesprochen.
Da die Leitung jedoch nicht bis zu den
Stossbalken
geführt wurde, spielte das keine so grosse Rolle. Wichtig war, dass diese
Leitung der Versorgung diente uns dabei ist der Name eigentlich eher
unwichtig. Wenden wir uns nun den pneumatischen Bremsen zu. Es gab zwar weitere Bauteile, die mit Druckluft betrieben wurden. Diese werden wir uns noch genauer ansehen. Es waren meistens Teile, die der elektrischen
Ausrüstung zugeschlagen wer-den konnten. Die
Druckluftbremsen
jedoch stellten immer noch den grössten Verbraucher dar. Daher sollten wir
nicht auf deren Betrachtung verzichten, denn nun wird es spannend.
Auf diesen
Triebwagen
wurden nicht weniger als drei
Druckluftbremsen
verbaut. Wir müssen uns diese ansehen und dabei beginne ich mit der sehr
einfach aufgebauten
Schleuderbremse.
Bei dieser konnte maximal ein
Luftdruck
von 0.8
bar
in den
Bremszylindern
erzeugt werden. Die geringe
Bremskraft
sollte die
Achse
abfangen und zugleich die
Laufflächen
reinigen. Eine Verzögerung war jedoch nicht zu erreichen.
Die Reisezüge waren noch mit der Regulierbremse versehen worden und daher wurde diese Bremse auch für diesen Zweck genutzt.
Das machte jedoch den Aufbau etwas
umfangreicher, denn es wurden auch Leitungen zu den beiden
Stossbalken
geführt. Bei jedem Stossbalken wurde die Leit-ung getrennt und zwei Luftschläuchen zugeführt. Diese waren mit einer speziellen Kupplung versehen worden.
Diese verschlossen die Leitung automatisch,
wenn sie nicht gekuppelt waren. So konnte auf die bisher verwendeten
Absperrhähne
verzichtet werden. Diese
Kupplungen
sorgten jedoch dafür, dass bei einer
Zugstrennung
die
Anhängelast
nicht sicher gebremst wurde.
Wie es der Name schon sagt, die
direkte Bremse
wirkte sehr direkt. Mit einem einfachen
Bremsventil
konnten der Druck in den
Bremszylindern
erhöht werden. Je mehr Kraft aufgebaut wurde, desto mehr
Bremskraft
war vorhanden. Maximal war bei der
Regulierbremse
ein
Luftdruck
von 3.5
bar
möglich. Durch den Aufbau des
Ventils,
konnte die
Bremse
sehr gut reguliert werden. Daher auch der ursprüngliche Name
Regulierbremse.
Diese
Bremse
hatte einen grossen Nachteil. Durch die
Kupplungen
konnte die an das
Triebfahrzeug
gekuppelte
Anhängelast
nur gebremst werden, wenn diese mit dem
Ventil
verbunden war. Bei einer
Zugstrennung
löste diese
Regulierbremse
auf den angehängten Fahrzeugen. Damit in dem Fall auch eine
Bremsung
erfolgen konnte, musste das dritte und im Aufbau auch aufwendigste
Bremssystem
verbaut werden.
Da nun aber Bauteile eines anderen Herstellers verbaut wurden, sprach man von einer automatischen Bremse der Bauart Oerlikon.
An der grundsätzlichen Funktion än-derte sich
gar nichts, aber wir sehen trotzdem hin, denn es kann bekannt-lich immer
wieder zu unerwarteten Überraschungen kommen. Bei dieser Bremse wurde eine Haupt-leitung mit einem Luftdruck von fünf bar gefüllt.
Diese Leitung wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt und dort ebenfalls geteilt. Die hier vorhandenen
Luftschläuche
hatten
Absperrhähne
und
Kupplung,
die nicht verschlossen werden konnten. Der
Bajonettverschluss
war so aufgebaut worden, dass es bei einem Bruch der
Stossvorrichtungen
nicht zu Schäden kam. Das sorgte dafür, dass der Druck in der Leitung
abgesenkt wurde.
Um nun eine
Bremskraft
auf dem Fahrzeug zu erhalten, musste an der
Hauptleitung
ein
Steuerventil
angeschlossen werden. Dieses wurde von der Firma Oerlikon Bremsen
geliefert und daher durfte hier nicht mehr von der
Westinghousebremse
gesprochen werden. Wir hingegen müssen uns dieses Steuerventil genauer
ansehen, denn es war für eine Hochleistungsbremse ausgelegt worden und war
daher etwas komplizierter.
Jedoch erfolgte das nur bis zum eingestellten
Wert. Daher haben wir hier ein mehrlösiges
Steuerventil
erhalten. Neu war die Abhängigkeit von der aktuellen Geschwindigkeit. Bei geringen Geschwindigkeiten wirkte das Steuerventil mit der üblichen Personenzugsbremse. Dabei kamen auch die dafür üblichen Luftdrücke zur Anwendung. Jedoch wurde bei höheren Geschwindigkeiten der Luftdruck im Bremszylinder erhöht. Damit war eine vom Tempo abhängige R-Bremse verbaut worden. Der Triebwagen erreichte dadurch eine gute Bremse, die auch bei schneller Fahrt optimal arbeiten und wirken konnte. Wie bei Triebwagen üblich, konnte jedoch die Güterzugsbremse nicht eingestellt werden.
Jedoch war mit der
Personenzugsbremse
und der erwähnten
R-Bremse
eine Ausrüstung vorhanden, die auch eine höhere Geschwindigkeit von bis zu
125 km/h erlaubt hätte. Bei der BLS-Gruppe
wurde dieser Vorteil nicht genutzt, dafür aber die deutlich kürzeren
Bremswege,
was die
Höchstgeschwindigkeit
auf den Strecken auch so erhöhte . Damit haben wir die Druckluftbremsen abgeschlossen und können uns nun den mechanischen Bremsen zuwenden. Bei diesen gab es jedoch bei den Triebwagen einen Unterschied. Dieser war eine Folge davon, dass das Modell für die GBS abspecken musste.
Das führte dazu, dass dort die doppelte Anzahl
Bremszylinder
verbaut wurde. Bei den Modellen der BN wirkte ein
Zylinder
auf ein
Drehgestell.
Bei der GBS auf eine
Achse
und so konnte beim
Rollmaterial
dieser
Bahngesellschaft
auch das Gewicht gemindert werden..
Das führte dazu, dass die Wirkung der verbauten
Handbremse
nicht gleich war. Bei den Nummern 761 und 762 konnten alle
Achsen
damit abgebremst werden. Beim später ausgelieferten Modell mit der Nummer
763 jedoch nur noch zwei
Triebachsen.
Auf den Betrieb hatte das keine Auswirkungen, da in dem Fall ja mit den
Bremsen
gearbeitet wurde, die mit
Druckluft
betrieben wurden. Bei der Abstellung ergaben sich keine Nachteile.
Unterschiede zwischen den Bremsgestängen der einzel-nen Bremszylinder ergaben sich nur duch die hier ange-schlossene Handbremse des Modells der GBS.
Diese Bewegung erfolgte indem das
Rad
durch die Wirkung der
Klotzbremse
an der freien Drehung gehin-dert wurde. Es war also eine damals übliche
Lösung verwendet worden, jedoch gab es bei Aufbau einen anderen
Unterschied. Es wurden keine Bremsklötze mehr verwendet. Am Bremsgestänge waren spezielle Sohlenhalter montiert worden. In jedem Halter konnten zwei Bremssohlen eingesetzt werden.
Da jedes
Rad
zwei
Sohlenhalter
hatte, waren 32
Brems-sohlen verbaut worden. Damit war eine ausreichende Anzahl
vorhanden, was zu einer sehr hohen
Bremskraft
führte. Die Ausrüstung des Modells der GBS, kam später auch bei den
Triebwagen
RBe
4/4 der
Staatsbahnen
zur Anwendung.
Die mit grosser Kraft gegen die
Lauffläche
gepressten
Bremssohlen bestanden aus Grauguss. Dank diesem Material nahmen
diese Sohlen die durch die Reibung entstehende Wärme auf. Zudem wurden sie
auch abgenützt, was dazu führte, dass der Weg vom gelösten Zustand bis zur
Lauffläche immer grösser wurde. Das hatte eine schlechtere Bremswirkung
zur Folge und das durfte natürlich in keinem Fall passieren.
Um die
Bremskraft
gleichbleibend zu halten, war in jedem
Bremsgestänge
ein automatischer
Gestängesteller
verbaut worden. Dieser stellte die
Bremse
nach und er verringerte den Aufwand, denn bei den Bremsen mussten nur noch
die Sohlen ausgewechselt werden. Diese hatten ein geringeres Gewicht und
waren daher besser in der Handhabung. Wir jedoch können die
Bremsausrüstung der
Triebwagen
damit abschliessen.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Hier
wurde ein von der Firma SLM entwickeltes Modell verwendet. Dieses wurde
vom Hersteller
Hier
wurde ein von der Firma SLM entwickeltes Modell verwendet. Dieses wurde
vom Hersteller
 Die
erwähnten
Die
erwähnten
 Neben
den vier
Neben
den vier
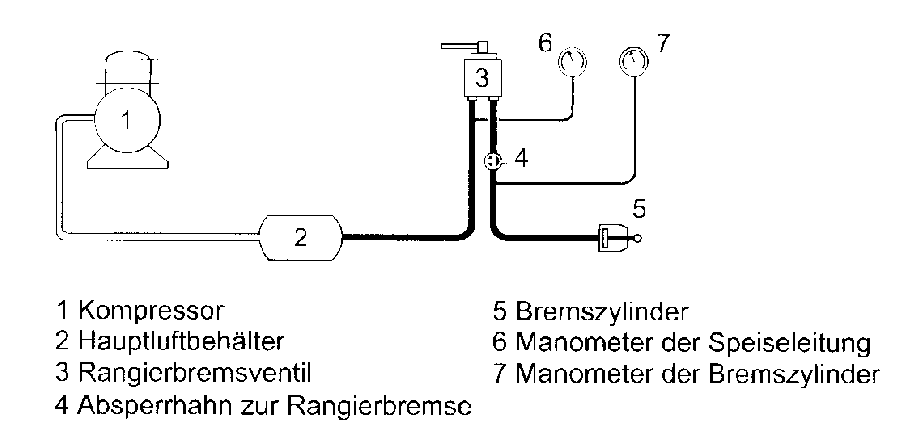 Kommen
wir bereits zum zweiten
Kommen
wir bereits zum zweiten 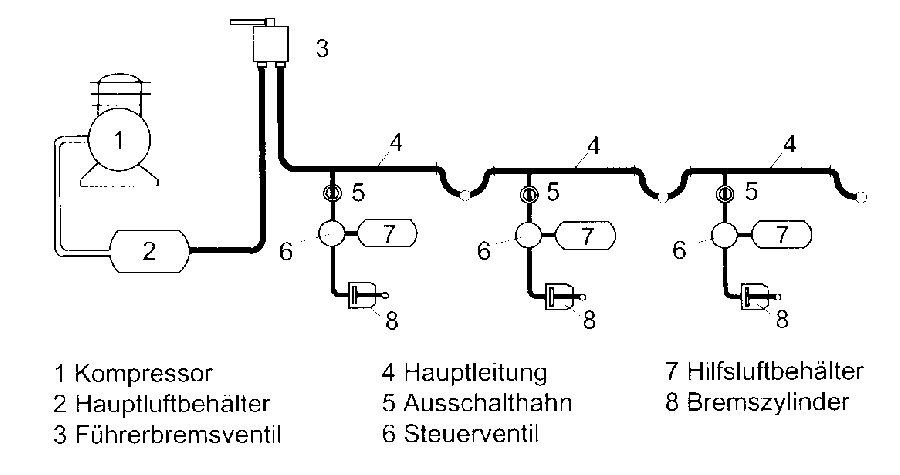 Als
Sicherheitsbremse wurde eine indirekt wirkende
Als
Sicherheitsbremse wurde eine indirekt wirkende

 Jedem
Jedem