|
Fahrgastbereich |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Um in das Fahrzeug zu gelangen gab es die vier seitlichen
Einstiegstüren.
Nur dem
Zugpersonal
war auch ein Zugang von der
Anhängelast
her möglich. Wir blenden diese nach den üblichen Normen aufgebaute
Möglichkeit aus und benutzen einen der seitlichen Einstiege. Das erfolgte
in der Regel auch durch das
Lokomotivpersonal,
das keinen eigenen Zugang erhalten hatte. Da wir dessen Arbeit später
ansehen, verhalten wir uns als Reisende.
Danach konnte an der Türe gezogen werden. Egal welche der Seiten
man nahm, die beiden Flügel waren mechanisch verbunden und so öffnete sich
immer der ganze Zugang zum Fahrzeug. Wurde die Türe geöffnet, faltete sich jeder Flügel zusammen. So ragten sie auch im geöffneten Zustand nicht über das Lichtraumprofil hinaus. Man konnte mit dem Triebwagen bei offener Türe fahren.
Für die Reisenden deutlich wichtiger war jedoch, dass die
seitlichen
Griffstangen
verdeckt wurden. Diese wurden während dem Betrieb stark verschmutzt und
daher sollten sie nicht von den Leuten erreicht wer-den. Bevor wir den nun freien Durchgang benutzen, schlies-sen wir die Türe wieder. Dazu konnte sie einfach zugestossen werden.
In dem Fall fiel die Türe in den Riegel und musste nachher wieder
mit der Türfalle geöffnet werden. Eine Lösung, die auch von innen
funktionierte, denn auch auf dieser Seite waren die Türfallen vorhanden.
Es war also möglich, die Einsteige von beiden Orten zu öffnen, was auch
logisch erscheint.
Es war auch eine Schliessung ab dem besetzten
Führerstand
möglich. In dem Fall wurde die Türe mit der Hilfe von
Druckluft
zugezogen und auch in dieser Position gehalten. Es war weder eine
Lichtschranke
noch ein
Einklemmschutz
vorhanden. Die
Einstiegstüren
knallten zu, ob sich jemand dort befand oder nicht. So lange die Druckluft
anstand, konnte die Türe nur mit sehr grossem körperlichen Kraftaufwand
geöffnet werden.
Auch wenn diese Treppe nicht mehr so steil war, waren seitliche
Handläufe vorhanden. An denen konnte man sich während der Benutzung der
Treppe festhalten. Wer je-doch den Aufstieg geschafft hatte, stand auf
einer ein-fachen
Plattform. Von dieser Plattform aus, konnte man in Richtung dem Ende des Fahrzeuges zum Führerstand gelangen. Wenn wir uns umsehen, dann konnten wir erkennen, dass sich auch dieser Führerraum in die drei Bereiche der Front aufteilte.
Dabei wurde auf der rechten Seite eine normale
Führ-erkabine
eingerichtet. Diese war mit einer gläsernen Wand abgegrenzt worden. Mit
dieser sollte verhindert werden, dass Manipulationen vorgenommen wurden. Die Türe der Führerkabine konnte jedoch so umge-schwenkt werden, dass der Zugang in den Führerraum nur dem Lokomotivpersonal vorbehalten war.
War das nicht der Fall, war der Zugang zur
Fronttüre
möglich. Diese besass eine Türfalle und so hätte sich auch ein Reisender
auf den waghalsigen Weg über das offene
Übergangsblech
machen können. Da hier jedoch ein Schloss vorhanden war, musste diese mit
dem Schlüssel entriegelt werden.
Genauer ansehen sollten wir uns die linke Seite, denn diese war
auch den Reisenden zugänglich. Dieser spezielle Fall war auch der Grund,
warum das hier verbaute Seitenfenster keinen weissen Strich bekommen
hatte. Die Person, die dort sass, hatte vielleicht gar nichts mit den
Abläufen
im Bahnverkehr zu tun. Sie sehen, der weisse Strich hatte seine Bedeutung
und das wurde bei diesen
Triebwagen
klar erkenntlich.
Dies ging nicht anders, da diese Türe nur auf der Seite des
Lokführers eine Türfalle besass. Die andere Seite war mit einem Schloss
versehen worden. Der dazu erforderliche Schlüssel wurde jedoch vom
Personal mitgeführt. Wer auf der Sitzbank einen Platz fand, konnte einen guten Blick nach vorne auf die Strecke erhaschen. Obwohl die Sitze nicht bei der Anzahl aufgeführt wurden, es waren begehrte Plätze.
Vorne der Blick auf die Strecke und hinten bot sich im schwach
beleuchteten Bereich auch die Möglichkeit, diese Sitze als Knutschecke zu
benutzen. Es gab also viele Möglichkeiten auf diesem
Triebwagen
und das alles in der dritten
Wagenklasse.
Nach dem wir uns im
Führerraum
umgesehen haben, verlassen wir den Raum wieder. Den genauen Blick in die
einfache
Führerkabine
werden wir wagen, wenn wir die Aufgaben des Personals ansehen. Reisende,
die in der Kabine keinen Platz fanden, mussten sich dem Abteil zuwenden
und nun gab es bei den
Plattformen
einen grossen Unterschied, denn nicht bei jeder folgte sofort die
Seitenwand. Wir beginnen dort, wo das der Fall war.
Es waren daher keine einladenden Bereiche und daher sollten die
Reisenden auch die Abteile aufsuchen und das werden wir auch machen. Dazu
muss in der Querwand einfach die Türe mit Fenster gegen das Abteil
geöffnet werden. Wenn wir zuerst den Raum betrachten, dann war zu erkennen, dass der Belag des Bodens übernommen wurde. Jedoch wurden die Wände nun verkleidet und eine weisse Decke eingezogen.
Zwischen diesen Wänden und den Seitenwänden gab es eine
Isolation.
Diese war auch zwischen der Decke und dem Dach vorhanden. So sollte der
Innenraum nicht so schnell auskühlen. Im Sommer war eine Abgrenzung vom
heissen Blech vorhanden. Da die Isolation leicht sein musste, wurde Spritzasbest verwendet. Dieser Werkstoff war leicht, konnte einfach bearbeitet werden und war daher ideal geeignet. In den von Reisenden benutzten Fahrzeugen kam das Produkt daher immer wieder zur Anwendung.
Noch wusste man nicht um die grosse Gefahr, die für das Personal
bei der Bearbeitung bestand. Man schätzte wirklich das geringe Gewicht und
hier war das besonders der Fall. Im Abteil waren die Sitzbänke eingebaut worden und sie wurden durch den mittig verlaufenden Durchgang getrennt. Auch diese Sitze entsprachen den Modellen der neuen Leichtstahlwagen.
Lediglich der
Sitzteiler
wurde auf den Wert von 1600 mm verkürzt. Man musste sich also etwas enger
Setzen. Dafür gab es seitlich bei der BLS-Gruppe
mehr Platz, denn hier konnten sich nur noch vier Personen setzen, was eine
weniger war.
Das Abteil hatte auf jeder Seite vier
Senkfenster
erhalten, die von den Reisenden geöffnet werden konnten. Damit ergaben
sich die Sitze, denn diese standen immer hinter den Wänden. So befand sich
das Fenster mittig zum Abteil. Darunter war ein kleines Tischchen mit
einem Abfallbehälter montiert worden. Da sich in diesem Abteil für 32
Reisende Raucher setzen durften, war in den Tischchen noch ein
Aschenbecher verbaut worden.
Auch wenn eine Polsterung vorhanden war, wir dür-fen uns keine
gediegenen Sofas vorstellen, denn diese waren nur den anderen zwei
Wagenklassen
vorbe-halten. Trotzdem war die Ausstattung sehr modern, was auch dem
Muster zu verdanken war. Beim Bezugsmaterial verwendet man ein spezielles als Kunstleder bezeichnetes Produkt. Dieses bekam in diesem Abteil eine grüne Farbe. Man hatte so ein Material, das sehr widerstandsfähig war, das sich im Sommer jedoch unangenehm erwärmen konnte.
Noch verwendete man bei der dritten
Wagenklasse
keine Stoffe, die einfach noch zu teuer waren. Immerhin waren die
Holzbänke verschwunden, was damals schon viel war. An der Wand und zum Durchgang hin waren einfache Armlehnen vorhanden. Dazu wurde ein Kunststoff auf dem Metallgestell montiert.
Diese nicht verstellbaren Lehnen beschränkten den Platz und
sorgten so dafür, dass man bei guter Auslastung nicht seitlich von der
Sitzbank rutschen konnte. Es war so auch ein seitlicher Halt vorhanden,
der insbesondere bei der Fahrt wichtig war, weil man durch den Bezug
seitlich rutschen konnte.
Um Taschen abzulegen und Jacken aufzuhängen, waren über den
Sitzbänken die quer zur Fahrrichtung eingebauten
Gepäckträger
eingebaut worden. Auch diese aus Metall mit Holzlatten aufgebauten
Gestelle stammten von den
Leichtstahlwagen.
Damit entsprachen die
Triebwagen
zumindest in diesem Punkt dem Standard, der von den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB damals eingeführt wurde. Die BLS-Gruppe
passte sich an.
Diese zogen die Luft aus dem Innenraum, wenn sie durch den
Fahrtwind angetrieben wurden. Eine damals übliche Lösung, die kaum für
eine
Kühlung
sorgte. Wie man das verbesserte, werden wir beim elektrischen Teil noch
kennen lernen. Um dem Rauch zu entkommen, verlassen wir dieses Abteil wieder. Dazu war eine weitere Querwand mit Türe vorhanden. Auch diese öffnete gegen das Abteil und es öffnete sich ein Durchgang.
Mit den grauen Wänden war dieser nicht einladend und auch nicht
für den langen Aufenthalt gedacht. Hier fand das Personal technische
Bauteile, die bei der Bedienung wichtig waren. Damit wir diese nicht
öffnen konnten, waren sie verriegelt.
Es war hinter der Türe eine kleine Kabine vorhanden. Da sich die
Türe zudem gegen diese öffnete, wurde es sehr eng. Wer hier hinging hatte
gerade einmal knapp einen Quadratmeter Platz zur Verfügung. Man musste
sich also in diese Kabine zwängen. Beidseitig war diese Türe zudem mit
normalen Türfallen versehen worden und daher konnte der Bereich ohne
Probleme auch von den Reisenden genutzt werden.
Verschlossen werden konnte die Türe jedoch nur von der Kabine her.
Dazu war bei der Türe ein einfacher Riegel vorhanden. Er war leicht zu
bedienen, da jeder, der den Raum benutzte diesen auch benutzte. Es war das
einzige WC des
Triebwagens,
das durch das weisse Fenster mit fahlem Licht erhellt wurde und das auch
nicht einladend wirkte. Hier wurde wirklich nur die Notdurft und das auch
nur während der Fahrt verrichtet.
Die festen Stoffe rutschen so durch das Fallrohr ins Gleisbett, wo
sie durch die Fahrt verteilt wurden. Das war auch der Grund, warum das WC
im Stillstand nicht benutzt werden durfte. Wer sich die Hände reinigen wollte konnte das in einem kleinen Becken. Es konnte dazu ein Spender mit Trockenseife benutzt werden. Dazu wurde über dem WC in einem Tank Wasser mitgeführt.
Dieses diente nur den Händen und war kalt. Über diesem Waschbecken
war noch ein
Spiegel
vorhanden. Dank dem konnte man sich die Haare richten. Dieser machte zudem
den Raum etwas grösser, als er wirklich war. Da auch der Durchgang mit den Schaltgeräuschen aus dem Ma-schinenraum nicht einladend war, verlassen wir diesen wieder und dazu war eine weitere Türe vorhanden. Diese öffnete sich in unserer Gehrichtung. Damit
kommen wir auch gleich in das Abteil, das für die Leute vorgesehen war,
die sich nicht dem Rauch aussetzen wollten. Es entsprach von der
Ausstattung her dem vorherigen Abteil, nur dass nun rote Sitzpolster
verwendet wurden.
Es fehlten jedoch die Aschenbecher und auch eine Sitzreihe. Daher
konnten sich in diesem Abteil nur 24 Reisende setzen. Im Unterschied zu
den
Staatsbahnen,
wo eine gleichmässige Verteil-ung vorhanden war, wurde bei diesen
Fahrzeugen die Verteilung zu Gunsten der rauchenden Leute geändert. Total
waren jedoch 56 Sitze verbaut worden. Das auch, weil die Sitzplätze in den
beiden
Führerständen
nicht mitgerechnet wurden.
Damit stellt sich uns natürlich gleich die Frage, was mit der
fehlenden Sitzreihe passiert ist. Seit der Vorstellung des Kastens wissen
wir, dass die Fenster gleich angeordnet worden waren. Hier fehlte davon
jedoch eines und so passieren wir eine weitere Türe um den
Fahrgastraum
für Nichtraucher zu verlassen. Damit gelangen wir nun wieder auf die
Plattform
hinter dem
Führerstand. Jedoch war sie deutlich grösser gestaltet
worden.
Die so entstandene freie Fläche war als Stauraum für das mitgeführte Ge-päck vorgesehen.
Es konnte aber auch von Reisenden benutzt werden, die nur kurz
mitfuhren und sich daher nicht setzen wollten. Für müde Beine waren jedoch
an der Querwand zum
Fahrgastraum
zwei Sitzbänke vorhanden, die abgeklappt werden konnten.
Damit sich die stehenden Leute während der Fahrt halten konnten,
waren an den Seitenwänden und in der Mitte des Bereiches Haltestangen
montiert worden. Es waren einfache Lösungen, die aus Chromstahl bestanden
und daher nicht weiter farblich behandelt werden mussten. So konnten hier
sehr viele Leute stehen, was die
Kapazität
des
Triebwagens
deutlich steigerte. In Randzeiten, konnte auch kleines Stückgut mitgeführt
werden.
Auf die Ausleuchtung und die Vorstellung der
Heizung
wird hier verzichtet. Wir werden diese Bereiche zu gegebener Zeit ansehen.
Es kann gesagt werden, dass das Abteil dieser drei
Triebwagen
vielmehr den
Leichtstahlwagen
der
Staatsbahnen
entsprachen, als der Reihe
BCFe 4/8,
die zumindest seitlich noch enger bestuhlt wurde. Im Vergleich galten
diese Fahrzeuge bei der BLS-Gruppe
als sehr komfortabel und modern.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
Türen stammten von den
Die
Türen stammten von den  Der
bei geöffneter Türe möglich Zugang erfolgte über eine Treppe. Deren
unterste Stufe befand sich noch ausserhalb und bildete das Trittbrett. Die
weiteren drei Stufen befanden sich jedoch innerhalb des Fahrzeuges.
Der
bei geöffneter Türe möglich Zugang erfolgte über eine Treppe. Deren
unterste Stufe befand sich noch ausserhalb und bildete das Trittbrett. Die
weiteren drei Stufen befanden sich jedoch innerhalb des Fahrzeuges. Auf
der linken Seite war eine gepolsterte Sitzbank mit Rückenlehne vorhanden.
Diese war im besetzten
Auf
der linken Seite war eine gepolsterte Sitzbank mit Rückenlehne vorhanden.
Diese war im besetzten

 Wie
bei den Mustern der
Wie
bei den Mustern der
 Gerade
beim Abteil für Raucher war eine
Gerade
beim Abteil für Raucher war eine
 Das
WC war von der Marke freier Schienenblick. Um den unangenehmen und kühlen
Luftzug am Hinterteil und den Blick nach unten zu vermeiden, war ein
Deckel vorhanden. Dieser konnte nach dem «Geschäft» mit einem Fussschalter
geöffnet werden.
Das
WC war von der Marke freier Schienenblick. Um den unangenehmen und kühlen
Luftzug am Hinterteil und den Blick nach unten zu vermeiden, war ein
Deckel vorhanden. Dieser konnte nach dem «Geschäft» mit einem Fussschalter
geöffnet werden.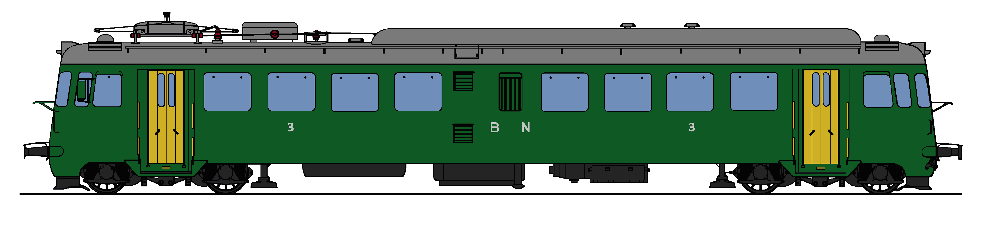 Hier
schloss sich der
Hier
schloss sich der