|
Traktionsstromkreis |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Beginnen wir mit der elektrischen Ausrüstung, die von
der Firma SAAS gebaut wurde. Zumindest in einem Punkt war alles klar. Die
Triebwagen
sollten für eine
Fahrleitungsspannung
von 15 000
Volt und 16
2/3
Hertz geeignet sein. Andere Systeme waren jedoch nicht mehr
vorgesehen. Für den
Ausflugsverkehr nach Stresa waren diese Fahrzeuge auch
nicht beschafft worden und daher reichte eine
Spannung vollkommen aus.
Neben der Frage nach dem Gewicht, war auch der
Platz auf dem Dach nicht vorhanden. Daher wurde über dem
Führerstand eins ein
Scherenstromab-nehmer aufgebaut. Das
verwendete Modell stammte von der BBC und war schon bei der Reihe
Ae 4/4
verwendet worden. Der Bügel wurde mit der Hilfe von Druckluft gehoben. Mit dieser wurde die Kraft der verbauten Senkfeder aufgehoben. Da nun diese Kraft nicht mehr vorhanden war, konnte die Hubfeder ihre Kraft entfalten und den Strom-abnehmer heben.
Dank den beiden
Federn konnte der
Anpressdruck leicht eingestellt werden und die Sache funktionierte
unabhängig vom
Luftdruck, was bei Störungen
und dem Einsatz der
Handluftpumpe sehr hilfreich sein konnte.
Gehoben wurde der
Stromabnehmer
bis die
Wippe den
Fahrdraht
berührte. Fehlte dieser sorgte eine
Höhenbegrenzung dafür, dass
dieser wieder gesenkt werden konnte. In der erwähnten Wippe waren zwei
Schleifleisten aus
Kohle
eingebaut worden. Diese wurden mit den
Notlaufhörnern ergänzt und hatten eine Breite von 1 320 mm erhalten. Das
entsprach dem Wert, der auf den Strecken der BLS-Gruppe verwendet wurde.
Wollte man den Bügel wieder senken, musste nur die
Druckluft entfernt werden. Da diese schnell aus dem
Zylinder entwich
entstand kurz ein Unterdruck, der das
Schleifstück regelrecht von
der
Fahrleitung
riss.
Danach sorgte die
Senkfeder dafür, dass der
Stromabnehmer
gesenkt wurde.
Dabei fiel er auf die Auflager und blieb in dieser Position. Da aber nur
ein Modell verbaut war, müssen wir den Bügel heben, da nur so die
Spannung
übertragen wurde.
Es war einfach die auf dem Dach erforderliche
Verbindung
zum
Hauptschalter, der ebenfalls auf dem Fahrzeug aufge-baut worden war. Jedoch
war die Leitung auch mit dem
Erdungsschalter
verbunden worden. Mit dem Hauptschalter kommen wir zum zentralen Schalt-element des Fahrzeuges. Es handelte sich dabei um einen von der BBC entwickelten Drucklufthauptschalter. Sein Vorteil war, dass er auch sehr hohe Ströme sicher schalten konnte.
Zudem war der
Hauptschalter etwas leichter aufgebaut
worden, als die alten
Ölhauptschalter der anderen
Baurei-hen. Soweit
stimmte das für die drei
Triebwagen, jedoch wurde das Modell beim
Triebwagen der GBS verändert. Bei den Triebwagen für die BN verwendete man ein Modell, das auch bei den beiden Prototypen der Reihe Ae 6/6 verbaut wurde.
Die Schaltkontakte waren hier in einem gut sichtbaren Gehäuse eingebaut
worden. Das Fahrzeug der GBS erhielt jedoch das Nachfolgemodell mit der
Bezeichnung DBTF 20i, das noch etwas leichter war, da hier die
Schaltkontakte nicht mehr in einem Gehäuse eingebauten wurden und offen
waren.
Um diesen
Hauptschalter einzuschalten war ein
geringerer
Luftdruck nötig, als beim Ausschalten, wo die
Druckluft zum
Löschen des
Abreissfunkes benötigt wurde. Das konnte dazu führen, dass der
Drucklufthauptschalter zwar eingeschaltet werden konnte, aber ein Ausschalten nicht
mehr ohne Schaden möglich war. Aus diesem Grund war mit der
Niederdruckblockierung eine Schutzeinrichtung für die Kontakte des
Schalter vorhanden.
In diesem Schalter integriert wurde auch der
Überspannungsableiter,
der die elektrische Ausrüstung vor den Auswirkungen eines Blitzschlages
schützen sollte. So war der
Triebwagen
sehr gut geschützt worden. Nach dem Hauptschalter mit Erdungsschalter wurde die Spannung der Fahrleitung über eine weitere Dachleitung zur Mitte des Fahrzeuges geleitet. Dort war dann eine Durchführung vorhanden, die dafür sorgte, dass die Fahrleitungsspannung in das Fahrzeug geleitet wurde.
In
einem durch den
Maschinenraum führenden Kabel für
Hochspannung wurde
schliesslich der unter dem Boden aufgehängte
Transformator erreicht. Im Transformator wurde die Spannung aus der Fahrleitung der primären Spule zugeführt. In dieser Wicklung wurde dann ein elektromagnetischer Widerstand erzeugt und so der mögliche Strom beschränkt.
Auf der anderen Seite war die
Spule schliesslich mit den bei
den
Achsen montierten
Erdungsbürsten
verbunden worden.
Dank diesen entstand ein geschlossener
Stromkreis und es konnte
Energie vom
Kraftwerk
übertragen werden.
Durch das Magnetfeld im Eisenkern wurde in der zweiten
Spule eine
Spannung erzeugt. Diese für die
Fahrmotoren
gedachte
Wicklung
hatte diverse
Anzapfungen
erhalten, bei denen unterschiedliche Werte
abgenommen werden konnten. Der Vorteil dieses Aufbaus war, dass so
Isolation
eingespart werden konnte. Jedoch war wegen dieser Lösung das
Gewicht deutlich grösser und der
Transformator musste mittig montiert
werden.
Da an diesen
Schaltelementen regelmässig Unterhalt vorgenom-men werden musste, waren die
schon erwähnten beiden grossen Tore in der Seitenwand vorhanden. Wir
jedoch sehen uns diese Bauteile nun etwas genauer an. Entwickelt worden war die offiziell als elektropneumatische Schützensteuerung bezeichnete Anlage von der Firma SAAS. Diese war im Aufbau solcher Anlagen führend.
Dank den guten
Beziehungen zur BLS-Gruppe auch in der Lage eine gute Abstimmung zu
erhalten. Gerade in dem Punkt konnten bei
Triebfahrzeugen immer wieder
Probleme auftreten. Der Vorteil war hier auch die sehr schnelle
Schaltfolge der
Hüpfer.
Auch wenn die
Hüpfersteuerung
sehr schnelle
Schaltfolgen erlaubte, war sie nicht in der Lage die
Spannung ohne
Unter-bruch zu verändern. Nach den Elementen war dann eine weitere
Schaltung nötig und diese zusätzlichen Bauteile wurden wegen der
notwendigen
Kühlung
wieder im Gehäuse des
Transformators eingebaut. Doch
nun zu diesen
Überschaltdrosselspulen, die es erst ermöglichten die Spannung
ohne Unterbruch zu verändern.
Die einzelnen
Anzapfungen
wurden den Endanschlüssen
zugeführt. Am mittigen Anschluss konnte dann eine der beiden
Spannungen
angeboten werden. So war eine Erhöhung der Spannung ohne Unterbruch
möglich und der
Triebwagen
hatte insgesamt 18
Fahrstufen erhalten. Das
waren sogar mehr Stufen als Anzapfungen vorhanden waren. Die
Hüpferbatterie
war
daher nicht so schwer ausgefallen, was hier wichtig war.
Das Fahrzeug war für
Wechselstrom ausgelegt worden und daher wurden auch zu diesem System
geeignete
Fahrmotoren
verwendet. Wobei wir dort noch ein grosses Wunder
erleben könnten. Doch noch sind wir nicht bei den
Triebmotoren angelangt. Fahrmotoren konnten nicht direkt angeschlossen wer-den, da in dieser Leitung keine Umpolung erfolgen konnte. Aus diesem Grund mussten in der Leitung als weiteres Element die Wendeschalter verbaut werden.
Da diese ein stattliches Gewicht haben konnten, wurd-en die
Fahrmotoren
geschaltet. Mit anderen Worten noch war es nicht möglich für jeden
Fahrmotor einen
Wendeschalter zu verwenden. Hier war
in den
Maschi-nenräumen auch der Platz nicht
vorhanden. Einem Wendeschalter wurden die Fahrmotoren eines Drehgestells zugeordnet. Diese waren zudem in Reihe angeschlossen worden.
Das führte dazu, dass bei einem Defekt am
Fahrmotor
die halbe
Traktionsleistung verloren ging. Die dazu erforderlichen Schaltungen
erfolgten bei den
Wendes-chaltern durch abheben der Kontakte. Der direkte
Zugang zu den Fahrmotoren war mit Klappen im Fussboden möglich.
Aufgabe der
Wendeschalter war, die Gruppierungen der
Motoren so vorzunehmen, dass die Drehrichtung und damit die Fahrrichtung
des
Triebwagens
umgestellt wurde. Jedoch war es auch möglich, die
Fahrmotoren
so zu schalten, dass ein elektrischer Bremsbetrieb ermöglicht
wurde. Bevor wir diesen ansehen, wenden wir uns aber den Fahrmotoren zu.
Diese waren identisch aufgebaut worden, so dass wir nur einen ansehen
müssen.
Somit waren ganz normale
Seriemotoren verbaut worden, die sich
seit Jahren beim Bau von
Triebfahrzeugen für
Wechselstrom bewährt hatten.
Wichtig waren jedoch de-ren Eckdaten. Alle vier Fahrmotoren konnten eine Anfahrzugkraft von 140 kN erzeugen. Diese konnte bis zur Leistungsgrenze aufgebaut werden. Erreicht wurde diese bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h.
Da hier der
Wert für eine
Stundenleistung
angenommen wurde, betrug die
Zugkraft in diesem
Zeitraum noch 82 kN. Nun stand eine
Leistung
von 2 000 PS zur Verfügung
und wir haben die Werte des Datenblattes zu dieser
Bau-reihe erhalten. Auch wenn wir eher eine tief angesetzte Leistungsgrenze haben, der Triebwagen war recht flott auf Geschwin-digkeit. Jedoch musste ab 70 km/h gewartet werden, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht wurde.
Diese Lösung zeigte, dass es sich hier um ein Fahrzeug handelte, dass für
Steilstrecken ausgelegt worden war. Das
Pflichtenheft war daher
korrekt umgesetzt worden, was für den Hersteller dieses
Triebwagens
sprach.
Nachteilig war die Neigung dieser
Seriemotoren zur
Drehmomentpulsation. Diese hatte man damals noch nicht vollständig im
Griff und so wurde immer wieder mit den Polen gearbeitet. Wie sich dieser
Effekt hier auswirken sollte, können wir erahnen, da es beim Modell der
GBS zu einer Veränderung bei den
Getrieben kam. Ansehen werden wir das
später, denn noch haben wir diesen
Stromkreis noch nicht abgeschlossen.
Obwohl die beiden Bahnen eher flach waren, sah man den Vorteil
dieser
elektrischen
Bremse, denn so konnte der
Triebwagen
verzögert werden, ohne dass
die
Bremsklötze
benötigt wurden. Eine Idee, die sich auch bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB immer mehr festigen konnte. Im Gegensatz zu den Staatsbahnen, die mit der Erregermotorschaltung sehr gute elektrische Nutz-strombremsen hatten, baute die BLS-Gruppe hier eine nicht so wirtschaftliche Widerstandsbremse ein.
Dabei lag das Problem nicht beim Mut und auch nicht bei den einspurigen
Strecken, sondern beim Versor-ger, denn die
Betriebsgruppe kaufte den
Strom
ein und der Anbieter wollte den Anteil der Blindleistung so gering wie nur
möglich halten.
Widerstandsbremsen für
Wechselstrom hatten eine
schlechte Wirkung und wurden kaum mehr verwendet. Daher wurde eine andere
Lösung eingebaut. Für die Erregung der
Fahrmotoren
wurde eine dazu
vorgesehene
Umformergruppe
verwendet. Diese wurde von den später noch
betrachteten
Hilfsbetrieben versorgt. Das führte dazu, dass der Betrieb
der
elektrischen
Bremse
von der
Spannung in der
Fahrleitung
abhängig war.
Im Bremsbetrieb wurden die
Fahrmotoren
mit
Gleichstrom
erregt. Das führte dazu, dass diese auch eine
Gleichspannung abgaben. Die
dabei erzeugte
Bremskraft wurde durch die Veränderung der Erregung ab der
Umformergruppe
geregelt. Dabei waren hier insgesamt 29
Bremsstufen
vorhanden. Es waren also mehr Stufen möglich, als das in Fahrbetrieb der
Fall war. Es war somit eine feine Regelung bei der
elektrischen
Bremse
vorhanden.
Die erzeugte
Gleichspannung wurde dazu den auf dem Dach des
Triebwagen montierten
Brems-widerständen zugeführt. Da diese, wie es der Name schon sagt einen
Widerstand boten, wurde der
Triebwagen dank der
Bremse wirksam verzögert. Die Bremswiderstände waren unter Abdeckungen montiert worden und wurden durch den Fahrwind gekühlt. Dabei gab es Unterschiede bei der Ge-staltungen der Abdeckungen zwischen den Trieb-wagen der BN und dem Modell der GBS.
Auf die Funktion der
elektrischen
Bremse und auf deren
Leistungsfähigkeit hatte diese Veränderung jedoch keinen Einfluss, so dass
alle drei
Triebwagen die gleiche elektrische Bremse erhalten hatten.
Wir können damit den Traktionsstromkreis beenden. Diese
drei
Triebwagen wurden so aufgebaut, wie das bei der BLS-Gruppe auch bei
anderen
Baureihen der Fall war. Das war den guten Beziehungen zwischen dem
Hersteller und dem Kunden zu verdanken. Im Betrieb sollte so kein grosser
Aufwand bei der Schulung des
Lokomotivpersonals erforderlich sein. Auch die
Staatsbahnen sollten diesen Punkt in der Folge umsetzen.
Um das Gewicht der Bauteile zu verringern, mussten die
Elemente teilweise so stark belastet werden, dass sie nicht langfristig
verwendet werden konnten. Bei einem
Triebfahrzeug war das jedoch nicht
gewünscht und so mussten diese aktiv gekühlt werden. Das erfolgte bei
diesen drei
Triebwagen jedoch mit einem eigenen
Stromnetz. Dieses werden
wir nun ansehen und dabei kommen wir auch zu den
Nebenbetrieben.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Um die
Um die  Die vom
Die vom
 Parallel zum
Parallel zum 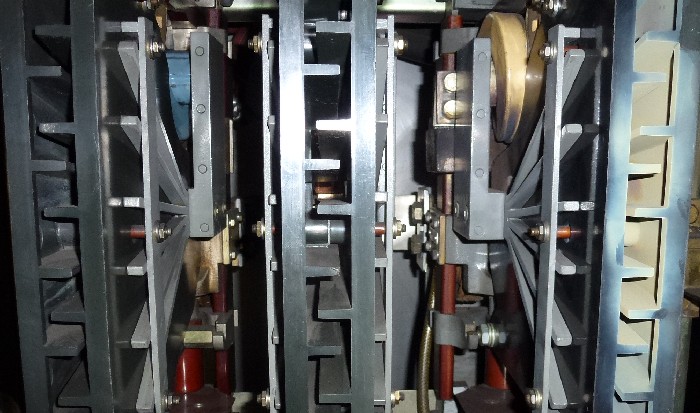 Die einzelnen
Die einzelnen
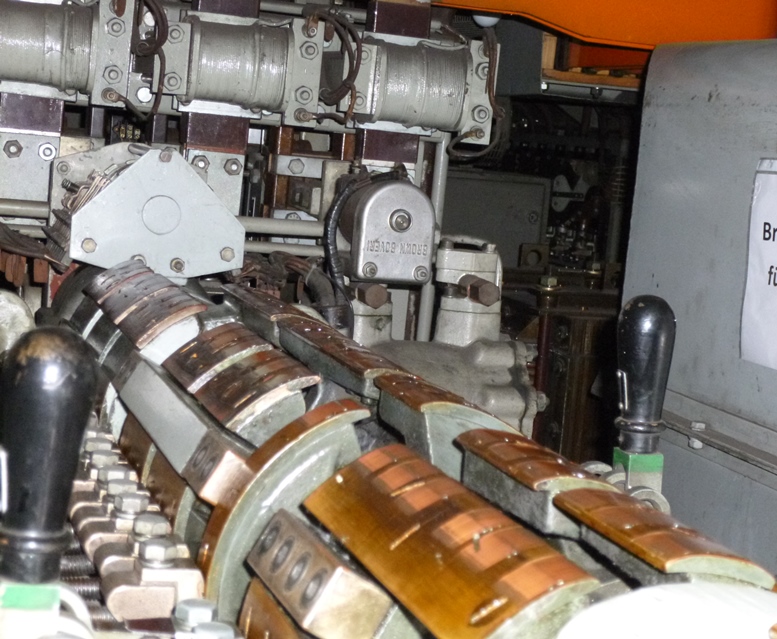 Eine weitere Veränderung des
Eine weitere Veränderung des  Verwendet wurden vier
Verwendet wurden vier  Bei der Betrachtung der
Bei der Betrachtung der
 Bei dieser
Bei dieser