|
Bedienung des Triebwagens |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wir kommen zur
Bedienung des
Triebwagens
und da gab es mehrere Möglichkeiten. Der Grund ist simpel, denn der zu
besetzende
Führerstand
war nicht mehr zwingend auf dem Fahrzeug. Doch beginnen wir die
Betrachtung auch hier ganz am Anfang. Das bedeutet, dass wir den
Pendelzug
im
Gleisfeld
eines
Bahnhofes
übernehmen. Anschliessend geht es auf die erste Fahrt mit dem neuen
Fahrzeug. Dabei war ganz am Anfang der Lokführer noch alleine.
Die restlichen
Fahrzeuge wurden von anderem Per-sonal besichtigt. Wie bei den
Lokomotiven
galt die Suche nach Beschädigungen oder losen Teilen, die während der
Fahrt verloren gehen konnten. Wegen dem tiefen Kasten war diese Kontrolle
nicht so einfach.
Der Einstieg in das
Fahrzeug war einfach, denn in diesem Zustand des
Triebwagens
konnten die seitlichen Türen einfach aufgezogen werden. So war der Zugang
zwar frei, jedoch stand das Personal noch am Boden. Da jedoch die
Trittbretter für
Bahnsteige
ausgelegt waren, stand eine richtige Kletterpartie auf dem Programm. Das
Fahrpersonal musste sich wirklich an den Stangen haltend hochziehen und so
die unterste Stufe erreichen.
Im
Triebwagen
begab sich der Lokführer zuerst in die Mitte des Triebwagens. Im Bereich
des
Maschinenraumes
konnte der mit seinem Schlüssel den Schrank mit dem
Luftgerüst
öffnen. Durch die offene Türe wurde das Licht in diesem Bereich
eingeschaltet. So konnten die beiden
Hauptluftbehälterhähne
geöffnet werden. Je nach Schaltung der
Beleuchtung
gab es nun in den
Führerständen
Licht. Der Rest von Fahrzeug war jedoch noch dunkel.
Bis jetzt spielte es
keine Rolle, wie der Zug abgestellt wurde, denn diese Handlungen mussten
auf den
Triebwagen
ausgeführt werden. War ein weiteres Modell im Zug eingereiht worden,
wiederholten sich die Arbeiten auf diesem Fahrzeug, denn es waren
Handlungen, die zur grundlegenden
Inbetriebsetzung
gehörten und daher auf allen
Triebfahrzeugen
ausgeführt werden mussten. Bei einem
Steuerwagen
musste jedoch nichts gemacht werden.
Den Teil mit dem
Steuerwagen
erledigen wir an-schliessend, wenn wir auf dieses Fahrzeug wech-seln. Doch
schalten wir zuerst den
Triebwagen
ein und das ging nun mal nur in einem
Führerstand.
Welcher auf dem Triebwagen es genau war, spielte ebenfalls keine Rolle. Der Zugang zum Führerstand erfolgte von der Platt-form her. Dazu musste die Türe geöffnet werden. Auch jetzt benutzte das Personal seinen Schlüssel. Damit öffnete sich der Blick in den Führerraum.
Dieser war mit dem
dunkelgrauen Boden der Ab-teile belegt worden. Jedoch waren die Wände in
hellgrüner Farbe gehalten und an der Decke leuch-tete die Lampe des
Führerstandes.
Wegen den viel-en Fenstern, waren diese Veränderungen kaum zu erkennen.
An seinem Arbeitsplatz, der sich auf der linken
Sei-te befand, traf das
Lokomotivpersonal
auf einen völlig veränderten
Führertisch.
Einige Schalter, die während der Fahrt nicht oft, oder nie benutzt wurden,
befanden sich an der Rückwand. Dazu gehörten die Schalter für die drei
Stirnlampen, sowie die
Beleuchtungen
der
Instrumente
und des
Führerstandes.
Dazu waren auch noch die diversen
Heizungen
des Führerstandes vorhanden.
Nicht neu war die Sitzgelegenheit, diese gab es
mittlerweile auch auf
Lokomotiven. Auf
Triebwagen waren sie jedoch schon
immer vorhanden. Viel Komfort bot diese aus einer einfachen an der Wand
montierten Rückenlehne und einem einfachen
Hocker bestehende
Sitzgelegenheit nicht. Eine einfache Sitzgelegenheit, die aber vom
Personal geschätzt wurde. Gerade in der engen
Führerkabine
konnte man den
Hocker so stellen, dass man doch noch etwas Beinfreiheit hatte.
Mittig befanden sich die diversen
Anzeigen und der Verriegel-ungskasten. Die linke Seite war den
Bremsventilen vorbehalten. Von diesen waren jedoch nur noch die
Bediengriffe zu erkennen. Letztlich stand in der linken Ecke noch der
V-Messer.
Um den
Triebwagen
einzuschalten, mussten die im Verriegel-ungskasten eingebauten
Steuerschalter benutzt werden. Diese waren mit Symbolen markiert worden.
Damit überhaupt etwas ging, musste der Schalter ganz rechts benutzt
werden, dieser hatte das Symbol einer
Batterie und war für die Steuerung.
Wurde dieser in die Stellung «1» verbracht, aktivierte sich die Steuerung.
Das Licht im
Führerstand
ging aus, und die
Meldelampen für die Türen
leuchteten.
Spannend bei diesem Fahrzeug
war, dass nach unserem Muster in einem
Pendelzug, sämtliche
Steuerschalter
in diesem Verriegelungskasten genutzt werden mussten. Dabei waren jene für
Stromabnehmer,
Hauptschalter und
Kompressor noch leicht verständlich. Die
gelb markierte
Zugsammelschiene wurde hingegen nur bei kalten Tagen genutzt.
Mit dem rechten Schalter für die
Beleuchtung wurde in den Abteilen das
Licht eingeschaltet. Mit dem linken Schalter jedoch die
Stirnbeleuchtung.
War der
Stromabnehmer gehoben und der
Hauptschalter eingeschaltet, konnte der Lokführer an den Anzeigen vor sich
die Werte erkennen. In der rechten Anzeige befanden sich die elektrischen
Anzeigen. Daher war hier eigentlich nur die
Fahrleitungsspannung zu
erkennen. Beim rechten Gerät handelte es sich um die
Manometer. Dort
wurden drei Drücke angezeigt. Da der
Kompressor lief, veränderte sich der
kleine rote Zeiger mit dem Vorrat.
Es ging nun an die Kontrolle der Bremsen. Der Trieb-wagen war soweit eingeschaltet. Die Anzeigen unter dem Schalterkasten waren mehrheitlich dunkel und nur jene für die Türsteuerung leuchteten. Dank der eingebauten Instrumentenbeleuchtung waren diese, wie der Geschwindigkeitsmesser erhellt.
Auch mit den
aktivierten
Bremsen sollte sich an die-sem Bild eigentlich nicht viel
ändern, denn die An-zeigen unter dem Verriegelungskasten wurden erst bei
der Fahrt wichtig. Damit die Druckluftbremsen geprüft werden konnten, mussten die beiden Bremsventile zuerst versorgt wer-den. Dieses als BV-Hahn bezeichnete Ventil befand sich nicht auf, sondern am Führertisch. Erst wenn dieses Ventil geöffnet war, konnten die Bremsventile mit Luft versorgt werden. Jedoch wurde mit den offenen BV-Hahn auch die Zugsicherung aktiviert.
Damit war die
Rangierbremse
bereits bereit, der näher zum Lokführer angeordnete Griff konnte einfach
gegen den Bediener gedreht werden und die
Bremse wurde angezogen.
Zog der Lokführer die
Rangierbremse an, konnte er den
Druck im am nächsten zu ihm liegenden
Bremszylinder ablesen. Über die
restlichen drei Bremszylinder hatte er jedoch keine Informationen. Bei der
Rangierbremse reichte diese Lösung jedoch aus. Für diese Anzeige war bei
diesem
Triebwagen sogar ein eigener Zeiger mit Skala vorhanden. Dieser
schwarze Zeiger war bei der Anzeige sogar mit «Rangierbremse» beschriftet
worden.
Oberhalb des Rangierbremsventils wurde dann das
Bremsventil für die
automatische Bremse montiert. Hier verwendete man dazu
ein
Führerbremsventil
aus dem Hause Oerlikon Bremsen. Es war von der
Bauart
FV4a
und zeichnete sich durch seine grosse Leistungsfähigkeit aus.
Die Bedienung war dem
Lokomotivpersonal bekannt, denn schon die Baureihen
Re
4/4
und
Ae
6/6 hatten dieses Modell erhalten. Zudem war es leicht zu bedienen.
Im Gegensatz zum Vorgängermodell konnte hier jedoch ein
Hoch-druckfüllstoss mit anschliessender
Niederdrucküberladung erzeugt
werden. Damit wurden längere Züge schneller gefüllt. Jedoch musste
deswegen auf dem Fahrzeug eine Schutzvorrichtung eingebaut werden. Die Bremsprobe mit der automatischen Bremse wurde jedoch nicht nur mit den Manometern vollzogen. Da wir davon ausgingen, dass es sich um einem Pendelzug handelt, muss die Bremsprobe mit der automatischen Bremse am ganzen Zug gemacht werden.
Bei der ersten
Inbetriebnahme war dazu eine
Hauptbremsprobe mit Hilfe des Zugpersonals,
oder allenfalls mit dem Personal vom
Rangier-dienst, vorgeschrieben worden. Bei dieser Druckluftbremse kontrollierte das erwähnte Personal den Zug. Der Triebwagen wurde jedoch durch den Lokführer anhand seiner Anzeigen kontrolliert.
Dabei waren die beiden Anzeigen für den
Bremszylinder hilfreich. Man konnte diese Kontrolle nämlich auch bei
angezogener
Rangierbremse vornehmen. Bei anderen Fahrzeugen musste dazu
jede andere
Bremse gelöst sein. Ein Vorteil, den es wirklich nur bei
diesem
Triebwagen gab.
Mit dem Abschluss der Bremsprobe der automatischen Bremse war der Pendelzug eigentlich fahrbereit. Die beim Triebwagen immer noch zur Sicherung angezogene Handbremse konnte nun auf der Plattform gelöst werden. Sofern ein Heizer, oder Führergehilfe anwesend war, über nahm dieser die Aufgabe im Auftrag der Lokführers, der zuerst den Zug mit der Rangierbremse sicherte.
Um die
Handbremse
zu lösen, musste das
Handrad
so lange im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis dieses am Anschlag war. Der
Griff konnte nun abgeklappt werden, denn während dem Betrieb wurde der Zug
nur noch mit den
Druckluftbremsen
gesichert. Der
Fahrt stand damit nichts im Weg und diese erfolgt nun vom Abstellort zum
Gleis, wo eine Fahrt als Zug beginnen soll. Dann jedoch ab dem
Steuerwagen. Wie wichtig das wirklich war, erfahren wir jedoch später,
jetzt soll losgefahren werden.
Dadurch wurden die Türen am ganzen
Zug geschlossen und blieben anschliessend verriegelt. Damit leuchtete nun
keine Lampe mehr. Für die Freigabe der Türen musste die gelbe
Meldelampe
gedrückt werden. Mit dem kleinen Griff auf der rechten Seite des Lokführers wurde die Fahrrichtung eingestellt. Dazu schob man den Griff einfach in die Richtung, in die man fahren wollte. Pfeile wiesen zudem da-raufhin, dass es sich um die Fahrrichtung handelte.
Eine
Schutzeinrichtung verhinderte, dass dieser Griff bei Fahrt um-gestellt
werden konnte. Zudem konnte ohne Wahl der Fahrrichtung auch keine
Zugkraft
aufgebaut werden. Die beiden Hebel waren daher verriegelt. Der Fahrschalter musste in der Folge ebenfalls nach vorne ge-schoben werden. Durch die eingebauten Rasten sprang dieser direkt auf die Stellung Minus und Punkt.
Für den Lokführer nicht erkennbar,
wurden im
Maschinenraum durch die Steuerung die
Trennhüpfer geschlossen.
Damit war der
Triebwagen zur Fahrt bereit und beim Beginn dieser Fahrt,
gab es bei der Schulung des Personals je nach
Depot eine etwas andere
Lösung.
Die Lösung eins sah vor, dass bei der Anfahrt, die
Rangierbremse gelöst wurde und der
Fahrschalter kurz auf ++ und danach sofort
wieder auf Punkt verbracht wurde. Dieser «Pluspluskick» wurde jedoch nicht
von allen Instruktoren in den
Depots unterstützt. Diese empfahlen dem
Personal schrittweise jede
Fahrstufe
mit kurzen Klicks auf «M» zu schalten.
Beim
Triebwagen
RBe 4/4 mochten beide Lösungen akzeptable Ergebnisse zu bringen. Bei den
Lokomotiven
der Baureihe
Re 6/6 ging das nicht immer gut.
Zudem leuchtete mit jeder Fahrstufe die mit dem Fahrschalter geschaltet wurde, die Meldelampe zum Stufenwähler. Damit war die Rückmeldung von der Steuerung vorhanden.
Sollte es eine Störung geben, leuchtete diese Lampe dauernd und
der
Trieb-wagen baute keine
Zugkraft auf.
Eine Anzeige der Stufe, war im Gegensatz zu einem
Steuerkontroller
nicht vorhanden. Die Zugkraft wurde vor dem Lokführer an einem Instrument angezeigt. Dabei war nur noch eine Anzeige für den Fahrmotorstrom vorhanden. Nötig wurde diese Lösung, weil wegen der Vielfachsteuerung bis zu zwölf Anzeigen benötigt worden wären.
Dazu
fehlten der Platz und die Übersicht bei den Anzeigen ginge verloren. Daher
war neben der Anzeige für den
Fahrmotorstrom ein weiteres
Instru-ment
vorhanden, das jedoch eine eigene Skala besass. Dieses zusätzliche Instrument wurde als Differenzstrom bezeichnet. Dort wurde der Unterschied zwischen der höchsten und der niedersten Triebachse angezeigt. Bei mehreren Triebwagen in der Vielfachsteuerung konnten dort immer wieder geringe Ausschläge erkannt werden.
Erst, als auch die
Lokomotive
Re 4/4 II eingebauten wurde, war der
Zeiger sehr schnell am oberen Anschlag und verliess diesen nicht so
schnell. Das war jedoch ebenfalls korrekt.
Mit dem
Fahrschalter und seinen Stellungen konnten die
erforderlichen
Zugkräfte eingestellt werden. Wie die Stufen bei welcher
Stellung geschaltet wurden, wusste das
Lokomotivpersonal anhand der Schulung.
Die dabei angewendeten Werte wurden bei den Anzeigen mit einer Tabelle
aufgelistet. Diese wurde lediglich benötigt, wenn langfristige Werte, wie
der Stundenstrom, oder aber die Werte für 20 und 40 Minuten bei der
elektrischen
Bremse eingehalten werden mussten.
Dabei wurde jedoch nicht jeder
Führerstand mit dem
gleichen Modell ausgerüstet. Im Führerstand eins montierte man ein Modell
mit Registrierung der Fahrdaten. Dazu war im Anzeigegerät ein spezieller
blauer Streifen vorhanden. Dieser zeichnete die Fahrdaten dauerhaft auf
und musste von Zeit zu Zeit durch eine neue Rolle ersetzt werden. Die
Handhabung dieser Streifen war Angelegenheit der Lokführer. Diese wussten
auch, wie am Ende des Tages damit verfahren werden musste.
Im
Führerstand zwei kam jedoch ein Modell zum Einbau,
dass eine Aufzeichnung des zuletzt zurückgelegten Weges hatte. Diese
Aufzeichnungen waren sehr genau und erlaubten eine Auswertung auf den
Meter genau. Da die Aufzeichnung auf einer sich drehende
Farbscheibe
erfolgte, wurden die Fahrdaten nach rund 2 000 Metern wieder gelöscht. In
diesem Modell waren zudem die von der Geschwindigkeit abhängigen
Schaltungen eingebaut worden.
Eine solche von der Geschwindigkeit abhängige Schaltung
ist auf unserer Fahrt aktiv, denn die rot leuchtende
Meldelampe konnte
noch nicht erlöschen, weil die Anzahl der
Fahrstufen und die
Geschwindigkeit noch zu gering waren. Da im
Rangierdienst selten schneller
als 30 km/h gefahren wurde, leuchtete die rote Lampe zur
Ventilation
dauernd. Wichtig war dies, wenn kontrolliert werden sollte, ob die
Glühbirne dieser Lampe noch funktioniert.
Die gefahrene Geschwindigkeit wurde über die
Zugkraft
und mit dem
Fahrschalter und den damit erzeugten
Strömen an den
Fahrmotoren geregelt. Eine Anzeige, welche Stufe eingeschaltet war, gab es
jedoch nicht mehr. Mit etwas Erfahrung, wusste das
Lokomotivpersonal jedoch,
dass bei einem bestimmten Strom das gewünschte Ergebnis erreicht werden
konnte. Reduziert wurde der Strom mit der Stellung Minus. Letztlich
öffneten sich die
Trennhüpfer mit der Stellung «0».
Angehalten wurde mit der
automatischen Bremse. Die
Rangierbremse kam nur zur Anwendung, wenn der
Triebwagen alleine
eingesetzt wurde. Kurz vor dem Halt, der nun jedoch am
Bahnsteig erfolgte,
mussten die Türen mit der gelben
Meldelampe frei gegeben werden. Damit war
der Zug nun auch den Reisenden zugänglich und der Lokführer muss in
unserem Beispiel auf den
Steuerwagen wechseln. Das konnte aussen, aber
auch durch den Zug erfolgen.
Eine
Beleuchtung erlaubte auch in der Nacht und bei Dunkelheit einen Blick auf
den
Fahrplan. Die helle Lampe, wurde jedoch nur so wenig wie möglich
eingeschaltet. Auch wenn der Triebwagen vom Steuerwagen eingeschaltet werden konnte, musste noch eine «Pendelprobe» zur Prüfung der Fernsteuerung durchgeführt werden. Diese sah vor, dass vom Steuerwagen aus mit dem Fahrschalter Zugkraft aufgebaut werden musste.
Kamen vom
Triebwagen die entsprechenden
Rückmeldungen, war die
Pendelprobe erfolg-reich abgeschlossen worden
und die
Fernsteuerung
funktionierte.
Besonders wichtig war diese Prüfung, wenn der
Pendelzug frisch formiert
wurde. Ein defektes Kabel konnte nie ausgeschlossen werden. Bei der Fahrt mit einem Zug kamen neben den beschriebenen Funktionen noch die Zugsicherung, deren Quittierschalter unter dem Fahrschalter und die Lokpfeife im Griff des Fahrschalters dazu.
Funktionen, die sich kam mehr zwischen den einzelnen
Baureihen unterschieden und daher nicht erneut erwähnt werden müssen,
jedoch gab es noch eine Funktion und dabei kommen wir zur vergessenen
Meldelampe im
Führertisch, denn die meldete sich bisher nie.
Die Rede ist von der
Meldelampe zum
Schleuderschutz. Diese wurde erst aktiviert, wenn eine
definierte Situation eintrat. Daher konnte diese lange Zeit dunkel
bleiben. Bei höheren Geschwindigkeiten waren die Meldelampen dunkel, das
galt auch für die Warnlampe der
Ventilation. Lediglich die Meldelampe für
den
Stufenwähler leuchtet bei den einzelnen Schaltungen
mit dem
Fahrschalter auf. Wenn jedoch
der Schleuderschutz aktiv wurde, blinkte dessen Lampe.
Dabei wurde ein geringer Druck in den
Bremszylindern der
Triebachsen
erzeugt. Bei sehr schlechtem Zustand der
Adhäsion
und schwerer
Anhängelast
konnte es jedoch passieren, dass dem Lokführer mit Schalter zum
Sander und der
Schleuderbremse die Hände aus-gingen. Bei kühler Witterung und wenn im Zug ein Speisewagen eignereiht war, wurde auch die Zugsheizung eingeschaltet. Dazu betätigte das Lokomotivpersonal den entsprechenden Steuerschalter. Die Rückmeldung erfolgte mit dem Leuchten der entsprechenden Melde-lampe mit einem gelben Blitz.
Diese
Zugsheizung
blieb auch eingeschaltet, wenn der Zug in einem Wendebahnhof ankam. Nur
wenn aus Erfahrung Verstärkungswagen beigestellt wurden, schaltete das
Lokomotiv-personal die
Heizung aus.
Dazu gehörte, dass grundsätzlich
die
Handbremse des
Triebwagens angezogen werden musste. Auch der
Registrierstreifen musste, wie bei den anderen Baureihen entnommen werden.
Am Schluss der Arbeit musste dieser Streifen vom letzten Lokführer des
Tages der Obrigkeit abgegeben werden.
Galten die jedes Jahr neu
eingeführten Wintermassnahmen, wurden Züge im Freien grundsätzlich
eingeschaltet remisiert. Dabei gab es beim
Triebwagen RBe 4/4 ein Problem.
Die
Ventilation lief immer und so wirkten die Massnahmen nicht so gut.
Daher musste in diesem Fall das
Lokomotivpersonal die
Lastschalter zu den
drei
Ventilatoren manuell auslösen. Die Türe zum Schrank wurde dann jedoch
zum Hinweis offengelassen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
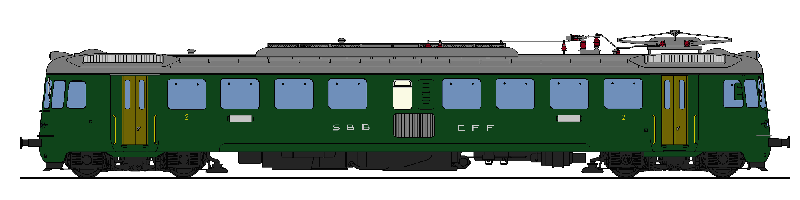 Auch
hier galt die Devise, dass zuerst die Kontrollen aussen am Fahrzeug
ausgeführt wurden. Diese opti-sche Begehung beschränkte sich jedoch beim
Auch
hier galt die Devise, dass zuerst die Kontrollen aussen am Fahrzeug
ausgeführt wurden. Diese opti-sche Begehung beschränkte sich jedoch beim
 Die
weitere
Die
weitere 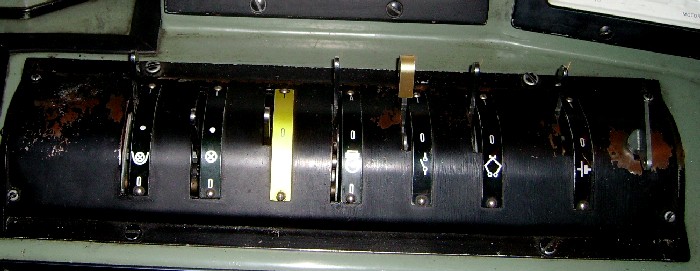 Beim Aufbau des
Beim Aufbau des
 Um
zu erkennen, ob das
Um
zu erkennen, ob das
 Dieses
Dieses
 Bevor der
Bevor der
 Bevor wir feststellen, dass der
Bevor wir feststellen, dass der
 Da nun der
Da nun der
 Im
Im
 Wollte der Lokführer
Gegenmassnahmen ergreifen, blieb ihm beim
Wollte der Lokführer
Gegenmassnahmen ergreifen, blieb ihm beim
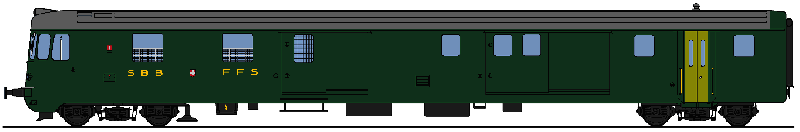 Am Schluss der Tagesleistung
wurde der
Am Schluss der Tagesleistung
wurde der