|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
| Baujahr: | 1926 - 1943 | Leistung: | 4 400 kW / 6 000 PS | |
| Gewicht: | 140 t | V. max.: | 100 km/h | |
| Normallast: | 650 t | Länge: | 20 260 mm | |
|
Was 1905 mit einem
Versuchsbetrieb
im Grossraum Zürich begann, hatte sich in nur wenigen Jahren zu einem
grossen Erfolg für die neue Technik entwickelt. Selbst die Entwickler
hatten am Anfang kaum an eine solche Entwicklung gedacht. Wollte man doch
nur die Städte von der Belastung des Rauches befreien. Dazu sah man kleine
und leichte Maschinen vor, die mit hoch gespanntem
Wechselstrom
betrieben werden sollten.
Meistens wurde bis
anhin mit
Gleichstrom
gearbeitet. Dazu war auch der Motor vorhanden. Ohne diesen konnte man kein
Fahrzeug bewegen, denn dazu brauchte man eine Bewegung. Im Gegen-satz zur
Dampfmaschine
bot der Motor bereits eine drehende Bewegung und damit konnte man die
Antriebe
anders aufbauen, was neue Fahrzeuge erlaubte. Leichte
Motorwagen
halfen den meist kleinen Bahnen, welche die neue Technik nutzten.
Die Netze hatten
jedoch den Nachteil, dass die
Spannung
nicht verändert werden konnte. Zudem waren auch die anfänglich verwendeten
Werte für grössere Strecken nicht geeignet. Grosse Anlagen, wie jene der
FS, mussten mit Spannungen von bis zu 3000
Volt
arbeiten um letztlich noch Werte von lediglich 1500 Volt in der
Fahrleitung
zu haben. Steile
Bergbahnen,
wie jene in der Schweiz, waren damit kaum zu bewältigen, weil der
Spannungsabfall zu gross war.
Alternativ dazu gab
es den
Drehstrom.
Die sehr robusten und einfachen Motoren bei diesem System machten das
System lukrativ. Der
Drehstrommotor
bestach durch seine einfache Bauweise. Nutzte man die zur
Frequenz
passende Drehzahl, fuhr der Zug dieses Tempo egal, was für Neigungen
vorhanden waren. Selbst der Wechsel zum
Generator
schaffte dieser Motor ohne grosse Probleme. Etwas besseres sollte es nicht
mehr geben.
Insbesondere Italien
und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten umfangreichere Anlagen.
Wobei der Schwerpunkt des schweizerischen Netzes auf dem fast 20 Kilometer
langen Simplon-tunnel lag. So kam es, dass vielerorts Dampflokomotiven verwendet wurden. Kohle war billig bei der Beschaffung und die Maschinen hatten aus-gesprochen hohe Zugkräfte.
Ergänzt wurde dies
mit den vielen Fabriken, die auch über das not-wendige Fachwissen
verfügten. Dank dieser Vielfalt entwickelten sich die
Lokomotiven immer mehr und sie wurden dadurch besser und
konnten mehr
Leistung
erbringen. Etwas, was in den Steigungen von Vorteil war. Das passte bei den vielen Bahnen in Europa und insbesondere die Gotthardbahn zeigte seit der Eröffnung deutlich, was mit den grossen Dampflokomotiven in Steigungen ausgerichtet werden kann. Jedoch zeigte gerade diese Bahngesellschaft, dass es auch mit dieser Traktionsform durchaus Probleme geben kann. Wobei damals das grösste davon schlicht noch nicht so bekannt war. Doch sehen wir uns die Schwierigkeiten an.
Lange
Tunnel,
wie jener am Gotthard, bekamen Probleme mit dem Rauch und dem Dampf. Der
Scheiteltunnel
füllte sich daher schnell mit dem Gemisch und so wurde die Sicht
behindert. Ohne ausreichende Sicht auf die Signale konnte aber kein
Betrieb geführt werden. Nicht zu bedenken, wenn man damals noch die
Probleme mit dem
Kohlenmonoxyd
einberechnet hätte. Personal, das unter Hustenreiz litt, waren aber
Anzeichen dafür.
So sollte die Sicht
im
Tunnel
zusätzlich verbessert werden. Doch es blieb immer noch ein Faktor, der
auch von der besten Ge-sellschaft nicht beeinflusst werden konnte. Es
waren die Alpen und das damit verbundene Wetter. Das Wetter hatte grosse Auswirkungen. Bei gewissen Wetter-lagen blieb die Luft im Tunnel stehen. Die hohe Luftfeuchtigkeit bewirkte, dass sich der Dampf schlecht auflöste. In diesem Fall musste der Tunnel gesperrt werden.
Künstliche
Belüftungen waren die Folge. Viel Aufwand für einen Betrieb, der
ausgesprochen gefährlich war, doch damals war man sich der grossen Gefahr
mit dem
Kohlenmonoxyd
noch nicht so bewusst. Unter diesen Voraussetzungen wurde die Bahn zwischen Fru-tigen und Brig in Angriff genommen. Hauptteil war der Schei-teltunnel mit seinen rund 13 Kilometer Länge.
Noch wusste man
nicht, dass er noch etwas länger werden würde. Mehr Sorgen machte sich die
Gesellschaft um den Betrieb. Wegen den Problemen am Gotthard sah man eine
künstliche Belüftung vor. Doch mit den Erfolgen in Seebach, boten sich
neue Lösungen.
Es war die junge
Lötschbergbahn, die sich entschloss neue Wege zu gehen. Die Versuche in
der Nähe von Zürich zeigten Erfolge, so dass man sich bei der BLS für den
Wechselstrom
entschied. Eine zweite
Versuchsstrecke
sollte daher geschaffen werden. 1910 konnte die
Fahrleitung
zwischen Spiez und Frutigen in Betrieb genommen werden. Der
Tunnel
Hondrich war dabei einer der ersten, der mit Wechselstrom befahren wurde.
Der Weg für das neue
System war nun frei. Mit dem Hondrichtunnel war nun auch das Problem
gelöst worden. Die junge Gesellschaft be-nötigte nun die
Lokomotiven und da hatte man keine grosse Auswahl.
Die bei der Eröffnung
der Lötschbergbahn beschafften 13 Maschinen der Baureihe
Fb 5/7 hatten anfänglich noch mechanische Probleme.
Die Konstrukteure mussten sich an die neuen
Zugkräfte
der 2500 PS starken
Lokomotive gewöhnen. Diese mussten mit massiven
Verstärkungen gebändigt werden. Jedoch haben wir erfahren, dass in diesem
Punkt die
Dampfmaschine
sehr gut war. Warum denn die grossen Probleme mit dem
Antrieb?
Auch wenn der
elektrische Motor bei der wichtigen
Anfahrzugkraft
nicht mit der
Dampfmaschine
mithalten sollte, war er überlegen. Bei der Ausnützung der Kräfte war er
der Dampfmaschine ebenbürtig, jedoch bei der erzeugten
Leistung
deutlich überlegen. Einsparungen beim Gewicht führten letztlich zu den
Problemen. Die Baureihe
Fb 5/7 wurde mit den Anpassungen um zwei Tonnen
schwerer, was die
Achslast
noch mehr erhöhte.
Mit der Lösung beim
Antrieb
hatte sich die Maschinen im täglichen Betrieb bewährt und zeigten deutlich
den Vorteil der elektrischen Traktion auf. Ähnliche Anlagen kamen in der
Zeit auch in Deutschland vor. Wobei dort nicht so gewaltige Steigungen
gemeistert werden mussten. Doch so richtig sollte sich der Erfolg nicht
einstellen, da musste ein anderes tragisches Ereignis helfen. Der erste
Weltkrieg mit seinen verheerenden Auswirkungen brachte den Durchbruch.
Sie müssen bedenken,
dass bei einer Fahrt der Brenn-stoff mehr kostete, als das Personal auf
der
Lokomo-tive in einem Jahr ver-diente. Lange konnte das
nicht gutgehen und viele kleinere noch verbliebene Gesellschaften konnten
den Betrieb nicht mehr ausführen. Die Folge war der Bankrott.
Ein Szenario, das
auch der jungen Gesellschaft am Lötschberg hätte passieren können.
Dampflokomotiven besass man auch und das führte dazu, dass sich die Bahnen
um die BLS-Gruppe
zusammenschlossen. Wo es ging, wurden die konkursiten Gesellschaften in
die
Staatsbahnen
überführt. Zum Teil verschwanden Strecken von der Bildfläche. Kaum
Probleme bekundeten wirklich nur jene Unternehmen, die mit
Strom
fuhren.
Die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB hatten während dem Krieg jedoch das grösste Problem zu
lösen. Am Gotthard lief der Verkehr befriedigend. Mit den teuren
Kohlen
konnten die Züge jedoch nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Die
Folge davon war, dass man, wo es ging zu heimischem
Holz
griff und den Betrieb zum Teil einstellte. Für eine
Staatsbahn war das natürlich gar nicht gut,
denn sie hatte eine klare Vorgabe zu erfüllen.
So schwanden die Abneigungen
gegen den
Wechselstrom bei den
Staatsbahnen. Der Entscheid brachte dann
den grossen Durchbruch, denn nun ging es in der Schweiz rasend schnell.
Doch der Beginn war der Gotthard, weil dort der Verbrauch bei der
Kohle
mit Abstand am grössten war. Klar, es gab andere Strecken mit steilen
Abschnitten, aber zusammen mit dem Verkehr, war der Gotthard in diesem
Punkt schlicht nicht zu übertreffen.
Die ersten
Lokomotiven
für
die
Staatsbahnen mussten daher um 1917 die gleichen Bedingungen erfüllten,
wie die Maschinen der BLS. So kam es, dass die Modelle für die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf den Erfahrungen mit der Reihe
Fb 5/7
aufbauten. Nur ging man jetzt noch einen Schritt weiter und die
Zugkraft
wurde noch etwas gesteigert. In der Folge sollte die neue Lokomotive für
Güterzüge über eine zusätzliche
Triebachse verfügen.
Mit der Antwort der
Maschinenfabrik Oerlikon MFO kam eine aus der Reihe
Fb 5/7
entwickelte
Lokomotive. Diese wurde anfänglich noch als Baureihe
Fc 2x 3/4 geführt.
Mit der Umstellung der Bezeichnungen gab das letztlich die Reihe
Ce
6/8 II. Wir kennen die Lokomotiven heute unter dem Begriff «Krokodil». Was sie
so erfolgreich machte, war die hohe
Zugkraft und die Neuerung, die es
bisher noch nicht gab, die elektrische
Nutzstrombremse.
Vor der Industrie
vorgeschlagen, kam sie zum Einbau, weil gerade die
Lokomotive
der
BLS-Gruppe zeigte, dass Talfahrten ohne diese
Bremse durchaus gefährlich
werden konnten. Daher wurden die Vorschriften geändert und die Modelle für
die
Staatsbahnen in der letzten Sekunde noch angepasst. Das brachte
betrieblich einen grossen Vorteil. Doch noch mehr schätzte man natürlich
die gesteigerte
Leistung
der neuen Lokomotive.
Die im
Güterverkehr
verwendete Reihe
Ce
6/8 II
war einfach etwas besser, als die älteren
Maschinen der BLS. Die Entwicklungsschritte damals waren enorm, brachten
die Erfahrungen doch immer bessere
Lokomotiven
hervor. Doch viel wichtiger
war, dass die neue Technik den Betrieb so richtig in Schwung brachte. Die
Züge wurden schwerer. Doch auch die
Zugvorrichtungen machten einen Schritt
weiter. Die Folge davon waren die höheren
Zughakenlasten.
So war die Reihe
Be 5/7 den
Güterzügen kaum mehr
gewachsen. In der Steig-ung wurden zwei Stück benötigt. Selbst bei
Reisezügen kamen oft auch zwei Modelle an den Zug. Das beanspruchte die
kleine Serie zusätzlich und die Re-serven schwanden. Jedoch gab es auch ein Problem. Die zusätzlichen Lokomotiven mussten wieder ins Tal, was auf der einspurigen Strecke nicht leicht war. Grösser war jedoch das Problem, dass man einen ausreichend schweren Zug benötigte.
Wegen der fehlenden
elektrischen
Bremse durfte die
Be 5/7 die Talfahrt nicht alleine antreten.
Beliess man die zweite
Lokomotive
am Zug, fehlte sie, denn dazu hatte man
zu wenig Maschinen im Bestand.
Ein Problem, das nicht so
leicht gelöst werden konnte. Die für die
Dekrets-bahnen beschafften
Maschinen der Baureihe
Ce 4/6 waren willkommene Ent-lastungen im
bescheidenen Fahrzeugpark. Diese für Nebenbahnen entwickelten
Lokomotiven
vermochte nicht die notwendige Entlastung bei der BLS zu bringen. Zu
bescheiden war die
Zugkraft. Wenn man diese Maschinen von den
Bahnlinien
abzog, fehlten sie dort und das war auch nicht die Lösung.
Es fehlte einfach an allen
Ecken und Enden an
Lokomotiven. Alles in allem war klar, die BLS-Gruppe
musste sich um neue Lokomotiven für die
Bergstrecke bemühen, wollte man
nicht Züge an den Gotthard verlieren. Die BLS benötigte somit bereits die
zweite Generation von leistungsfähigen Maschinen. Während andere Bahnen in
Europa erst richtig mit elektrischen Lokomotiven fuhren. Nur die neue
Maschine musste viel leisten können.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
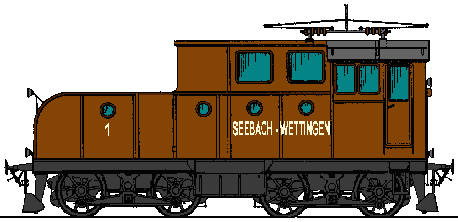 Der
Der
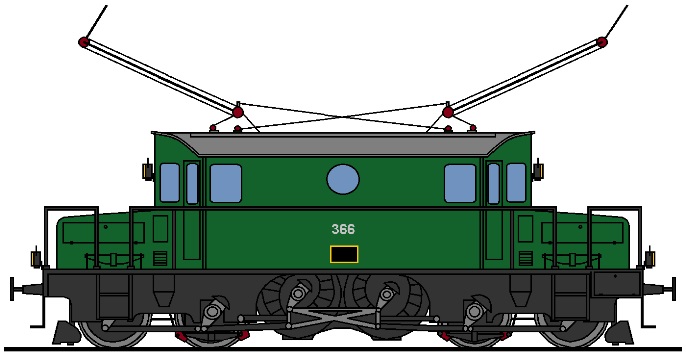 Jedoch
stand diesem guten Motor die komplizierte und sehr auf-wändige
Jedoch
stand diesem guten Motor die komplizierte und sehr auf-wändige
 Anweisungen
an das Personal und harte Strafen bei Verstössen dagegen sollten die
Probleme mit dem Rauch etwas mildern. Die
Anweisungen
an das Personal und harte Strafen bei Verstössen dagegen sollten die
Probleme mit dem Rauch etwas mildern. Die
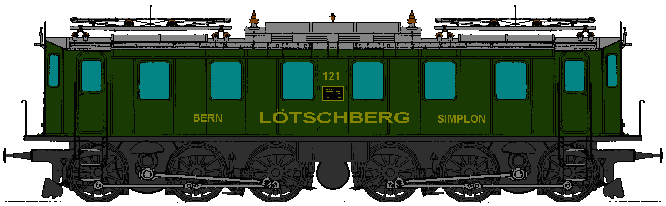 Mit
weiteren Versuchen sollten nun die
Mit
weiteren Versuchen sollten nun die
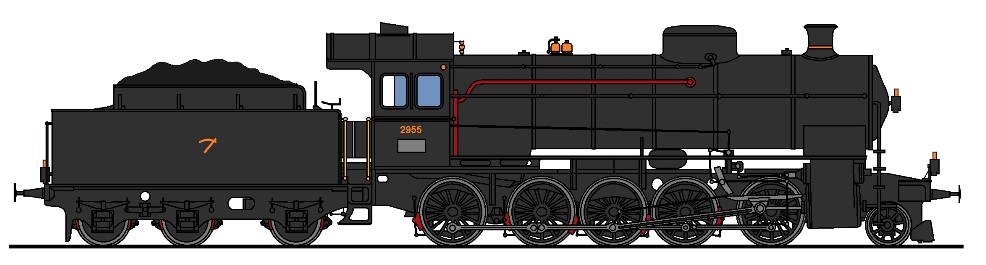 Durch
die knappen Vorräte bei den
Durch
die knappen Vorräte bei den

 Es waren immer mehr Züge am
Lötschberg zu befördern und die vorhandene Anzahl
Es waren immer mehr Züge am
Lötschberg zu befördern und die vorhandene Anzahl