|
Entwicklung und Beschaffung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Die BLS benötigte
neue und bessere
Lokomotiven. Daher war es wichtig, dass man sich die
Beschaffung gut überlegte, denn einen Fehler durfte man sich diesmal nicht
erlauben, denn man hatte ja ausreichend Erfahrung. Bei der Reihe
Be 5/7
mussten sämtliche Maschinen nachgebessert werden, weil man damals aus
Zeitnot auf die Beschaffung von
Prototypen
verzichtet hatte. Es eilte auch jetzt, aber diesmal wurde vom Besteller
ein umfangreiches
Pflichtenheft
verfasst.
Grundsätzlich sollte
die neue
Lokomotive alleine die
Zughakenlast
befördern können. Die ersten
Ce
6/8 II
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB konnten bereits 450 Tonnen die
Rampen
hochziehen. Da die Zughakenlast am Lötschberg neu jedoch auf 510 Tonnen
festgelegt wurde, war klar, die neue Maschine musste etwas mehr ziehen
können, als die Lokomotive der
Staatsbahnen.
Ein Schritt der technisch durchaus möglich erschien.
Der von den
Dampflokomotiven übernommene
Stangenantrieb
der Baureihe
Be 5/7
vermochte zu Beginn des Einsatzes nicht zu überzeugen. Die BLS kämpfte
anfänglich mit verbogenen
Triebstangen
und musste massive und schwere Teile anbringen. Das wirkte sich nicht nur
positiv auf die Laufruhe der
Lokomotive aus. Bei einer neuen Maschine, die noch
grössere
Anhängelasten
schleppen musste, hätte sich das Problem womöglich erneut gezeigt. Dabei muss man aber wissen, dass die Entwicklung dieser Lokomotive noch ohne ausreichende Erfahrungen der Maschinen der Staatsbahnen erfolgen musste. Erst die ersten Modelle der Reihe Ce 6/8 II konnten erkennen lassen, dass der Antrieb mit Triebstangen durchaus erfolgreich verwendet werden konnte. Andererseits zeigte der Winterthurer Schrägstangenantrieb geometrische Fehler auf. Die BLS vertraute daher kaum mehr dieser Technik.
Die am Gotthard
eingesetzten
Lokomotiven hatten ebenfalls den
Stangenantrieb
erhalten. Jedoch waren die neusten Modelle der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB mit einem neuartigen
Antrieb,
der auf jede
Triebachse
einzeln wirkte, ausgerüstet worden. Die schweren
Triebstangen
waren vergessen. Hinzu kam, dass die ersten Erfahrungen mit der Baureihe
Be 4/7
recht zuversichtlich waren und man sich so auch bei der BLS an einer
solchen Lösung erfreuen konnte.
Das bedeute somit,
dass man eine Maschine beschaffen musste, die hauptsächlich für den
Güterverkehr
vorgesehen war. Die
Lokomotiven
Ce
6/8 II der schweizerischen Bun-desbahnen SBB
zeigten, dass solche Modelle mit sechs
Triebachsen
versehen waren.
Grundsätzlich hätten
sich die Verantwortlichen der BLS-Gruppe
auch an der von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgearbeiteten Reihe
Ce
6/8 III
erfreuen können. Jedoch waren diese
Lokomotiven mit 65 km/h zu wenig schnell und die Technik
mit
Triebstangen
auch schon veraltet. Daher war klar, man musste in Spiez ein eigenes
Pflichtenheft
für eine neue Maschine erstellen. So war sicher, dass man eine passende
Lokomotive geliefert bekommen würde.
Ein Blick in das für
diese
Lokomotive ausgearbeitete
Pflichtenheft
lohnt sich daher sicherlich. Es lohnt sich aber auch, wenn man diese
Maschine direkt mit den neusten Modellen der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB vergleicht. So kann deutlich der Unterschied zwischen dem bewährten
Stangenantrieb
(Ce
6/8 III) und einem modernen
Einzelachsantrieb
aufgezeigt werden. Blicken wir nun in das Pflichtenheft der BLS-Gruppe.
Grundsätzlich
erwartete die BLS eine elektrische
Lokomotive mit
Einzelachsantrieb
und sechs
Triebachsen.
Diese sollten, wie bei der Reihe
Ce
6/8 III
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB in zwei
Drehgestellen
eingebaut werden. Die
Be 5/7
zeigten deutlich, dass zu lange, fest in einem Rahmen gelagerte
Fahrwerke
für die engen
Kurven
einer Gebirgsbahn ungeeignet waren. Daher blieb bei sechs Triebachsen nur
noch die Lösung mit Drehgestellen übrig.
Erst die mit
Laufachsen
verlängerte Baureihe Ce
6/8 I der Schweizeri-schen Bundesbahnen SBB konnte bessere Ergebnisse
erzielen. Damit war schnell klar, dass die neue Reihe der BLS über die
Achsfolge
6/8 oder (1‘Co) (Co‘1) verfügen sollte.
Die
Leistung
der
Lokomotive sollte ausreichen um einen
Güterzug
mit 510 Tonnen Gewicht auf den Steigungen von 27 ‰ mit einer
Geschwindigkeit von 50 km/h zu befördern. Hier war die neue
Ce
6/8 III
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit 520 auf 26 ‰ etwas höher als die
Maschine der BLS. Das bedeutete, dass beide Lokomotiven auf die damals
zulässige
Zughakenlast
der jeweiligen Strecke ausgelegt wurden.
Besonders die
Vorgaben der Geschwindigkeit überraschten. 50 km/h für
Güterzüge
war schon recht hoch. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB begnügten sich
bei der
Ce
6/8 III mit den üblichen 35 km/h. Hier waren die
unterschiedlichen Strecken massgebend, denn während man am Gotthard zwei
Geleise
hatte, mussten die Züge auf der einspurigen BLS schnell einen
Kreuzungsbahnhof
erreichen und sollten daher die Strecke so kurz wie nur möglich belegen.
Damit man diese
Geschwindigkeit mit der geforderten
Anhängelast
auch erreichen konnte, errechnete man bei der BLS in Spiez für die neue
Lokomotive eine ungefähre
Leistung
von 4 500 PS. Im Vergleich dazu war die Leistung der
Ce
6/8 III
mit ungefähr 2 500 PS wesentlich tiefer. Bei Lokomotiven mit
Stangenantrieb
ging man davon aus, dass bei 2 500 PS die maximal mögliche Leistung dieses
Antriebes
erreicht war. Das zeigten insbesondere die Reihe
Be 5/7
der BLS deutlich.
Die
Höchstgeschwindigkeit
der neuen
Lokomotive sollte auf gleicher Höhe liegen, wie bei der
Reihe
Be 5/7.
Das bedeutete, dass auch diese Lokomotive für
Güterzüge
mit bis zu 75 km/h verkehren sollte. Die
Ce
6/8 III
der SBB musste in diesem Punkt zurückstecken. Jedoch war die Wahl der
Höchstgeschwindigkeit nicht so bedeutend, denn die Reihe
Ce
6/8 III
wurde später ohne Umbau zu
Ce
6/8 III
75 und konnte auch 75 km/h fahren.
Bei der
Lokomotive der BLS-Gruppe
ergab das nun die fertige Bezeichnung Be 6/8. Somit wurde die Maschine
damals innerhalb der Schweiz zur schnellsten Lokomotive mit sechs
Triebachsen.
Wenn man von den gigantischen Doppellokomotiven bei der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB und bei der BLS absieht, wurde dieser Wert erst mit der
Reihe Ae 6/6
für die
Staatsbahnen
übertroffen. Genau genommen war das rund 30 Jahre später.
Daneben wurden noch
einige Punkte zur Ausrüstung der
Lokomotive vorgesehen. Diese lassen wir hier jedoch weg.
Für uns sind nun die wichtigsten Vorgaben vorhanden. Dabei konnten wir
erkennen, dass die Reihe Be 6/8 der BLS über eine wesentlich grössere
Leistung
verfügte, jedoch nicht unbedingt grössere Lasten ziehen konnte. Die
Leistung hatte deshalb ganz klar zur Folge, dass die Be 6/8 mit diesen
Lasten etwas schneller verkehren konnte.
Verständlicherweise
waren die eingereichten Angebote für diese
Lokomotive relativ bescheiden. Dabei kam
letztlich eine Eingabe der Firma Société Ano-nym des Ateliers de Sécheron
(SAAS) zum Zug. Dabei trat der Elektriker aus Genève als Generalunternehmer auf. Die BLS konnte sich so einfach mit der SAAS verständigen und musste nicht noch zusätzliche Angaben für den Mechaniker vornehmen.
Da Sécheron jedoch
ein Elektriker war, wurde der mechanische Teil der
Lokomotiven einem Subunternehmer übergeben. Daher
hatte die BLS im Ge-gensatz zur Reihe
Be 5/7,
welche bei SLM und MFO bestellt wurde, nun eine Bestellung bei der SAAS
vorgenommen. Die mechanischen Arbeiten für die neue Lokomotive wurden daher nicht in Genève ausgeführt, sondern an einen Lieferanten vergeben. Diese Arbeiten wurden von Sécheron der Firma SA Ernesto Breda in Mailand übertragen.
Das führte letztlich
dazu, dass diese Maschinen später als Breda-Lokomotiven
bezeichnet wurden. Die elektrische Ausrüstung, die
Antriebe
und die End-montage wurden jedoch in Genève und somit in der Schweiz
ausgeführt.
Speziell war, dass
zum Beispiel die Schweizerischen Bundesbahnen SBB, diesen Auftrag so nicht
hätten vergeben können. Die
Staatsbahnen
waren auf Grund ihrer Organisation dazu verpflichtet, ihre
Lokomotiven bei Herstellern in der Schweiz zu
bestellen. Diese Beschränkung galt jedoch für die kantonal bestimmte BLS-Gruppe
nicht, so dass erstmals der mechanische Teil für eine elektrische
Lokomotive dieser beiden Bahnen im Ausland gebaut wurde.
Die BLS-Gruppe
bestellte bei der SAAS in Genève von dieser
Lokomotive vorerst zwei Exemplare. Diese beiden
Maschinen sollten die Nummern 201 und 202 erhalten und so eine komplett
neue Nummerngruppe bilden. Diese Lieferung wurde kurz darauf mit den
Lokomotiven und den Nummer 203 und 204 um weitere zwei Lokomotiven
erweitert. So gelangten innerhalb von wenigen Jahren vier Maschinen dieser
Bauart
nach Spiez. |
|||||||||||
|
Be 6/8 Nr. 201 -
204 |
|||||||||||
 |
|||||||||||
|
Baujahr: |
1926 und 1929 |
Leistung: |
3 309 kW / 4 500 PS |
||||||||
|
Gewicht: |
142 t |
V. max.: |
75 km/h |
||||||||
|
Normallast |
510 t bei 50 km/h |
Länge: |
20 260 mm |
||||||||
|
Nachdem die ersten
vier
Lokomotiven erfolgreich verkehrten, sah sich die
BLS-Gruppe
einige Jahre später gezwungen für den gewachsenen
Güterverkehr
weitere Maschinen zu beschaffen. Dabei griff man bei der BLS-Gruppe wieder
auf diese
Bauart
und den bekannten Hersteller SAAS zurück. Dabei wurden zwar auch die neuen
Einzelachsantriebe
der
Staatsbahnen
geprüft, aber um die Anzahl der Ersatzteile zu reduzieren blieb man beim
Modell der SAAS.
Das
Pflichtenheft
der
Lokomotive wurde dabei nur leicht überarbeitet
und hatte als wichtigste Punkte eine leicht erhöhte
Leistung
und eine wesentlich höhere
Höchstgeschwindigkeit
enthalten. Diese wurde benötigt, weil die Maschinen auch mit den
Schnellzügen
auf der Strecke von Thun nach Bern verkehren sollten. Dort war mit 75 km/h
kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Daher musste auch die BLS schneller
werden.
Die zur Verfügung
stehende
Zugkraft
war nur unwesentlich höher, so dass dieses Modell nicht grössere
Normallasten
zugestanden bekamen. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass die
Zughakenlast
mittlerweile auf über 700 Tonnen gesteigert wurde. Diese Lasten konnten
damals jedoch nur von gigantischen
Lokomotiven, wie der Reihe
Ae 8/14 erbracht
werden. Das Modell war für die BLS schlicht zu gross und daher blieb man
bescheiden.
Weil es jedoch
zwischen den beiden Bestellungen ein Unterschied von zehn Jahren gab,
waren die gemachten Erfahrungen eingeflossen. Die technischen Unterschiede
der
Lokomotive waren jedoch nicht so gross, wie man
anhand der Bezeichnung meinen könnte. Diese vier Maschinen sollten neu als
Baureihe Ae 6/8 und nicht mehr als Reihe Be 6/8 bezeichnet werden. Die
Nummern für diese vier Maschinen lauteten 205 bis 208.
|
|||||||||||
|
Ae 6/8 Nr. 205 -
208 |
|||||||||||
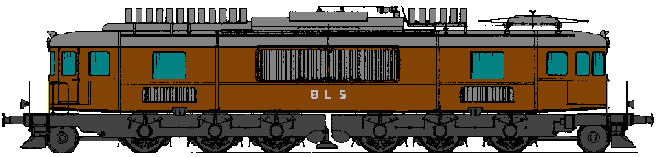 |
|||||||||||
|
Baujahr: |
1939 - 1943 |
Leistung: |
3 882 kW / 5 280 PS |
||||||||
|
Gewicht: |
142 t |
V. max.: |
90 km/h |
||||||||
|
Normallast |
510 t bei 56 km/h |
Länge: |
20 260 mm |
||||||||
|
Bei diesen
Lokomotiven gab es auch mechanische
Veränderungen. So wurde ein geänderter
Führerstand
eingebaut und für den mechanischen Teil ein neuer Lieferant benannt. Diese
Maschinen wurden mechanisch bei der Schweizerischen Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM gebaut. Wieder trat die SAAS in Genève gegenüber dem
Besteller als Generalunternehmer auf, nur dass nun alle Komponenten in der
Schweiz gebaut wurden.
Damit können wir zur
Betrachtung des mechanischen Teils der neuen
Lokomotive schreiten. Die oft markanten
Unterschiede der beiden
Bauarten
werde ich in den entsprechenden Punkten aufführen, so dass Sie beide
Baureihen parallel kennen lernen werden. Daher willkommen in der Welt der
Be 6/8, oder doch Ae 6/8? Letztlich war es nach mehreren Umbauten klar,
aber nun soll zwischen Be und Ae unterschieden werden.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||

 Das
bedeute, dass man sich in Spiez zuerst um ein Trak-tionskonzept bemühen
musste. Die neue
Das
bedeute, dass man sich in Spiez zuerst um ein Trak-tionskonzept bemühen
musste. Die neue
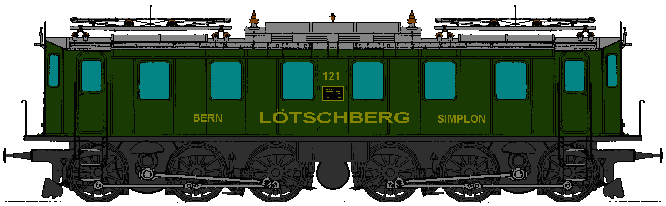 Um
die Laufruhe der
Um
die Laufruhe der
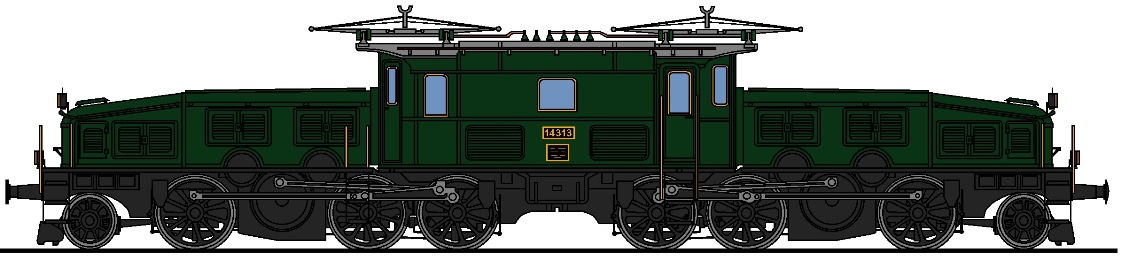
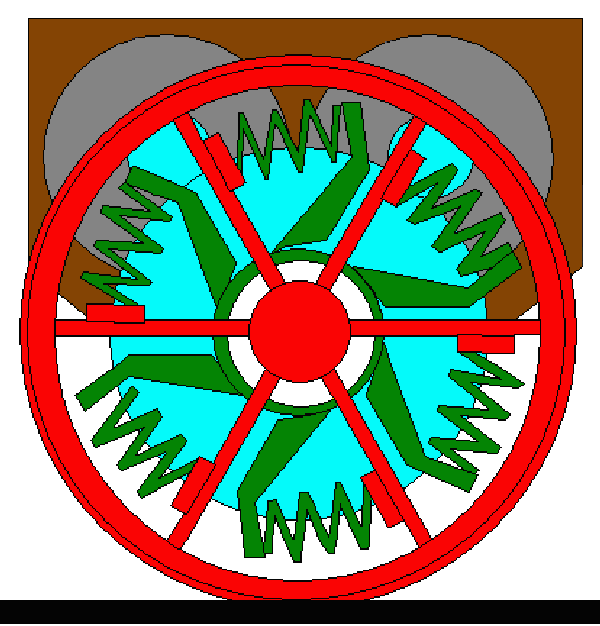 Das
so ausgearbeitete
Das
so ausgearbeitete