|
Änderungen und Umbauten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Um es vorweg zu nehmen, die Baureihe Ae 4/6 als gelungenen Wurf zu
bezeichnen wäre sicherlich falsch. Dazu beigetragen hat auch, dass in
vielen Bereichen Neuland betreten wurde. Hinzu kam, dass man wegen dem
zweiten Weltkrieg die Rohstoffe suchen musste und dadurch immer wieder zu
minderwertigen Lösungen gegriffen werden musste. Trotz grossen Bemühungen
gelang es jedoch nie die grosse
Leistung
über mehrere Jahre hinweg zuverlässig zu erbringen.
Hier können wir sowohl dem Rahmen, als auch dem Kasten ein gutes
Zeugnis aussprechen, denn diese Bereiche blieben bis zum Schluss mit
Ausnahme der verschlossenen Türen nahezu unverändert. Auch die Reduktion
der Klappen zu den
Sandern
lag nicht am Kasten.
Beim
Laufwerk
ist es schon schlimmer. Die Laufeigenschaften der ersten Maschinen waren
so schlecht, dass noch während dem Bau das Laufwerk verändert wurde.
Gründe für die schlechten Laufeigenschaften, fanden sich entweder im
kurzen festen Radstand oder in den speziellen
Drehgestellen mit dem langen Radstand. Diese
Mängel führten bei hohen Geschwindigkeiten zu Schlingerbewegungen, die
nicht nur unangenehm waren, sondern das Risiko einer
Entgleisung
erhöhten.
So war klar, dass die
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h nie erreicht werden sollte. Man musste die Maschinen
notgedrungen auf 100 km/h beschränken. Das war natürlich nicht gut, da so
die Ae 3/6 I die einzige
Lokomotive
blieb, die schneller als 100 km/h fuhr. Gegen die Erhöhung auf diesen Wert
sprach bei der Maschine, dass sie mit den
Triebachsen
grosse Probleme hatte und diese nahmen mit der Erhöhung der
Geschwindigkeit zu.
Ab 1955 durften die etwas stabiler laufenden Maschinen mit den
Nummern 10 807 bis 10 812 etwas schneller fahren. Ihnen wurde nun eine
Geschwindigkeit von 110 km/h zugestanden. Wobei die
Weichen
blieben dabei auf 100 km/h beschränkt. Bei einem angespannten
Fahrplan
war das
Lokomotivpersonal,
aber auch die elektrische Ausrüstung der
Lokomotive,
gefordert. Besonders dann, wenn sich die
Stationen
sehr dicht folgten.
Gerade bei den
Java-Drehgestellen drückte die
Lokomotive
die
Triebachse
so zurück, dass die Auslenkung alleine von der
Laufachse
übernommen wurde. Sie können sich in etwa vorstellen, was in einer engen
Kurve
für Kräfte entstanden. Die Lokomotive, die sich sehr darum bemühte die Kurven gerade zu biegen, konnte so nie für die Zugreihe R zugelassen werden. Im Gegenteil besonders enge Kurven mussten im Betrieb gemieden werden.
Massnahmen, die verhindern sollten, dass die
Achsen
brachen. Trotzdem sollten die
Loko-motiven
der Baureihe Ae 4/6 während des ganzen Betriebseinsatzes mit gebrochenen
Trieb-achsen
kämpfen müssen. Ein Vorfall, der nur mit
Hilfswagen
behoben werden konnte.
Wie stark die
Achsen
der
Lokomotive
belastet wurden, zeigt die Tatsache, dass diese regel-mässig mit
Ultraschall untersucht werden mussten. Die Kräfte, die auf die
Triebachsen
wirkten waren extrem hoch, so dass diese zu Brüchen neigten. Es entstanden
immer wieder Kräfte, die in der Achse Torsionskräfte erzeugten. Dazu waren
diese jedoch nicht ausgelegt worden. Selbst die
Achslager
wurden dadurch vernichtet. Die Ursache lag dabei nicht nur bei den Beanspruchungen im Gleis, sondern auch im Adhä-sionsverhalten der Lokomotive. Die hohe Leistung konnte zwar bei schönem Wetter noch recht gut auf die Schienen gebracht werden.
Die Entlastung der vordersten
Triebachse
reduzierte deren
Zugkraft
auch mit dem
Adhäsions-vermehrer
jedoch massiv. Das zeigte sich vor allem bei nasser Witterung. Hier neigte
die
Lokomotive
sehr schnell zum Schleudern.
Abhilfe brachte zwar der Sand, der vor jedes
Rad
geworfen werden konnte, aber befriedigend war das sicherlich nicht. Die
ausrutschenden und wieder greifenden Räder verursachten zusätzliche
Torsionskräfte in den
Triebachsen.
Schliesslich griffen nie beide Seite genau gleich. Die Baureihe Ae 4/6
wurde daher zu einer
Lokomotive,
die ihrer Triebachsen nichts Gutes wollte. Der Begriff Schienenmörder trug
sie daher zu recht.
Die
Normallast
musste daher reduziert werden. Diese deutliche Reduktion schonte die
Triebachsen
etwas, aber betrieblich war das eine Katastrophe. Wo eine Maschine geplant
war, benötigte man zwei Stück. Dem
Laufwerk
kann so kein gutes Zeugnis ausgestellt werden, denn eigentlich erfüllte
die Maschine hier keinen einzigen Punkt im
Pflichtenheft.
Schlimmer noch, sie war ein potentielles Sicherheitsrisiko, das heute
vermutlich nicht mehr fahren würde.
In der Folge liefen die
Zahnräder
nicht mehr korrekt und die Teilung stimmte nicht mehr. Man konnte
regelrecht hören, wie Metall abgetragen wurde und der Lärm zunahm. Die Lokomotiven fielen durch den grossen Lärm auf und mussten regelmässig in die Hauptwerkstätte um die Getriebe wieder zu richten und die Zähne zu erneuern. Das erhöhte die Kosten für den Unterhalt bei dieser Baureihe extrem.
Keine Maschine mit dem
SLM-Universalantrieb
sollte daher zu einem grossen Erfolg für den Konstrukteur werden. Böse
Zungen behaupteten, dass der Uni-versalantrieb den Namen von der
universellen Lärmbelästigung kommen wür-de. Farben und Anschriften unterliegen einem Zeitgeist. Hier waren die Lokomo-tiven recht beharrlich, denn eine grosse Änderung beim Anstrich und der Farbe gab es nicht.
Es wurden zwar kleinere Anpassungen vorgenommen, aber auch hier
muss gesagt werden, dass die Baureihe Ae 4/6 eine der wenigen Maschinen
war, die zeit ihres Lebens mit ein und derselben Farbgebung eingesetzt
wurden. Nur die Nummer am Umlaufblech verschwand.
Die pneumatische Einrichtung mit dem
Kompressor
und den
Bremsen
war hingegen ein voller Erfolg. Die Anlage funktionierte und das neue
Lst 1
sollte zum
Steuerventil
vieler
Lokomotiven
werden. Die Innovationen, die hier während dem zweiten Weltkrieg umgesetzt
wurden, waren schlicht grossartig. Wer hier einen Fehler suchen will, der
sucht lange und findet ihn eigentlich nur bei den
Bremsklötzen,
die nicht geteilt ausgeführt wurden.
Die mechanischen Veränderungen zeigen klar auf, dass die
Lokomotive
Mängel hatte. Diese gab es auch im elektrischen Teil, wo aber die wegen
dem Mangel an Rohstoffen verwendeten Materialien nicht genügten. Dazu
gehörten in erster Linie im
Transformator
die
Wicklungen
aus Aluminium. Diese mussten ersetzt werden, wodurch die Lokomotive
schwerer wurde. Der Umbau fand im Jahre 1953 statt und stellte somit den
einzigen schweren Mangel dar.
Elektrisch funktionierte die
Lokomotive
einwandfrei und kaum jemand beklagte sich über elektrische Störungen. Der
neue
Stufenschalter
musste dabei wirklich ein beängstigendes Programm absolvieren. Besonders
bei jenen Lokomotiven, die mit 110 km/h verkehren durften, stand er kaum
still. Jedoch lief er zuverlässig, so dass man diesen auch bei den
nachfolgenden Maschinen der Baureihen
Ae 6/6,
RBe 4/4, sowie
Re 4/4
II verwendete.
Die Shunts zu den
Fahrmotoren
gingen bei den ersten vier
Lokomotiven
schon kurz nach der
Inbetriebsetzung
in Flammen auf. Die Anordnung der Wendepolshunts aussen am Kasten hatte
den Nachteil, dass die
Widerstände
stark verschmutzt wurden. Hauptsächlich war es das
Öl
aus den vielen
Gleitlagern.
Trat dieses aus, verspritzten die
Räder
es in die Widerstände. Diese wurden durch den Betrieb jedoch immer wieder
bedrohlich warm.
Bremste man mit der pneumatischen
Bremse
kräftig, gelangten Funken in den Bereich der
Widerstände.
Dieser Funkenwurf entzündete in mehr als einem Fall den öligen Schmutz und
rief nach dem Eingreifen der Feuerwehr. Um diese doch sehr häufigen
Störungen in den Griff zu bekommen, wurden die Wendepolshunts bei den
weiteren Maschinen im
Maschinenraum
montiert. Die älteren Modelle passte man den neuern Exemplaren an.
Die neuartige
elektrische
Bremse war ein gelungener Wurf. Diese Art der
elektrischen Bremse wurde in der Folge auf allen
Lokomotiven
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet und erst bei der Baureihe
Re 6/6 leicht verändert. Die
elektrische Bremse der Ae 4/6 war somit wegweisend und wurde erst mit den
modernsten Lokomotiven mit
Drehstrommotoren
aufgegeben, da dort andere Steuerungen zum Einbau kamen.
So musste oft, um die
Lokomotive
einzuschalten, als letzte Rettung die ver-botene weil gefährliche,
Besenstielmethode angewendet werden. Abhilfe schaffte hier jedoch nur ein
neuer
Hauptschalter,
der verbesserte Kontakte bekommen hatte. Damit hätten wir die Massnahmen eigentlich schon besprochen, denn auch bei der Steuerung gab es kaum Probleme mit der Baureihe. Es sei denn, man kam auf die hirnverbrannte Idee und wollte aus zwei Maschinen eine machen.
Die
Vielfachsteuerung
war ein Kapitel für sich, doch auch sie funktionierte zu Beginn noch sehr
zuverlässig und führte kaum zu nennenswerten Störungen. Doch das änderte
schnell. Probleme bereiteten die Steckdosen und die Kabel. Bei den Steckdosen war das Problem, dass im Betrieb immer wieder Feuchtigkeit zu den Kontakten gelangen konnte.
Das konnte einsickerndes Wasser, aber auch eingedrungener Schnee
sein. Dadurch korrodierten die Kontakte und der
Widerstand stieg an. Bei einer
Spannung
von lediglich 36
Volt,
konnten so die Signale nicht mehr zuverlässig auf die Kabel übertragen
werden.
Bei den Kabeln sah es nicht besser aus. Diese mussten gekreuzt
werden. Hatten nun die Schirmungen durch mechanische Beschädigungen Risse
erhalten, versagte die
Isolation.
Es kam zu
Kurzschlüssen.
Viel mehr Ärger bereiteten jedoch die in diesem Fall auftretenden
Störungen. Diese nahmen mit der Fülle der Befehle immer mehr zu und
sorgten letztlich für eine Abschaltung der ferngesteuerten
Lokomotive.
Eine Weiterfahrt war unmöglich.
Zumindest bis zu jenem Punkt, wo die Dichte der Signale wieder angestiegen ist. Mit der Zeit verlor das Personal mit diesem System die Geduld.
Zumal die Ladediode in die Knie ging, wenn sie zwei
Lokomotiven
versorgen musste. Die Sache lief dann auf den
Batterien,
die auch nicht lange durch-halten konnten. So richtig in den Griff bekommen hatte man dieses System daher nie. In der Fol-ge wurde die Einrichtung betrieblich im-mer weniger genutzt. Letztlich wurde der ganze Mist ausge-baut und die Lokomotiven verkehrten wieder ohne Störungen an der Vielfach-steuerung.
Hier kann jedoch gesagt werden, dass es mit dem nächsten Kabeltyp
funktionierte. Jedoch kam dieses Kabel für die Bau-reihe Ae 4/6 schlicht
zu spät.
Im Bereich der Bedienung gab es bis zur Modernisierung keine
nennenswerten Veränderungen. Jedoch stellte das neue
Dese von allen anderen
Ventilen
abweichende Bedienungsart forderte besonders Anfänger und brachte sie
immer wieder in Schwierigkeiten. War die Bremsung missraten, wurde mit
einem festeren Griff versucht, der
Bremse
noch ein wenig mehr Druck abzuverlangen. Dabei wurde aber nicht mehr
gebremst, sondern es erfolgte durch die gedrückte Klinke ein Füllstoss.
Die
Schnellbremse
brachte dann den Zug noch zum Stehen, wenn auch nicht dort, wo er sollte.
Bei all diesen Problemen, die schwer zu beheben waren, überrasche
es nicht, dass die
Lokomotive
einen schlechten Ruf bekam. Gerade die
Triebachsen
mit all ihren Problemen konnten schon als gröberes Problem angesehen
werden. Mit gebrochenen Triebachsen ist nicht zu spassen, da können
schwere Unfälle entstehen. Wobei der Reihe Ae 4/6 hier die innen
gelagerten
Achsen
etwas halfen, aber ein grosses Problem war es trotzdem.
Ergänzt mit einem
Antrieb,
der sich selber vernichtete, wurden die grossen Errungenschaften der
Maschine unbedeutend.
Man kann die Baureihe Ae 4/6 deshalb als elektrischen Erfolg bezeichnen.
Das war sicher ein gutes Zeugnis für die Elektriker. Das Gesamtpaket war
ein hervorragender
Versuchsträger.
Nur dazu wurden schlicht nicht zwölf
Lokomotiven
benötigt. Die Bestellung vor Ablieferung der
Prototypen
war daher ein Fehler.
Letztlich erhielten die
Lokomotiven
der Baureihe Ae 4/6 noch den
Gotthardfunk.
Dieser wurde mit der Einführung auf allen Lokomotiven, die im
Güterverkehr
und am Gotthard eingesetzt wurden, benötigt. Darunter gehörten auch die
verbliebenen Maschinen der Reihe Ae 4/6. Der Einbau war aber nur von
kurzer Dauer, denn er erfolgte nur wenige Jahre vor dem endgültigen aus
der unbeliebten und sehr lauten Lokomotive.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
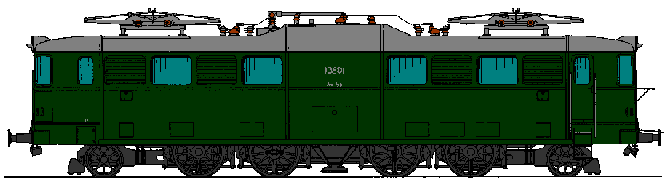 Man
kann sich fragen, wo man mit den Problemen beginnen sollte. Hier ist es
wirklich sinnvoll, wenn wir wieder die Teile der Vor-stellung nehmen und
so mit dem mechanischen Teil beginnen.
Man
kann sich fragen, wo man mit den Problemen beginnen sollte. Hier ist es
wirklich sinnvoll, wenn wir wieder die Teile der Vor-stellung nehmen und
so mit dem mechanischen Teil beginnen.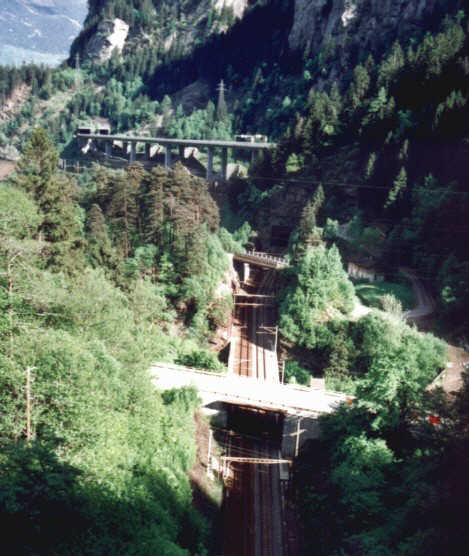 In
den engen
In
den engen
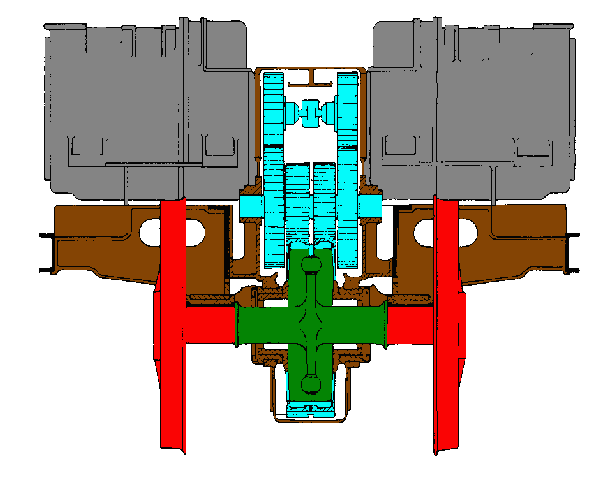 Hinzu
kam der
Hinzu
kam der
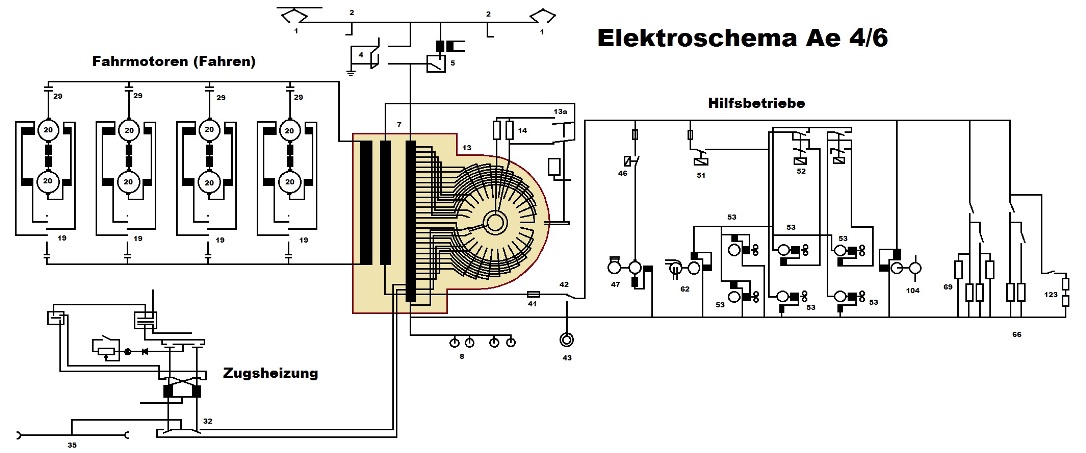
 Damit
haben wir die Überleitung zur Steuerung. Diese funktionierte auf der
Damit
haben wir die Überleitung zur Steuerung. Diese funktionierte auf der 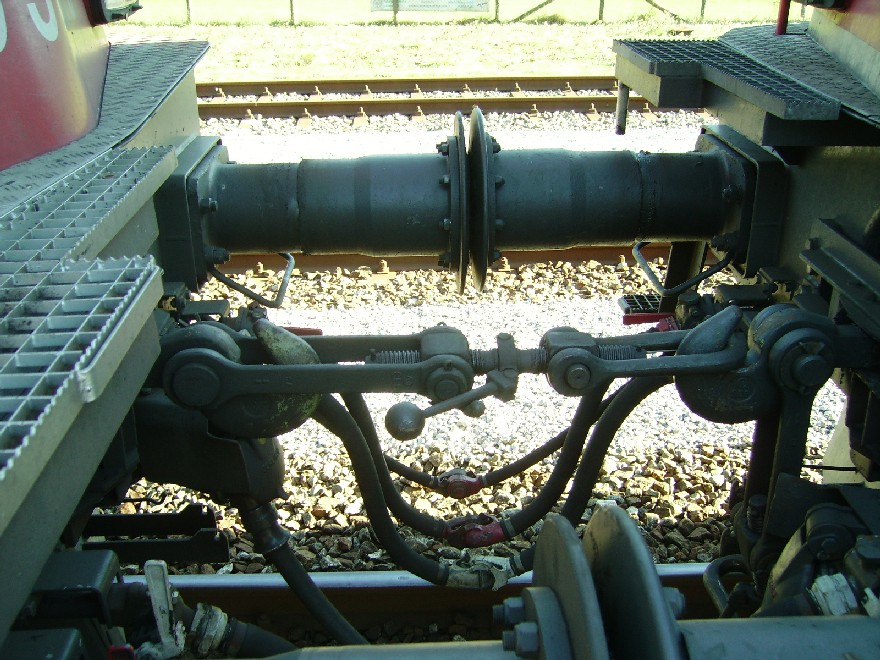 Stand
das Gespann, reduzierten sich die Signale auf der Leitung wieder. Man
konnte die Maschinen einschalten und wieder losfahren.
Stand
das Gespann, reduzierten sich die Signale auf der Leitung wieder. Man
konnte die Maschinen einschalten und wieder losfahren.