|
Bedienung des Triebwagens |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Für die Bedienung dieser Fahrzeuge waren zwei
Personen vorgesehen. Dabei war der
Zugführer
jedoch nicht unbedingt auf dem
Triebwagen
anwesend. Zwingend dort sein musste der Lokführer. Dieser musste auch
nicht mehr von einem
Heizer
begleitet werden, da der Aufbau so ausgeführt wurde, dass mit einem Mann
gearbeitet werden konnte. Sollte ein Heizer mitfahren, stand ihm die
Sitzbank zur Verfügung.
Dabei waren Sie mit einer kleinen Ausnahme identisch aufgebaut wor-den.
Die
Sicherungen
und
Schaltautomaten
wurden in eigens dazu vorgesehenen Schränken montiert. Diese befanden sich
neben den Türen auf der Seite des
Führerstandes.
Es gab einen Schrank für die
Druckluft,
die Sicherungen, die Schaltautomaten und für den
Zugführer.
In das Fahrzeug gelangte man über eine der vier
Einstiegstüren.
Diese konnten nun leicht geöffnet werden, denn beim abgestellten
Triebwagen
waren die
Zylinder
entlüftet worden und so war der Einstieg nicht blockiert. Je nach
Standort, war aber eine Kletterpartie nicht zu vermeiden. Im Fahrzeug
wurde dann der für die Fahrt richtige
Führerraum
besetzt. Schliesslich musst das mitgeführte Gepäck deponiert werden.
Wenn wir uns den
Führerstand
ansehen, fällt sehr schnell auf, dass der dem Lokführer angedachte Platz
sehr knapp bemessen war. Trotzdem gelang es an der Rückwand eine
Sitzgelegenheit zu montieren. Vor diesem Sitz befand sich das leicht
geneigte
Führerpult.
Hier fiel sofort der sich im zentralen Blickfeld liegende
Steuerkontroller
auf. Darum herum waren die
Bremsventile
und die
Steuerschalter
angeordnet worden.
Um den
Führerstand
in Betrieb nehmen zu können, mussten zuvor noch andere wichtige Aufgaben
vorgenommen werden. Da die
Batterien
nicht abgehängt wurden, mussten die Hähne zu den
Hauptluftbehältern
geöffnet werden. Es war auch hier so, ohne
Druckluft
ging auf dem Fahrzeug schlicht nichts. Fehlte sie, war oft ein leises
Fluchen zu hören. Das lassen wir und nehmen an, dass der Vorrat
ausreichend ist.
Er stellte sicher, dass die Schalter nur vom
Lokomotivpersonal
bedient werden konnten. Dazu war ein nur einmal vorhandener Schlüssel
eingeführt worden. Dabei waren die
Steuerschalter
in der Reihenfolge, wie sie üblicherweise bedient werden mussten,
angeordnet.
Die
Steuerschalter
besassen Symbole und waren selbsterklärend. Als Beispiel sei erwähnt, dass
ein Symbol für eine
Batterie
die Steuerung aktivierte. Es wurde also mit Symbolen gearbeitet und das
war von den
Staatsbahnen
übernommen worden, denn diese mussten deshalb nicht mit drei Sprachen
arbeiten. Im Gegensatz zu den Schweizerischen Bundesbahnen SBB war jedoch
die Reihenfolge der Schalter geändert worden.
Bevor mit der
Inbetriebnahme
begonnen wurde, mussten die
Ventilation
und der
Kompressor
eingestellt werden. Dabei wurde in der Regel mit dem
Druckschwankungsschalter
gearbeit. Bei der Freigabe des
Schalterkastens
waren diese in der Grundstellung und daher ausgeschaltet. Nur so konnte
gesichert werden, dass diese von jedem
Führerstand
aus, korrekt bedient werden konnten. Bei beiden Funktionen gab es die
Regelung mit der Steuerung und jene mit der Kontrolle durch den Lokführer.
In der Regel wurde der «Automat» gewählt. Die
Einrichtungen funktionierten jedoch noch nicht, da die
Hilfsbetriebe
noch keine
Spannung
hatten. Leicht anders war das Verhalten aber bei der
Zugsheizung.
Diese durfte nur eingeschaltet werden, wenn dazu ein Auftrag erteilt
wurde. Es war dem Lokführer nicht immer bekannt, ob am angehängten Zug
nicht noch Arbeiten an der Leitung ausgeführt wurden.
Löste das
Minimalspannungsrelais
den Schalter wieder aus, musste der Vorgang beim
Hauptschalter
wiederholt werden. Erst wenn der Versuch ge-lang, wurde durch den
Kompressor
der Vorrat bei der
Druckluft
ergänzt und die
Batterieladung
setzte ein. Nachdem das Fahrzeug nun elektrisch in Betrieb genommen wurde und die Luft ergänzt wurde, können wir uns den Bremsen zuwenden. Damit diese genutzt werden konnten, musste die Druckluft zu den Ventilen geführt werden.
Dazu war ein
BV-Hahn
vorhanden. Dieser war so aufgebaut worden, dass beim offenen Hahn die
Zugsicherung
nach
Integra-Signum
aktiviert wurde, denn nun galt der
Triebwagen
als zugführend.
Die
Bremsprobe
begann mit der
Regulierbremse.
Für diese musste das
Bremsventil
von
Westinghouse
bedient werden. Auch wenn die
Staatsbahnen
damals neue
Ventile
kannten, bei der BLS-Gruppe
wurde immer noch das
Regulierbremsventil
für diese "Rangierbremse"
verwendet. Wurde dabei das
Handrad
gegen den Sinn des Uhrzeigers verdreht, wurde
Druckluft
in die
Bremszylinder
gelassen und so die
Bremse
angezogen.
Je mehr das
Ventil
angezogen wurde, desto höher wurde der
Luftdruck
in den
Bremszylindern.
Welcher Wert genau vorhanden war, konnte an einem auf dem
Führerpult
montierten
Manometer
abgelesen werden. Dort waren auch die Werte für die
Hauptleitung
und für den Vorrat vorhanden. Bei den Bremszylindern war jedoch nur der
benachbarte
Zylinder
zu erkennen. Bei der BN war das ein
Drehgestell,
bei der GBS nur eine
Achse.
Die Bedienung dieses Führerbremsventiles war dem Personal bekannt und so musste sich dieses nicht an eine neue Bedienung gewöhnen. Erst die Staatsbahnen kannten damals die geregelten Ventile, die ein Überladen der Bremsen verhinderten.
Bei der BLS-Gruppe
waren diese neuartigen
FV4
mit
Niederdrucküberladung
nicht vorhanden. Da es keine Neuerung war, lassen wir die
Bremsprobe.
Sie war erfolgreich, wenn die
Hauptleitung
wieder fünf
bar
hatte und der
Bremszylinder
leer war. Nachdem nun das Fahrzeug eingeschaltet wurde und die pneumatischen Bremsen auf die korrekte Funktion geprüft waren, konnte die Handbremse gelöst werden. Dazu musste der Lokführer seinen Arbeitsplatz verlassen. Die Kurbel für die
Handbremse
fand in seinem Bereich schlicht keinen Platz mehr. Daher montierte man sie
auf der Seite der Sitzbank auf einem Pult, das auch Platz für Unterlagen,
oder die vom Lokführer mitgeführte Arbeitsmappe bot. Einziger Nachteil dieses Aufbaus war, dass die Handbremse im unbesetzten Führerstand theoretisch für Reisende zugänglich war und diese so absichtlich Manipulationen vornehmen konnten.
Da aber der
Zugführer
vorhanden war, konnte dieser während der Fahrt den gelösten Zustand
kontrollieren. So war es nicht so leicht, sich der Sabotage zu
befleissigen. Die Gefahr erwischt zu werden war sehr gross.
Bevor wir mit dem nun fahrbereiten
Triebwagen
losfahren, müssen wir uns noch um die Türen kümmern. Auch wenn diese das
Lichtraumprofil
nicht verletzten, während der Fahrt waren diese geschlossen. Der
Schliessvorgang konnte mit einer einfachen Taste erfolgen. Jedoch war bei
diesen Türen kein
Einklemmschutz
vorhanden und so durften sie nur unter Beobachtung mit der Steuerung
geschlossen werden.
Auf der Bedienseite, konnte das durch einen
Blick durch das Seitenfenster erfolgen. Um auf der gegenüber liegenden
Seite auch eine Kontrolle vornehmen zu können, musste ein Hilfsmittel
vorhanden sein. Der Lokführer konnte nicht die Seite wechseln und die
Taste bedienen. Dazu waren schlicht die Arme zu kurz und daher wurde auf
der abgewandten Seite ein
Rückspiegel
eingebaut. So war die Kontrolle auf beiden Seiten möglich.
Der
Rückspiegel
wurde mit
Druckluft
geöffnet. Fehlte diese sorgte eine Vorrichtung dafür, dass der
Spiegel
eingeklappt wurde. Das musste im hinteren
Führerstand
der Fall sein, aber auch bei Hindernissen. Der Grund war, dass der
ausgeklappte Spiegel das
Lichtraumprofil
verletzte. Da aber der Lokführer die Hindernisse kommen sah, war das kein
Problem. Damit können wir nun aber mit dem
Triebwagen
die Fahrt beginnen.
Damit konnte nun auch die
Zugkraft
aufgebaut und die als
Sicherung
angezogene
Regulierbremse
gelöst werden. Der
Triebwagen
nahm Fahrt auf. Wir kommen nun zum
Steuerkon-troller. Die Zugkraft rief der Lokführer mit dem vor ihm montierten Handrad ab. Dieser Steuerkontroller wurde dazu im Uhrzeigersinn von der Position null verdreht. Die Hüpfer schalteten so die erste Fahrstufe zu. Das Fahrzeug konnte sich dank der vorhandenen
Zugkraft
in Bewegung setzen und losfahren. Wurde mehr Zugkraft benötigt, wurde das
Handrad
einfach noch mehr im Uhrzeigersinn gedreht und eine weitere Stufe
schaltete sich zu. Je mehr der Steuerkontroller im Uhrzeigersinn verdreht wurde, desto höher wurde die Zugkraft und die Fahrmotoren wurden immer stärker belastet.
Wie hoch die
Zugkraft
wirklich eingestellt war, konnte der Lok-führer an den
Instrumenten
für die
Fahrmotorströme,
die unterhalb des Fensters montiert wurden, ablesen. Dort war auch eines
für die Anzeige der
Fahrleitungsspannung
vorhanden. Daneben wurden die schon erwähnten
Manometer
montiert.
Der Lokführer konnte nun anhand der in einer
auf dem
Führerpult
angebrachten Tabelle angegebenen Werte für den
Fahrmotorstrom,
die
Zugkraft
immer höher steigern. Der
Triebwagen
beschleunigte dabei immer mehr. Wollte der Lokführer die
Zugkraft reduzieren, drehte er das
Handrad
in die entgegengesetzte Richtung. Wurde dabei die Stellung null erreicht,
wurde die Zugkraft schlagartig abgeschaltet, da alle
Hüpfer
öffneten.
Die gefahrene Geschwindigkeit wurde dem
Lokführer mit einem in der rechten Ecke montierten
Geschwindig-keitsmesser
angezeigt. Beim
Triebwagen
wurden elektrisch betriebene Modelle aus dem Hause Hasler in Bern
eingebaut. Dabei kamen in den beiden
Führerständen
jedoch nicht die gleichen Geräte zum Einbau. Wir müssen daher beide Seiten
des Triebwagen ansehen, denn der Unterschied war für die Bedienung
wichtig.
Im
Führerstand
eins und somit beim
Stromabnehmer
baute man ein Modell ein, dass neben einer Uhr, auch die Aufzeichnung der
Fahrdaten mit einem
Registrierstreifen
hatte. Dieser Streifen diente der Aufzeichnung auf Dauer und musste durch
das
Lokomotivpersonal
am Abend nach dem Dienstende entfernt und im
Depot
abgegeben werden. Die Abgabe der Streifen war in den Vorschriften für das
Lokpersonal geregelt worden.
Ebenso konnten hier die gefahrenen Kilometer
erfasst werden. Dazu war eine Anzeige mit sieben Ziffern vorhanden. Die
rechte Ziffer zählte dabei in Schritten von 100 Metern. Bei einem Wechsel
des Gerätes wurde der Kilometerstand anhand der Anzeige angepasst. Eine
Möglichkeit die von einem Lokführer gefahrene Strecke zu messen, war
jedoch nicht vorhanden, denn diese war nicht so wichtig, da der Wert bei
der Streifenabgabe notiert wurde.
Ein
Geschwindigkeitsmesser
mit Restwegaufzeichnung baute man hingegen im
Führerstand
zwei ein. Dieses Modell erfasste die letzten gefahrenen Meter und die
Geschwindigkeit sehr genau. Diese
Farbscheibe
musste nur entnommen werden, wenn ein Vorfall diese Massnahme verlangte.
Hier erfolgte weder eine Anzeige der Zeit noch wurden die gefahrenen
Kilometer erfasst. Das Gerät gab jedoch die Geschwindigkeiten für die
davon abhängigen Funktionen des Fahrzeuges vor.
Er musste nun verzögert werden. Dazu stand die
elektrische
Bremse zur Verfügung. Um in den Bremsbetrieb zu
gelangen, musste der
Steuerkon-troller
von der Position null jedoch gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Dadurch wurden die Wendeschalter neu gruppiert, der Umformer für den benötigten Gleichstrom akti-viert und die elektrische Bremse eingeschaltet. Jetzt konnte der Lokführer die elektrische Bremskraft mit dem Handrad regulieren.
Dazu ging er spiegelverkehrt zur
Zugkraft
vor. Die
Bremskraft
wurde somit erhöht, wenn er das
Hand-rad
gegen den Uhrzeigersinn bewegte. Auch jetzt musste der die zulässigen
Bremsströme
anhand der Anzeigen ablesen und die
elektrische
Bremse ent-sprechend bedienen.
Reichte die
Bremskraft
der
elektrischen
Bremse nicht aus, konnte zusätzlich die
automatische Bremse
angezogen werden. Dazu verbrachte der Lokführer den Griff am
Ventil
der
Bauart
W4
auf «bremsen» und der Druck in der
Bremsleitung
wurde gesenkt. War der vom Personal gewünschte reduzierte
Luftdruck
vorhanden, wurde das
Führerbremsventil
in die Stellung «Abschluss» verbracht und der eingestellte Druck wurde
gehalten.
Damit beim Triebwagen nicht die
elektrische
Bremse in Kombination mit der
Druckluftbremse
arbeiten konnte, wurde die elektrische Bremse ausgeschaltet, wenn der
Luftdruck
im
Bremszylinder
anstieg. Damit trotzdem der
Triebwagen
elektrisch und die Wagen pneumatisch gebremst werden konnten, war am Boden
ein Auslöseknopf vorhanden. Der verhinderte, dass die pneumatischen
Bremsen
des Triebwagens ansprachen.
Dieser Vorgang musste einmal am Tag geprüft
werden. Dabei erfolgte das bis zur Ansprechung mit der
Zwangsbremse.
In den anderen Fällen strebte das Personal jedoch an, dass diese nicht
ausgelöst wurde und daher wurde das
Pedal
gedrückt. Traten während der Fahrt Störungen auf, fiel bei der Hüpfer-steuerung nur die Zugkraft aus. Bei anderen Problemen wurde jedoch der Hauptschalter geöffnet. In beiden Fällen wurde ein-fach wieder bei null begonnen.
Kam es jedoch gleich wieder zu einer
neuerlichen Störung muss-te angehalten und die Ursache durch das Personal
abgeklärt wer-den. Wie zu handeln war, wurde während der Schulung
ver-mittelt. Damit haben wir die wichtigsten Punkte der Bedienung behan-delt. Die Unterschiede zu anderen Baureihen waren nicht so gross, wie man erwarten könnte.
Das war auch eine Folge davon, dass die
Führerstände
ähnlich zu den anderen Serien aufgebaut worden waren. Die
Hüpfersteuerung
war bekannt und so konnte der Aufwand bei der Schulung des Personals
vermindert werden. Jedoch galt auch hier, es wurde nur mit Ausbildung
gefahren.
In den
Bahnhöfen
wurde der Zug überwacht und während der Fahrt war der
Zugführer
die einzige Person, welche die
Verbindung
über die Türe in der
Front
nutzte um in die angehängten
Reisezugwagen
zu gelangen. Mit der eigentlichen Bedienung hatte er jedoch nicht viel zu
tun. Jedoch wurde der Zugführer auch bei Störungen zur Behebung derselben
beigezogen.
Zum Schluss müssen wir den
Triebwagen
noch remisieren. Dazu wurde dieser die
Druckluft
ergänzt und dann das Fahrzeug ausgeschaltet. Mit der
Handbremse
wurde wieder die
Sicherung
vorgenommen und die Hähne zu den
Hauptluftbehältern
geschlossen. Es erfolgte dann noch die Entnahme des
Registrierstreifens
und eine optische Kontrolle am Fahrzeug. Allfällige Schäden wurden dem
Depot
gemeldet und diese hatten eventuell eine Änderung zur Folge.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
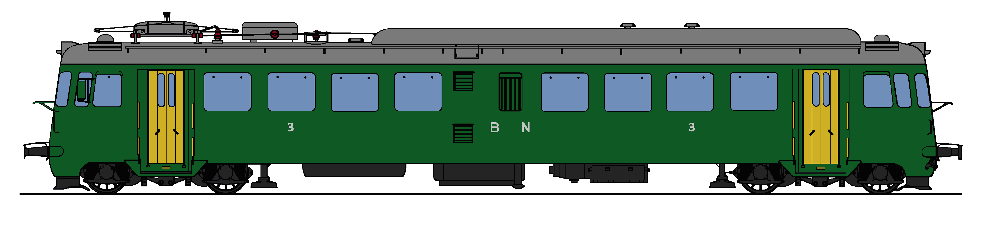 Die
notwendigen Bedien-elemente wurden mit wenigen Ausnahmen in den beiden
Die
notwendigen Bedien-elemente wurden mit wenigen Ausnahmen in den beiden
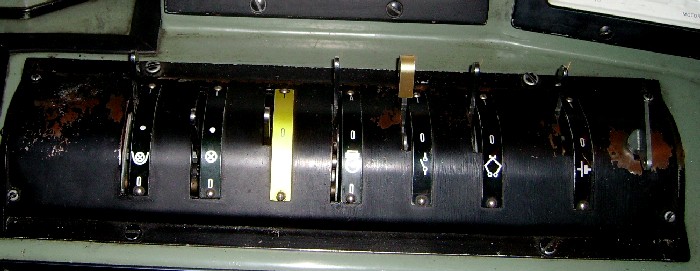 Eingeschaltet
wurde der
Eingeschaltet
wurde der

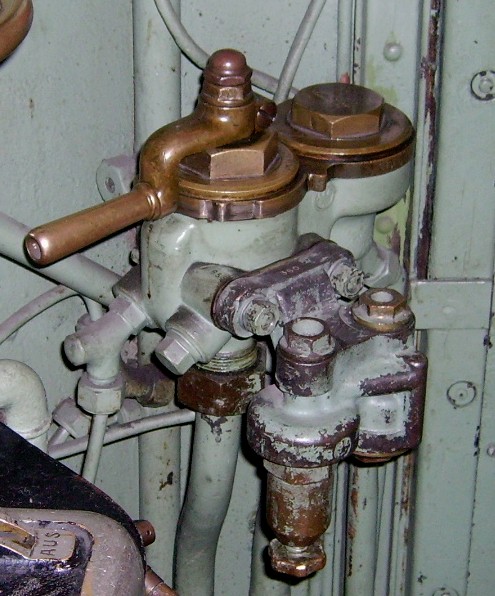 Bei
der
Bei
der


 Anhand
der angezeigten Geschwindigkeit reguliert der Lokführer die
Anhand
der angezeigten Geschwindigkeit reguliert der Lokführer die
 Mit
Aufnahme der Fahrt, wurde auch die
Mit
Aufnahme der Fahrt, wurde auch die