|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir nun zur
Beleuchtung
und zur Steuerung kommen, dann haben wir extra dafür ein
Bordnetz
erhalten. Dieses musste auch zur Verfügung stehen, wenn die
Spannung
aus der
Fahrleitung
nicht zur Verfügung stand. Aus diesem Grund musste die erforderliche
Energie gespeichert werden. Das gab das
Stromsystem
vor, denn die Speicher konnten nur mit
Gleichspannung
betrieben werden. Wir müssen diese genauer ansehen.
Mit zwei solchen in Reihe geschaltet entstand die
Spannung
von 36
Volt
für das auf dem Fahrzeug ver-baute
Bordnetz.
Die sonst bei
Triebwagen
übliche Erweiterung der
Kapazität
gab es jedoch nicht. So gut die Bleibatterien waren, sie hatten ein gros-ses Problem. Die Behälter hatten ein Gewicht, das von einem Menschen nicht getragen werden konn-te. Hinzu kam, dass in den Zellen beim Ladevorgang ein Gas ausgeschieden wurde.
Dieses war hoch explosiv und war so eine Gefahr. All das wurde
noch mit dem erforderlichen regel-mässigen Unterhalt ergänzt. Daher war
man an gewisse Regeln für den Einbau gebunden. Unter dem Wagenkasten wurde für die Bleibatterien ein Batteriekasten eingebaut. Dieser war belüftet, so dass das Gas abziehen konnte.
Wichtiger war jedoch der Deckel dieses Kastens. Wurde er geöffnet,
waren Gleitbahnen vorhanden, auf denen die schweren
Batterien
aus dem Kasten gezogen werden konnten. So war der Zugang für die Wartung
einfach und auch ein Ersatz war mit den Hebegeräten kein Problem.
Die
Kapazität
reichte nur kurze Zeit für die Versorgung der Steuerung und der
Beleuchtung
aus. Aus diesem Grund mussten sie geladen werden und dazu war die
Umformergruppe
vorgesehen. Deren
Leistung
reichte, um die Versorgung zu übernehmen und um die
Batterien
zu laden. Dazu reichte es, wenn einfach eine leicht höhere
Spannung
angelegt wurde. Damit können wir uns die Verbraucher etwas genauer
ansehen.
Abhängig davon war, wann das Licht benötigt wurde. Dieses gab es
im Fahrzeug, aber auch aussen und diese war von der Steuerung ab-hängig.
Wir beginnen jedoch mit dem Innenraum, der viele Lampen hatte. Die Fahrgasträume, aber auch die beiden Führerstände waren direkt an den Akkumulatoren angeschlossen worden. Dabei galt im Führer-stand die Regel, dass die Lampe mit der Inbetriebnahme auf die Steuerung umgeschaltet wurde.
So konnte sie auch gelöscht werden. Im unbesetzten
Führerstand
war jedoch immer das Licht vorhanden. Zumindest dann, wenn auch in den
Abteilen die Lampen beleuchtet wurden. Man verwendete für die Beleuchtung einfache an der Decke mon-tierte Glühbirnen. Diese waren nicht verkleidet worden und nur jene auf den Plattformen waren ein wenig in die Decke versenkt worden.
So erhellten sie den Bereich, gaben aber kein Licht in den
Führer-stand
ab. Es war daher eine einfache zur
Wagenklasse
passende
Beleuchtung
vorhanden. Die bei den
Leichtstahlwagen
in der Nische der Türe verwendete Lampe fehlte jedoch.
Technische Lampen gab es in den
Maschinenräumen
und in den beiden
Führerständen.
Während im Schrank die Lampe mit dem schliessen der Türe gelöscht wurde,
waren die Lampen der Anzeigen und
Instrumente
an der
Dienstbeleuchtung
angeschlossen worden. Wirklich gefährlich für die
Batterien
werden konnte daher nur die schlecht erkennbare Lampe im WC, aber diese
konnte nicht unabhängig von den
Fahrgasträumen
geschaltet werden.
Wenn wir mit den beiden unteren über den
Puffer
montierten Lampen beginnen, gab es jedoch noch keine Unterschiede, die
betrachtet werden müssen. Jedoch waren die Lampen auch nicht gleich. Auf der Seite des Lokführers war einfach eine weisse Lampe vorhan-den. Auf der anderen Seite wurde diese mit einer gleichgrossen darüber montierten Lampe ergänzt. Diese hatte ein rotes Glas bekommen und sie wurde benötigt um den Zug-schluss zu beleuchten.
Die bei den
Staatsbahnen
damals noch verwendeten
Signalbilder
für die Anzeige der Zugfolge, kamen bei der BLS-Gruppe
nicht mehr zur An-wendung.
Noch fehlt uns die obere Lampe. Die befand sich im Bereich des
Daches und sie bestand ebenfalls aus zwei Lampen. Während diese bei den
beiden
Triebwagen
der BN übereinander eingebaut wurden, waren sie beim Modell der GBS
seitlich montiert worden. Somit konnte auch hier ein weisses und ein rotes
Licht gezeigt werden. Wobei hier wirklich beide Lampen miteinander
leuchten konnten, auch wenn das nicht vorgesehen war.
Die rote Lampe wurde benötigt um die Fahrberechtigung zu
signalisieren. Diese kam auch auf den Stecken der BLS-Gruppe
zur Anwendung. Sollten Sie sich nun fragen, wie das
Warnsignal
erstellt wurde, dann muss ich erwähnen, dass dieses damals nicht zwingend
gezeigt werden musste. Die BLS-Gruppe
kannte es schlicht noch nicht. Daher war das auch eine der später
vorgestellten Nachrüstungen an den Fahrzeugen.
Damit
wurden die Wünsche des
Lokomotivpersonals
an die Technik übermittelt. Diese wiederum gab Rück-meldungen, die auch
von der Steuerung überwacht wur-den. Es lohnt sich, wenn wir genauer
hinsehen. Aufgaben wurden vom Lokomotivpersonal mit Steuer-schaltern und dem Steuerkontroller übermittelt. Die Schalter waren für den Stromabnehmer, den Haupt-schalter und den Kompressor vorhanden.
Weitere werden wir später noch ansehen, denn zuerst wollen wir
beim
Kompressor
bleiben, denn der
Steuer-schalter
hatte drei mögliche Stellungen. Das waren jene für Ein und Aus, aber auch
eine die mit Automat bezeichnet wurde.
War der Automat eingestellt übernahm die Steuerung die Ergänzung
der
Druckluft.
Dazu war ein
Druckschwankungsschalter
vorhanden. Sank der Wert auf unter sechs
bar,
aktivierte die Steuerung den
Kompressor
und die Luft wurde ergänzt. Sobald ein Wert von zehn bar erreicht wurde,
schaltete der Automat wieder aus. Das Überdruckventil öffnete daher nur,
wenn der Kompressor durch den Lokführer gesteuert wurde.
Ein wichtiger Teil der Steuerung waren die
Hüpfer
für die
Fahrstufen.
Um diese zu erzeugen mussten unterschiedliche Stufenhüpfer geöffnet oder
geschlossen werden. Diese Aufgabe wurde von der
Hüpfersteuerung
übernommen. Welche
Schütze
wann geschlossen wurden, war in einer Matrix aufgeführt worden. Die half
bei der Eingrenzung von Störungen, denn hier konnten diese nicht so leicht
erkannt werden.
Jedoch wurden vom Kabel ebenfalls nur die
Fahrstufen
übermittelt, die Schaltung der
Hüpfer
selber war davon schlicht unabhängig. Die Matrix blieb, nur dass dazu die
Schalter verknüpft wurden. Wir werden uns später noch genauer mit der weiteren Umsetzung der Befehle befassen, denn diese waren sehr stark mit der Bedienung ver-knüpft. Das Beispiel mit der Hüpfersteuerung zeigt das deutlich, denn die Fahrstufe wurde vom Fahrer an einem Steuer-kontroller eingestellt.
Diese Position wurde dann an die Steuerung übertragen, welche dann
die entsprechenden
Hüpfer
schloss. Bei allen anderen Funktionen war das auch so gelöst worden. Hier wollen wir die Funktionen der Überwachung ansehen und uns auch andere Bereiche der Steuerung be-handeln, die nicht direkt mit dem Personal zusammen hingen. Zuerst betrachten wir die technischen Kontrollen, denn diese dienten dem Schutz der Technik.
Diese konnte auch von Störungen be-troffen sein und so zu Schäden
führen. In den meisten Fällen wurde das durch
Ströme
erfasst und dann reagiert. Kontrolliert wurde die Technik mit einfachen Relais oder Sicherungen. Diese lösten aus, wenn ein definierter Wert nicht erreicht wurde.
Bei den
Fahrmotoren
waren das die maximalen
Ströme.
Wichtig war, dass mit einer Ausnahme nur durch die
Relais
der
Hauptschalter
ausgelöst wurde. Eine Anzeige diente dem
Lokomotivpersonal
bei der Suche nach der Störung im entsprechenden
Maschinenraum.
Dabei gab es jedoch ein Relais, dass keine Anzeige hatte und das anders
arbeitete.
Mit einem an den
Hilfsbetrieben
angeschlossenen
Relais
wurde die
Fahrleitungsspannung
überwacht. Dabei löste es jedoch erst aus, wenn die
Spannung
während der eingestellten Zeit nicht wieder vorhanden war. Auch jetzt
löste der
Hauptschalter
aus und das Relais wurde zurück gestellt. Die Überwachung begann von
vorne. Weil das kein Schaden ergab wurde keine Anzeige benötigt, denn das
Relais konnte immer wieder ansprechen.
Speziell bei diesem
Relais
war, dass es den
Hauptschalter
auslöste, wenn die
Sicherung der
Hilfsbetriebe
ausgelöst wurde. Diese Störung konnte jedoch nicht direkt erkannt werden.
Als Hilfe galt der
Kompressor,
denn dieser lief bei der Sicherung nicht mehr an, bis das Relais
ausschaltete. In jedem Fall lohnte es sich beim ansprechen der
Minimalspannung
die Kontrolle der Sicherung. Aber das ist definitiv Bedienung.
Mit den
Relais
war keine direkte Diagnose vorhanden. Es löste aus und mit Ausnahme jenes
der
Spannung
durfte jedes einmal zurück gestellt werden. Wenn es danach erneut auslöste
war es eine Störung und die Behebung dieser war bei der Schulung dem
Lokomotivpersonal
vermittelt worden. Damit sind wir aber auch bei der Kontrolle desselben.
Genau genommen wurde aber nur der Lokführer von der Steuerung
kontrolliert.
Um die Reaktionsfähigkeit des Lokführers zu überwachen war die in
der Schweiz übliche
Sicherheitssteuerung
vorhanden. Diese wurde mit einem
Pedal
bedient und arbeitete mit der zurück gelegten Wegstrecke. Die Einrichtung
unterschied dabei zwei Fälle. Im ersten Fall wurde das Pedal nicht
niedergedrückt. Es wurde nun der
Schnellgang
aktiviert und während einem Weg von 50 Meter merkte der Lokführer davon
nichts.
Dabei wurde mit dem
Hauptschalter
die Traktion unterbrochen und eine
Zwangsbremsung
eingeleitet. Die Rückstellung konnte mit dem niederdrücken des
Pedals
erfolgen. Damit wurde aber nur die
automatische Bremse
wieder gelöst. Der Hauptschalter musste durch den Lokführer geschaltet
werden. Da das Fahrzeug für die sitzende Bedienung ausgelegt worden war, musste mit dem Langsamgang auch eine Wachsam-keitskontrolle vorgesehen werden. Hier begann die Wegmessung mit dem Drücken des Pedals.
Dabei passierte nun auf einer Strecke von 1 600 Metern nichts.
Danach wurde auch hier mit dem Summer ein Ton ausgegeben. Dieser war
jedoch anders als beim
Schnellgang,
so das die beiden Einrichtungen unterschieden werden konnten. Erfolgte nun während 200 Meter keine Reaktion, wurde auch hier der Hauptschalter geöffnet und die Hauptleitung mit einer Zwangsbremsung entleert.
Die Rückstellung konnte mit dem
Pedal,
aber auch mit den
Steuerkontroller
und den
Druckluftbremsen
erfolgen. Im normalen Betrieb war daher von der
Wachsamkeitskontrolle
nicht viel zu spüren. Es sei denn, es wurde lange keine Handlung
vorgenommen. Mit dem Pedal wurde die Wegmessung erneut gestartet.
Spezieller war die auf den
Triebwagen
verbaute
Zugsicherung
nach
Integra-Signum.
Diese war auf den Strecken der BLS-Gruppe
noch nicht vorhanden. Jedoch war sie auf den Anlagen der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB vorgeschrieben und so mussten diese Triebwagen damit
ausrüstet werden. Sie wurde nur aktiv, wenn der
Führerstand
besetzt wurde. Das auch, wenn keine Signale damit versehen worden waren.
Wurde mit dem
Triebwagen
nun ein
Vorsignal
mit dem Begriff «Warnung»
befahren sprach die
Zugsicherung
an. Im
Führerpult
leuchtete ein gelbe Lampe auf und der
Schnellgang
wurde aktiviert. Daher hatte der Lokführer 50 Meter Zeit um den Schalter
zu betätigen. Wurde der Quittierschalter während dieser Zeit nicht betätigt, wurde der Hauptschalter geöffnet und eine Zwangsbremsung durch entleeren der Hauptleitung eingeleitet.
Für die Rückstellung musste nun aber zuerst der
Quittierschalter
betätigt werden. Bedingt durch die Verknüpfung mit der
Sicherheitssteuerung
war zudem gesichert, dass der
Langsamgang
bei einer
Bremsung
auf ein Signal nicht ansprechen konnte, da er zurück gestellt wurde.
Gerade die
Zugsicherung
zeigte, wie sich die Kon-trollen auf dem Fahrzeug veränderten, weil dieses
auch auf den Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkehren
sollte. Jedoch muss erwähnt werden, dass die Einführung auch bei der BLS-Gruppe
beschlossen wurde und so sollte diese Einrichtung auch bei nachfolgenden
Baureihen
benutzt werden. Die hier vorgestellten
Triebwagen
waren einfach genau dann geliefert worden.
Ebenfalls eingebaut wurde hier eine Fern- und
Vielfachsteuerung.
Diese erlaubte es einen
Triebwagen
von einem baugleichen Modell, oder aber ab einem passenden
Steuerwagen
zu bedienen. Dabei wurden die Befehle von der Einrichtung über ein Kabel
auf das andere Fahrzeug übermittelt. An den beiden
Stossbalken
wurden dazu Steckdosen vorgesehen. Diese Dosen entsprachen der Ausführung
System III
der
Staatsbahnen.
Da diese hier nicht vorhanden war, war nur die
Vielfachsteuerung
möglich, denn beide
Triebwagen
hatten ja einen eigenen
Kompressor
und einen
Druck-schwankungsschalter
erhalten. Jedoch hatte diese Anlage noch ein weiters Problem. Bei einem ferngesteuerten Triebfahrzeug konnte der Lokführer nicht mehr erkennen, ob die Drehzahlen der einzelnen Achsen korrekt waren. Daher wurde eine Schleuderschutzeinrichtung eingebaut.
Dieser
Schleuderschutz
überwachte die Drehzahlen und reagierte auf Ab-weichungen. Dabei wurde
eine
Meldung
an den Lokführer ausgegeben, aber auch die
Schleuderbremse
aktiviert. Der
Hauptschalter
wurde jedoch nur geöffnet, wenn die
Höchstgeschwindigkeit
überschritten wurde. In der Schleuderschutzeinrichtung eingebauten war auch der Gleitschutz. Dieser reagierte auf die gleiche Weise, wobei nun die Schleuderbremse nicht aktiviert wurde. Jedoch gab es hier ein Problem.
Drehten alle
Achsen
mit der gleichen Drehzahl reagierte der
Schleuderschutz
nicht. Das war auch der Fall, wenn alle Achsen blockierten, denn jetzt
wurde vom
Gleitschutz
angenommen, dass der Zug zum Stillstand gekommen war.
Auch wenn der
Schleuderschutz
auch aktiv war, wenn der
Triebwagen
alleine verkehrte, reagierte das
Lokomotivpersonal
schneller. Damit sind wir aber bereits bei der Bedienung angelangt. Diese
war sehr stark mit der Steuerung verbunden und daher werden wir einige
Punkte dort noch genauer ansehen. Es war dann einfach die Umsetzung der
Handlung durch den Lokführer, aber auch durch den
Zugführer,
auch wenn das nur selten der Fall war.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
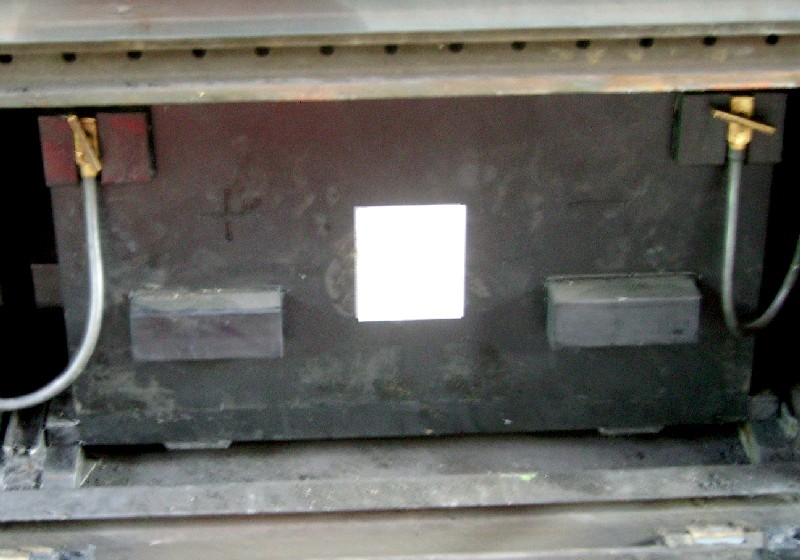 Zur
Versorgung wurden
Zur
Versorgung wurden
 Ich
beginne, wie bei den anderen
Ich
beginne, wie bei den anderen
 Wir
kommen damit zu den aussen am Fahrzeug angebrachten
Wir
kommen damit zu den aussen am Fahrzeug angebrachten
 Damit
können wir zur Steuerung wechseln. Wobei mit der
Damit
können wir zur Steuerung wechseln. Wobei mit der
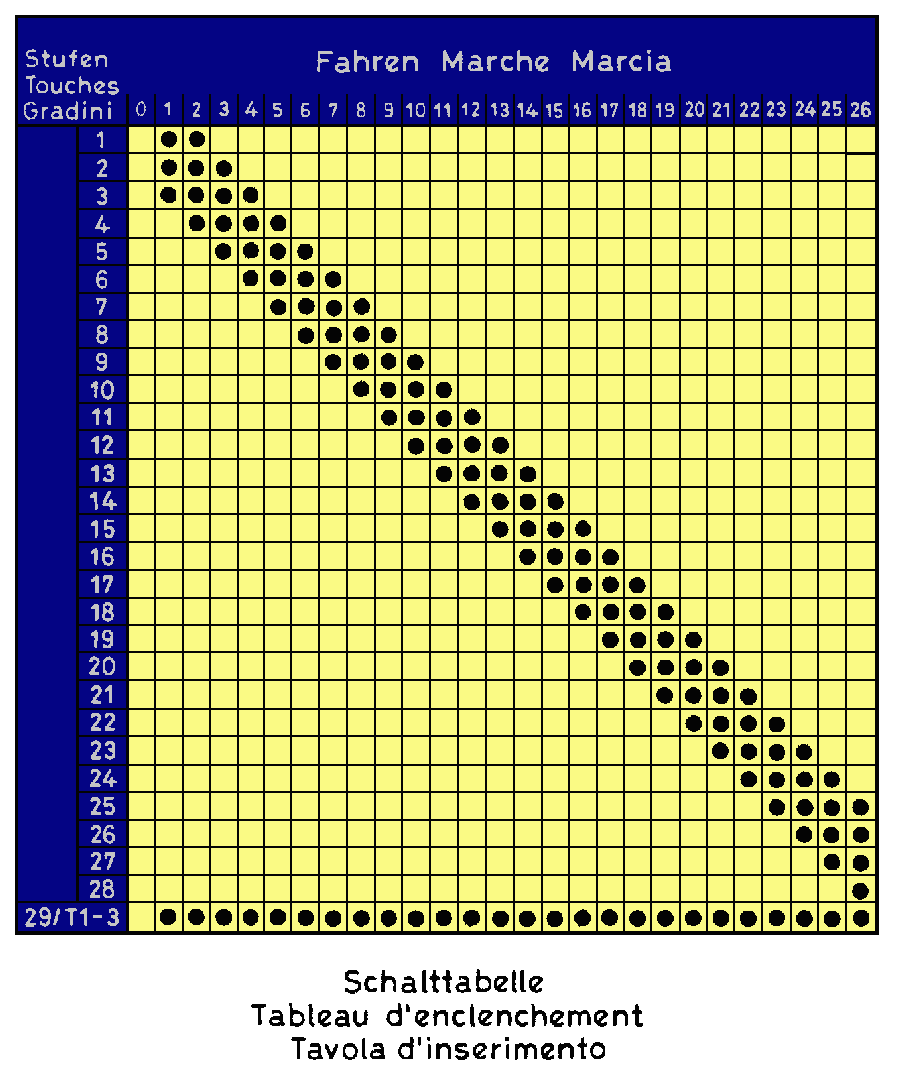 Speziell
bei der
Speziell
bei der
 Nach
diesem Weg wurde im besetzten
Nach
diesem Weg wurde im besetzten
 Die
auf dem
Die
auf dem
 Speziell
an der Einrichtung war, dass der Aufbau den Einsatz von
Speziell
an der Einrichtung war, dass der Aufbau den Einsatz von