|
Änderungen und Umbauten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Würden wir die ersten beiden an die BN
gelieferten
Triebwagen
als gelungen ansehen, müssten wir lügen. Die Fahrzeuge funktionierten nur
unzuverlässig und hatten öfters Störungen zu beklagen. Es hatte sich
gezeigt, dass die Entwicklung eines Triebwagens mit sehr hoher
Leistung
nicht so einfach war, wie man allgemein angenommen hatte. Dabei waren es
Probleme, die an nahezu jeder Stelle auftreten konnten.
Der daraus resultierende Lärm war sehr gross
und auch die brechenden Geräusche kamen nicht gut an. Finanziell war das
zu ersetzende
Zahnrad
ein Problem. Man musste die Lösung finden. Die von den Fachleuten aufgenommenen Abklärungen erga-ben, dass die Probleme beim Getriebe vom zugehörigen Fahrmotor kamen. Der Triebmotor schädigte dabei das eigene Getriebe und dort besonders das grosse Zahnrad auf der Achse.
Bei hoher
Zugkraft
neigten die Motoren zu Schwankungen bei der Zugkraft. Diese waren hier so
gross, dass die
Ge-triebe
schlicht verschlissen wurden, denn das Problem war nicht neu. Motoren für Wechselstrom neigten zur Drehmomentpul-sation. Die Ursache dafür vermutete man bei der Anzahl der Pole und die konnten nicht gross verändert werden.
Diese vom
Fahrmotor
erzeugten Schwingungen wurden auf das
Getriebe
übertragen. Die Leute im Zug bemerkten dabei lediglich ein in
Längsrichtung spürbares Ruckeln. Schlimmer waren die Schwingungen jedoch
für den
Antrieb,
denn der wurde geknetet.
Die pulsierenden Schwingungen in der
Zugkraft
regten das grosse
Zahnrad
zum Schwingen an. Dadurch griffen die Zähne nicht mehr optimal in jene des
Ritzels. Die Folge waren stark abgenützte Flanken bei den Zähnen des
Getriebes.
Diese führten schliesslich zu einem grossen Lärm, der mit zunehmender
Drehzahl immer stärker wurde. Das Zahnrad musste ersetzt werden, bevor ein
Zahn abbrechen konnte.
Die
Drehmomentpulsation
hatte ihren Schrecken verloren, auch wenn der Effekt für die mitfahrenden
Leute nicht angenehm war. Eliminieren konnte man das Problem nur mit neuen
Triebmotoren
und die waren teuer.
Das wusste man in den Werkstätten der BLS-Gruppe
ganz genau. Denn es kam zu Beginn auch zu grossen Schäden an den
Fahrmotoren.
Wer nun aber die Schuld der
Drehmomentpulsation
in die Schuhe schiebt, liegt falsch. Das Problem war, dass diese zu heiss
wurden und so die
Isolation
schmolz und dann war der
Kurzschluss
sicher. Eine aufwändige Reparatur des Motors war die Folge davon und das
war oft der Fall.
Man erkannte, dass die
Ventilation
der
Fahrmotoren
unzureichend bemessen war. Durch die vorhandene
Eigenventilation
wurde sehr viel aufgewirbelter Schmutz zu den
Triebmotoren
geführt. Auch die seitlichen Ansaugöffnungen im Dachbereich führten immer
wieder Schmutz mit. Insekten, die in den Luftstrom gerieten, machten im
Fahrmotor reichlich Ärger. Ärger, den man nicht so leicht loswerden
konnte.
Die unzureichende
Leistung der
Ventilation
musste man
notgedrungen hinnehmen. Jedoch wurde die Ventilation beim Modell für die
GBS verändert. So konnte er auch hier profitieren und das führte dazu,
dass die beiden vorhandenen
Triebwagen diesem Modell angepasst wurden. Die
Ventilation lief etwas besser und die Motoren hielten länger durch, was
letztlich auch dazu führte, dass sich der Einsatz deutlich besserte.
Der
Grund waren die anderen aerodynamischen Ge-setze bei der leicht höheren
Geschwindigkeit. Der Luftbezug fand dort statt, wo durch die Bugwelle ein
Unterdruck entstand. Bei der BLS-Gruppe mit 110 km/h ging das gerade noch.
Die restlichen Bauteile funktionierten jedoch von
Beginn an zuverlässig, was aber nicht viel bringt, wenn die
Fahrmotoren
ausfallen. Nachdem die Massnahmen beim Modell der GBS erfolgreich waren,
wurde die Modelle der BN angepasst. Es waren nun drei identische
Triebwagen vorhanden und das galt auch für die Farbgebung, denn die
Triebwagen der BN wurden auch hier übernommen. Der Grund lag beim
erforderlichen Neuanstrich.
Alle beim Modell für die GBS gemachten Anpassungen zur
Reduktion des Gewichtes, wurden auch bei den
Triebwagen der BN umgesetzt.
Dabei waren hier nicht Probleme die Ursache, es wurde wirklich versucht,
aus den drei Fahrzeugen eine Serie zu machen. Gerade bei
Privatbahn war
das immer wieder gemacht worden. Ab jetzt müssen wir die drei Fahrzeuge
nicht mehr unterscheiden, es wurden alle geändert.
Eine erste Veränderung die alle drei
Triebwagen betraf,
erfolgte jedoch nur wenige Monate nach der Ablieferung des Ce 4/4 mit der
Nummer 763 an die Gürbetal – Bern – Schwarzenburg Bahn GBS. Die Schweizer
Bahnen hatten unter der Führung der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
beschlossen, die erste
Wagenklasse
ab dem Jahre 1956 aufzuheben und nur
zwei
Gruppen zu führen. Diese wurden zudem angehoben.
Für die drei
Triebwagen bedeutete das, dass sie zu Be 4/4 wurden und dass die
ver-chromten Ziffern drei durch aufgemalte Zah-len ersetzt wurden. Diese
Vereinfachung bei der Anschrift der
Wagenklassen führte jedoch zu keinem
Nachteil. Nach einigen Jahren ging es an den Umbau der Druckluftbremsen. Bei der Lieferung wa-ren die Ventile nach Westinghouse eingebaut worden. Diese arbeiteten mit der Technik vor 60 Jahren und waren daher nicht mehr zeitge-mäss. Zudem wurde bei den Wagen die Regu-lierbremse ausgebaut.
Das nahm man zum Anlass, den Umbau vorzu-nehmen. Es sollte eine
bessere Bedienung zu Folge haben. Wir müssen genauer hinsehen.
Die
Rangierbremse der drei
Triebwagen, die bisher mit
einem
Regulierbremsventil nach
Westinghouse bedient wurde, wurde mit einem
neuen
Ventil
ausgestattet. Dabei kam ein Rangierbremsventil aus dem Hause
Oerlikon zum Einbau. So bekam diese
direkte Bremse eine zum verwendeten
Namen passenden Bezeichnung. Die an den
Stossbalken montierten
Luftleitungen für die
Regulierbremse wurden ebenfalls entfernt.
Bei der
automatischen Bremse
konnten sich die Chefs nun
vom
Führerbremsventil
W4
nach
Westinghouse verabschieden. Die bei den
schweizerischen Bundesbahnen SBB aus dem Hause Oerlikon Bremsen
eingesetzten
Ventile
waren einfach zu gut. Nur konnte sich die
BLS nicht dazu durchringen, das Modell
FV4a
der
Staatsbahnen zu
übernehmen. Es wurde das Führerbremsventil FV5 eingebaut, das keinen
Hochdruckfüllstoss hatte.
Führte nun ein Fahrzeug der
Staatsbahnen den Zug,
durfte der
Hoch-druckfüllstoss nicht angewendet werden. Das
Triebfahrzeug
der BLS war dabei das einzige Fahrzeug, das damit Probleme bekam. Erneut ging es an die Ventilation. Die Kühlung der Fahrmotoren war immer noch nicht zureichend. Die Modelle der Staatsbahnen hatten auf die Eigenventilation verzichtet und gerade die Serie funktionierte sehr gut.
Die drei hier vorgestellten Fahrzeuge wurden daher
endlich der
Eigenventilation beraubt. Bei den
Ventilatoren
erfolgte eine
andere Ansteuerung. Die Umschaltung auf die volle
Leistung erfolgte
früher. Wer wirklich aufmerksam war, der hatte erkannt, dass es noch einen Unterschied gab. Die drei Triebwagen besassen unterschiedliche Hauptschalter.
Mit dem neuen
Hauptschalter auf den
Triebwagen der BN konnte nun
auch bei diesen das geringere Gewicht des Modells der GBS genom-men werden.
Es war nun endlich die kleine Serie vorhanden. Jedoch war das nur mit
scheinbar nebensächlichen Umbauten möglich geworden.
Die nun wirklich einheitlichen
Triebwagen passten
bisher nie sonderlich zu den grünen
Einheitswagen. Jedoch auch nicht zum
Anstrich der Reihe
ABDe 4/8. Daher wurden die drei Triebwagen 1968 mit
einem neuen schlichten Anstrich in dunkelgrün versehen. Gleichzeitig
entfernte man auch die Chrombuchstaben und ersetzte die Bahnanschriften
durch aufgemalte Buchstaben. Damit passten die Triebwagen endlich zu den
Reisezugwagen.
Technisch
wäre das nun möglich gewesen, den mit dem Umbau der
Bremsen wurde die
Apparateleitung
zur
Speiseleitung und wurde zu den beiden
Stossbalken
geführte. Der Betrieb mit
Steuerwagen
war nun kein Problem mehr.
Die bisher in der Grösse gleich grosse Lampe für den
Zugschluss wurde nun verkleinert und zudem mit einem
Sonnendach
versehen.
Das Sonnendach sollte verhindern, dass durch Reflektionen falsche
Signalbilder
gezeigt würden. Die rote Lampe leuchtete nur noch, wenn sie
durch den Lokführer eingeschaltet wurde. Das führte dazu, dass die
Front
etwas eleganter wirkte, aber immer noch nicht symmetrisch war.
Zusätzlich wurde das bisher silberne
Übergangsblech an
der
Front
grau gestrichen. Damit sollte das markant hervorstechende
Übergangsblech etwas getarnt werden. Besonders bei diesen
Triebwagen fiel
das Blech deutlich auf und konnte eine farbliche Behandlung gebrauchen.
Gerade hier wurde mit den Modellen der Reihe
RBe 4/4 der
Staatsbahnen
verglichen, wo das markante Blech nicht vorhanden war und optisch nicht so
störte.
Hilfreich
war diese Nummer für das Personal, denn man konnte nun direkt erkennen,
welche Nummer es war. Bisher musste in der Seitenwand angesucht werden.
Dort war nur noch eine Stelle mit der Nummer versehen worden. Nur wenige Jahre später wurde die dritte rote Lampe an der Front montiert. Damit konnten die Triebwagen das von den schweizerischen Bundesbahnen SBB eingeführte Warnsignal mit drei roten Lampen ebenfalls zeigen.
Erstmals hatten die drei
Triebwagen nun ein
symmetrisches Lampenbild bekommen. Montiert wurde es jedoch nicht
freiwillig. Das
Warnsignal wurde nun national als
verbindlich genannt und
galt auch auf der BLS. Im Laufe der Jahre, stellten die schweizerischen Bundesbahnen SBB fest, dass die Zugsicherung, die nur Warnung und freie Fahrt übertragen konnte, ungenügend war. Schwere Unfälle zeigten den Mangel deutlich auf.
Bisher war es dem Lokführer problemlos möglich,
ein rotes Signal zu passieren und danach ganz normal weiter zu fahren. Die
Zugsicherung war daher mangelhaft und musste nun verbessert werden.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB begannen damit,
die Signale mit einer neuen Zusatzfunktion auszurüsten. Diese sorgte
dafür, dass die Magnetfelder an der äusseren
Spule
nun umgedreht werden
konnten. Das hatte aber zur Folge, dass die Einrichtungen auf den
Fahrzeugen, die mit der
Zugsicherung ausgerüstet waren, angepasst werden
mussten. Die Empfänger mussten für diese
Haltauswertung die Polung der
Magnetfelder erkennen können.
Diese Massnahme betraf auch die Fahrzeuge der
BLS-Gruppe und somit diese drei
Triebwagen. Die
Zugsicherung wurde daher
mit der
Haltauswertung nachgerüstet. Dazu wurden im
Führerstand neue
Quittierschalter und eine Taste zur Umgehung im
Rangierdienst, oder bei
Störungen eingebaut. Damit waren die sichtbaren Veränderungen bereits
vorhanden, die restlichen Veränderungen betrafen nur die Elektronik.
Auf dem
Registrierstreifen und auf der
Farbscheibe
als
Restwegaufzeichnung wurde zudem eine spezielle Markierung gesetzt. Damit
war sogar eine Aufzeichnung der
Haltauswertung vorhanden. Die vorgesetzten
Stellen konnten so erkennen, ob das Signal wirklich rot zeigte. Der
Fahrtverlauf konnte nach Unfällen bis zum letzten Augenblick aufgezeigt
werden. Diese Aufzeichnung konnte so zur Aufklärung des Vorfalls
beitragen.
Um die
Zwangsbremsung wieder zu lösen und um den
Hauptschalter wieder einschalten zu können, war im Schrank mit den
Relais
eine entsprechende Taste montiert worden. Dort befand sich zugleich auch
die Taste, die zum Prüfen der
Haltauswertung notwendig war. Diese Prüfung
musste am Morgen vor der ersten
Zugfahrt erfolgen. Da der Lokführer ja
dazu nicht absichtlich ein rotes Signal überfahren sollte, baute man diese
Simulation ein.
Mit der aktuellen Form der
Zugsicherung und den
geänderten
Bremsen war aus den drei
Triebwagen ein modernes Fahrzeug
entstanden. Auch wenn diese Umbauten zeigten, dass die Fahrzeuge nicht
mehr neu waren. Die
Bauart war so wegweisend, dass es viele Nachkommen
gab. Ein Manko war die
Zulassung, denn die drei Triebwagen konnten nicht
nach der
Zugreihe R verkehren, da die Kräfte im
Gleis zu hoch waren.
Man kann hier jedoch erwähnen, dass die Massnahmen
sehr gering waren, denn die
Drehgestelle wurden schon bei der Reihe
RBe 4/4 der
Staatsbahnen verwendet und erfüllten dort die Kriterien zur
Zugreihe R.
Die Be 4/4 der BLS-Gruppe behielten jedoch die bisherige Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h bei, obwohl tech-nisch mit den Drehgestellen sogar 125 km/h möglich ge-wesen wären.
Dazu hätten aber die
Getriebe verändert werden müssen, denn eine Erhöhung der Geschwindigkeit
war nur auf Kosten der
Zugkraft möglich. Daher beliess man die
Höchstgeschwindigkeit der
Triebwagen bei 110 Km/h und konnte von der
grossen Zugkraft profitieren.
Trotz der
Zulassung zur
Zugreihe R, gab es keine neue
Bezeichnung. Auch hier war klar, dass diese nicht zu erfolgen hatte. Die
Bezeichnung R bekamen nur Fahrzeuge, die schneller als 110 km/h verkehren
konnten und die zur Zugreihe R zugelassen waren. Der Be 4/4 der BLS-Gruppe
war dazu aber mit 110 km/h zu langsam und durfte daher richtigerweise gar
nicht als RBe 4/4 bezeichnet werden. Wobei die BLS-Gruppe das R nicht
immer führte.
Damit endeten aber die Umbauten und Verbesserungen an
den drei
Triebwagen. Die Fahrzeuge waren einfach zu alt geworden, dass
sich ein grosser Umbau noch gelohnt hätte. Nötig war dieser auch nicht
mehr, denn die Modelle waren gut aufgestellt und nachteilig wirkte nur der
Komfort. Auf eine Modernisierung wurde bei der BLS-Gruppe jedoch
verzichtet. Hier war man diesbezüglich immer etwas zurückhaltend.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Mechanisch
fanden sich die grössten Probleme bei den
Mechanisch
fanden sich die grössten Probleme bei den
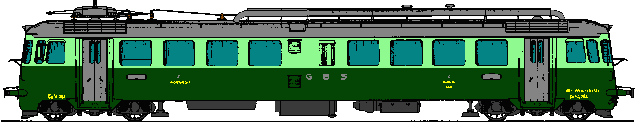 Das
Problem wurde mit einer gefederten
Das
Problem wurde mit einer gefederten
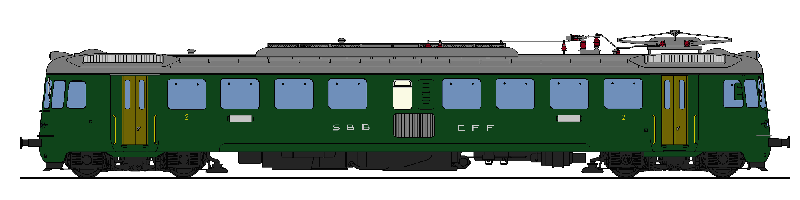 Wie gross das Problem war, zeigten erst die
Wie gross das Problem war, zeigten erst die  Das führte dazu, dass die dritte
Das führte dazu, dass die dritte
 Probleme sollten diese unterschiedlichen
Probleme sollten diese unterschiedlichen
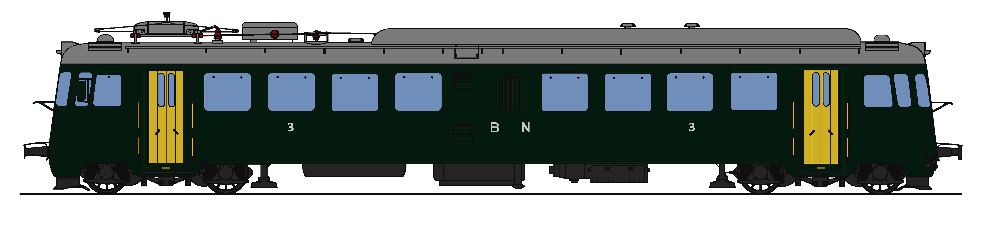 Nur der fehlende
Nur der fehlende

 Überfuhr nun ein Zug ein Signal das Halt zeigte, ohne
die
Überfuhr nun ein Zug ein Signal das Halt zeigte, ohne
die  Der letzte grössere Umbau der
Der letzte grössere Umbau der