|
Laufwerk mit Antrieb |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wirklich einfach wird es bei diesen
Triebwagen
beim
Laufwerk.
Diese entsprach den Modellen
RBe
4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Moment, es
war ja umgekehrt und daher kommen wir nicht um das
Fahrwerk
herum. Doch auch dann wird es nicht allzu schlimm. Die
Achsfolge
Bo’ Bo’ lässt das schnell erkennen, denn es waren zwei Identisch
aufgebaute
Drehgestelle verwendet worden. Daher sehen wir uns eines
davon an.
Dank diesen
Schweissverbindungen
konnten die hohen hier auftretenden Kräfte abgefangen werden. Vom Aufbau
her wurde der
Drehgestellrahmen
als ein geschlossenes H aus-geführt. Eine Bauweise, die sehr gut für diese
Lösung ge-eignet war. Die beiden Längsträger wurden mit dem mittleren und kräf-tigen Hauptträger verbunden. Seitlich verbanden die End-traversen die Längsträger. So waren diese sehr gut ge-halten.
Gerade diese Endträger waren ein Merkmal der
Drehgestelle nach der
Bauart
SIG. Dank den so möglichen leichten Längsträger konnte sehr viel Gewicht
eingespart werden. Beispiele dafür waren die
Leichtstahlwagen
und die hier vorgestellte
Baureihe. Genauer ansehen müssen wir uns dabei nur den Querträger, der gegen die Mitte des Fahrzeuges angeordnet wurde. Hier wurde der Halter für den Sendemagnet und die seitliche Sonde für den Empfang befestigt. Diese gehörten zur Zugsicherung nach Integra-Signum und sie war bei der BLS-Gruppe nur bei Fahrzeugen vorhanden, die auf Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkehrten, denn dort war diese vorhanden.
Im
Drehgestell
eingebaut wurden auch die beiden
Achsen.
Diese waren in einem Abstand von 3 000 mm angeordnet worden. Jede
Achswelle
war geschmiedet worden und bestand aus Stahl. Diese hochfesten Bauteile
waren auf den beiden Seiten mit den Aufnahmen für die beiden
Räder
und die aussen liegenden
Lager
versehen worden. Um den
Radsatz
abzuschliessen, müssen wir uns daher noch die Räder ansehen.
Spannend dabei ist, dass damals bei den Wagen be-reits die
leichten
Monoblocräder
verwendet wur-den. Hier verzichtete man wegen dem Verschleiss der
Laufflächen. Als Verschleissteil wurde auf dem Radkörper die Bandage aufgezogen. Dabei galt für den Radreifen der gleiche Grundsatz. Die Bauteile wurden nur kraftschlüssig verbunden.
Dazu wurde mit der Schrumpftechnik gearbeitet und das reichte um
auch grosse Kräfte zu über-tragen. Probleme gab es erst, wenn das
Rad
zu stark erwärmt wurde. Damit die
Bandage
nicht abfallen konnte, wurde sie mit einem
Sprengring
gesichert. Der Radreifen konnte bis zur Markierung mit der Verschleissrille abgenutzt werden und hier waren sowohl die Lauffläche, als auch der Spurkranz ausgebildet worden.
Beide waren dem Verschleiss unterworfen und so musste der
Triebwagen
ebenfalls regelmässig zum Reifenwechsel. Wobei das natürlich nicht so
schnell ging, wie beim Auto. Das waren Arbeiten, die auch durch die
Hauptwerkstätten
ausgeführt werden mussten.
Das so fertig aufgebaute
Rad
hatte in neuem Zustand einen Durchmesser von 1 040 mm erhalten. Im
Vergleich zu den
Lokomotiven
war das gering, aber hier musste auch auf die Höhe des Fussbodens geachtet
werden. Auswirkungen hatte dieser Wert nur auf die
Achslager.
Durch den geringeren Durchmesser erhöhte sich ich bei gleicher
Geschwindigkeit die Drehzahl deutlich. Daher musste die
Lagerung
sorgsam ausgeführt werden.
Das war insbesondere auch bei hohen Geschwindig-keiten der Fall.
Das galt besonders hier, da ja beim
Triebwagen
kleinere
Räder
verbaut wurden. Die hö-here Drehzahl der
Achsen
konnte von diesen
Lagern
ohne Probleme aufgenommen werden. Auch wenn diese Rollenlager nur einen geringen Reibwert hatten, mussten sie geschmiert werden und dort lag der grosse Vorteil. In einem Gehäuse eingebaut konnten sie mit Fett dauerhaft geschmiert werden.
Die regelmässigen Kontrollen und insbesondere die zeitaufwändige
Nachschmierung konnte so entfallen. Die Wartung verlagerte sich daher in
die Werkstätten, was den Verkehr deutlich beschleunigte und so den
Fahrplan
verbesserte. Die Gehäuse der Achslager wurden mit seitlichen Schenkeln versehen. Zwischen diesen und dem Dreh-gestellrahmen wurde die Primärfeder eingebaut. Hier wurden dazu Schraubenfedern verwendet.
Diese
Federung
war dank der sehr kurzen Schwing-ungsdauer für hohe Geschwindigkeiten
ideal geeig-net. Jedoch neigte die
Schraubenfedern
dazu sich aufzuschaukeln und das konnte gefährlich werden. Doch dazu waren
nun Lösungen vorhanden.
An Stelle eines damals üblichen mechanischen
Dämpf-ers
wurden bei diesem
Drehgestell
die zur Kraftüber-tragung benötigten Achslagerführungen genutzt. Diese
waren innerhalb der
Schraubenfedern
angeordnet worden und daher waren sie schlicht nicht mehr zu erkennen. Das
zur
Schmierung
benötigte
Öl
wurde für die Dämpfung benutzt. So hatten diese
Triebwagen
eigentlich hydraulische Dämpfer, auch wenn diese anders genutzt wurden.
Dieser Kastenquerträger war letztlich mit der
Sekundärfeder
am
Drehgestell
aufgehängt worden. Dadurch war keine Abstützung, sondern eine Aufhängung
vorhanden. Die Vibrationen des Dreh-gestells gelangten nicht in den
Kasten. Um die Bewegung des Drehgestells zu erlaubten, waren für die Aufhängung am Rahmen Pendel angebracht worden. Zwischen diesen Pendeln und dem Querträger wurde die sekundäre Federung verbaut. Diese
Federung
wurde nicht mehr mit den bisher verwendeten
Blattfedern
ausgeführt. An ihrer Stelle wurden spezielle
Tor-sionsstäbe
eingebaut. Diese besassen die gleichen Eigenschaften, benötigten aber
deutlich weniger Unterhalt.
Mit den Pendeln wurde das
Drehgestell
zwar unter dem Fahrzeug zentriert, aber keine Kräfte übertragen. Damit
diese übertragen werden konnten, musste ein
Drehzapfen
verbaut werden. Dieser wurde am Boden des Kastens montiert und er griff
durch den massiven Mittelträger des Drehgestells in den darunter
eingebauten Kastenquerträger. Die hier erforderliche
Schmierung
konnte mit
Fett
erfolgen, das weniger ausgewaschen wurde.
Das so aufgebaute
Drehgestell
wurde ohne Veränderung später auch bei den
Triebwagen
RBe
4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet.
Das zeigt, dass dieses
Laufwerk
ohne Probleme auch für Geschwindigkeiten von 125 km/h geeignet war. Die
Unterschiede ergaben sich erst beim
Antrieb, den wir uns nun ansehen müssen und dabei gab es
zwischen den drei Triebwagen ebenfalls einen Unterschied.
Dabei wurde für jede
Achse
ein eigener
Fahrmotor
vor-gesehen und dieser fand von der Baugrösse her im verfüg-baren Platz
des
Drehgestells
den erforderlich Platz. Das vom Motor erzeugte Drehmoment musste mit einem Getriebe angepasst werden. So wurde die Drehzahl ver-ringert und die Kraft erhöht. Das sich am Motor befindliche Ritzel und das Zahnrad besassen eine Über-setzung von 1 : 2.484.
Das
Getriebe
war vollständig abgefedert worden. Dabei fand sich hier der Unterschied,
denn beim später ausge-lieferten
Triebwagen
war beim
Zahnrad
eine
Federung
verbaut worden. Nötig wurde diese Federung, weil die ersten beiden Triebwagen ein Problem mit dem Drehmoment hatten. Die Fahrmotoren neigten sehr stark zu einem Effekt, der Drehmomentpulsation genannt wurde.
Dieser für Reisende unangenehme Effekt, kann für die Technik
schlecht sein. Mit der
Federung
sollten diese
Stösse etwas aufgefangen werden. Es gilt jedoch zu erwähnen, dass
diese
Drehmomentpulsation
auch bei anderen
Baureihen
auftrat.
Das
Getriebe
wurde in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut. Diese diente dem Schutz,
aber auch der
Schmierung.
Dazu war unten eine
Ölwanne
angebracht worden. Das
Zahnrad
lief dabei durch das
Schmiermittel
und nahm dabei das
Öl
auf. Durch die Anhaftung wurde auch das Ritzel geschmiert. Die Fliehkraft
sorgte dafür, dass überschüssiges Schmiermittel an die Wände geschleudert
wurde und in die Wanne lief.
Dank den hier vorhandenen flexiblen Lamellen konnte die Federung der Achse ausgeglichen werden. Wichtig war, dass die Kraft dabei formschlüssig übertragen wurde.
Dabei konnte die ungefederte Masse verringert werden und in diesem
Punkt war der Hersteller nicht schlecht aufge-stellt. Das Drehmoment wurde in den Achsen mit Hilfe der Haftreibung zwischen Schiene und Lauffläche in Zugkraft umgewandelt. Diese Zugkraft gelangte über die Räder und die Achslagerführungen in das Drehgestell.
Die beiden vereinigten Kräfte wurde danach mit dem
Dreh-zapfen
auf den Kasten und so auf die
Zugvorrichtungen
übertragen. Nicht benötigte
Zugkraft
führte zur gewünsch-ten Beschleunigung des Fahrzeuges. Die beiden an die BN abgelieferten Triebwagen Nummern 761 und 762 wurden zur Verbesserung der Adhäsion bei schlechter Witterung mit Sandern ausgerüstet.
Man erhoffte sich auf den oft wegen dem Laub auf den
Schienen
recht rutschigen Strecken im Jura Verbesser-ungen. Dabei wurde der in
einem Behälter gelagerte
Quarzsand
über ein elektropneumatisches
Ventil
in das Rohr und so vor die erste
Achse
des
Triebwagens
entlassen.
Beim
Triebwagen
mit der Nummer 763 verzichtete man jedoch auf diese
Sander. Der Grund war in erster Linie, da die Wirkung
dieser Einrichtung immer wieder hinterfragt wurde. Jedoch kam hier noch
dazu, dass dieser Triebwagen leichter werden musste. Nur so konnten die
Achslasten
der GBS eingehalten werden. Dank dem Verzicht auf den
Quarzsand
konnte sehr viel Gewicht eingespart werden, denn der Vorrat entfiel.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||

 Die
Die  Für
die
Für
die  Es
wird nun Zeit, die beiden
Es
wird nun Zeit, die beiden
 Wobei
die Unterschied nicht so gross waren, dass wir sie hier näher betrachten
müssen, es war einfach eine Modi-fizierung die den Aufwand etwas
verringert. Wie das seit einigen Jahren üblich war, wurde der
Wobei
die Unterschied nicht so gross waren, dass wir sie hier näher betrachten
müssen, es war einfach eine Modi-fizierung die den Aufwand etwas
verringert. Wie das seit einigen Jahren üblich war, wurde der 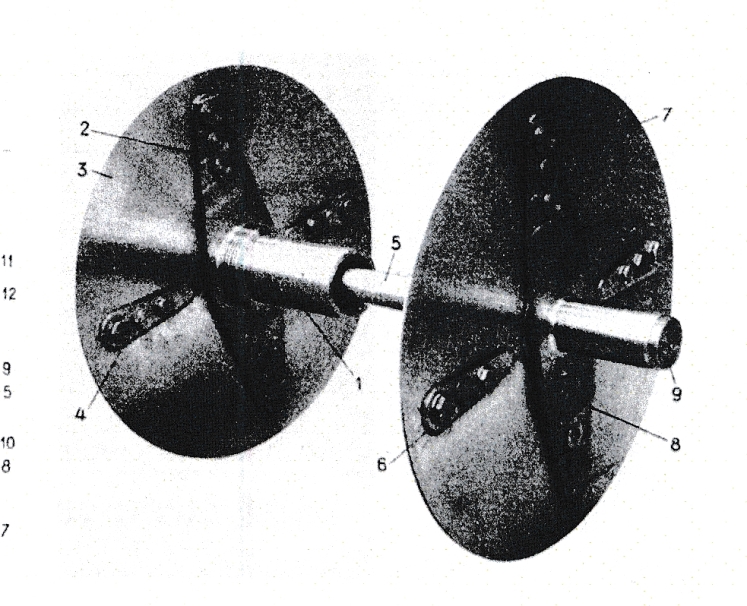 Nachdem
im
Nachdem
im