|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Eigentlich hatte man am
Gotthard gerade die Umstellung abgeschlossen, als die neuen
Lokomotiven
aus Meyrin eintrafen. Im Gegensatz zu den bereits am Gotthard vorhandenen
Maschinen konnte sie jedoch nicht umgeschaltet werden. Das war kein
Problem mehr, da die Dampflokomotiven kaum mehr zu sehen waren. Mit der
endlich durchgehend befahrbaren Strecke begannen die Einsätze der ersten
elektrischen Lokomotiven.
Sie sollten die Reisezüge übernehmen. Eine Unterscheidung der beiden Typen gab es jedoch nicht.
Die schweren
Reisezüge am Berg wurden mit zwei
Lokomotiven bespannt. Für leichtere Züge und auf den flachen
Ab-schnitten reichte eine Maschine aus. Die Bergbespannung mit zwei Lokomo-tiven führte dazu, dass die beiden Typen gemischt verkehrten. Beim oft chao-tischen Betrieb am Gotthard, kann davon ausgegangen werden, dass es auch zu Zügen mit zwei Maschinen Be 4/7 ge-kommen sein muss.
Wobei diese besondere
Bespannung durch die geringe Anzahl
Lokomotiven ausgesprochen selten eintraf. Meistens war daher
die Kombination mit
Be 4/6 zu sehen.
Richtung Norden reichte
eine
Lokomo-tive für die
Reisezüge. Da nun aber viel
Zugkraft
ungenutzt blieb, lastete man die Züge mit
Güterwagen
auf. Insbesondere die Personenzüge führten oft Wagen für die einzelnen
Bahnhöfe
mit. Jedoch gab es keine reinen
Güterzüge,
denn diese waren auf der internationalen Strecke für die
Schnellzugslokomotive
zu schwer. Sie sehen, die neue Traktion brachte spannende
Leistungen.
Güterzüge über den Gotthard gab
es mit der Reihe Be 4/7 nicht, denn die Reihe
Ce 6/8 II
«Krokodil» konnte sich dort behaupten und die schnellen
Lokomotiven konnten vor
Reisezügen besser verwendet
werden. Es waren also zu Beginn klar getrennte Dienste und der Auslauf der
neuen Lokomotiven beschränkte sich auf den
Kreis
fünf. Weiter konnte man schlicht noch nicht, weil dort die neue
Fahrleitung
noch nicht eingeschaltet war.
Bellinzona wurde dabei auch nur gewählt, weil es schlicht die einzige Hauptwerkstätte war, die bereits mit den not-wendigen Fahrleitungen versehen war.
Daher war die Zuteilung
keine grosse Überraschung. Eher überraschend waren jedoch die
regelmässigen Feder-brüche bei den
Antrieben. Als sich die Besatzungen der Be 4/7 mit der Nummer 12 502 und der Be 4/6 und der Nummer 12 322 in Erstfeld kurz nach Mitternacht mit dem Zug 70 auf den Weg in Richtung Süden machten, ahnte vermutlich noch niemand, dass es eine Fahrt ins Desaster sein würde.
Dieser 24. April 1924
sollte in die Geschichte der Eisen-bahnen der Schweiz eingehen. Doch noch
war alles im üblichen Rahmen und die Fahrt über den Gotthard verlief ohne
nennenswerte Probleme.
Als Zug 70 schon
unterwegs war, machte sich in Chiasso der Zug 51b auf den Weg in Richtung
Norden. Hinter den beiden
Lokomotiven der Reihe
Be 4/6 musste noch ein
Heizwagen
eingereiht werden, da die internationale Wagensammlung noch nicht mit
einer elektrischen
Heizung
ausgerüstet war. Auch hier war man sich sicher, dass man die Fahrt in den
Norden geniessen kann und die Fahrgäste schliefen friedlich in den Wagen.
Nachdem Zug 70 den
Bahnhof
Biasca verlassen hatte, begann der Stern zu sinken. Der
Fahrdienstleiter
meldete dem Bahnhof San Paolo die Reihenfolge der Züge und bemerkte nicht,
dass er dabei die Nummern verwechselte. Der vermeintliche
Güterzug
mit
Ce 6/8 II
war nicht vor, sondern hinter dem
Schnellzug
nach Süden. Der
Fahrplan
wollte es so, dass sich die beiden Züge exakt im Bahnhof San Paolo kreuzen
würden.
Womit der zweite Fehler
auch schon begangen wurde. Die
Weichen
standen also ab jetzt auf Kolli-sion. Nur, da war ja das
Einfahrsignal,
das ein schweres Unglück verhindern sollte. Vermutlich begann der Zug 51 b gerade in dem Moment mit der Beschleunigung in Bellinzona, als der Lokführer der Lokomotive Be 4/7 die Meldung seines Heizers «San Paolo zu» mit den Worten «Das Signal gilt nicht für uns» quittierte.
Der dritte und
folgenschwerste Fehler wurde be-gangen und nichts, aber auch nichts mehr
konnte das Inferno verhindern. Doch warum sollte der Lokführer dieser
Meinung sein, denn er schien überzeugt?
Die Situation war bis
weit in die 1990er Jahre kompliziert. Für Züge Richtung Bellinzona, also
für Zug 70 war es das erste
Einfahrsignal
von Bellin-zona. Für den
Güterzug
jedoch die
Einfahrt
San Paolo. Stimmte die Stellung des Signals nicht, musste eine Fehlleitung
angenommen werden, weil man in Richtung Bellinzona an San Paolo
vorbeifuhr. Das Signal galt also auch für Züge, die nicht in den San Paolo
fuhren.
Nur wenige Augenblicke
kam es dann auf einer
Weiche
zur frontalen Kollision der beiden Züge. Dank den geringen
Geschwindigkeiten verlief dieser Zusammenstoss noch relativ glimpflich und
vermutlich forderte dieser Teil des Unfalls kaum Opfer. Auch die
Schnellbremsen
der beiden Züge reduzierten die Energie. Jedoch war der Zug 51b für so
einen Unfall denkbar schlecht formiert worden, denn der
Heizwagen
führte zum Inferno.
Da der
Heizwagen
des Zuges 51b umstürzte, geriet er in Brand und das beim unmittelbar
folgenden
Personenwagen
austretende
Gas
der
Beleuchtung
entzündete sich. Der deutsche Wagen brannte in der Folge vollständig aus.
Darin starben letztendlich 21 Menschen und das Unglück wurde zu einem der
schwersten Unglücke in der Schweiz. Sehr viele Fehler und eine
unglückliche Kombination, die viele neue Gesetze verursachen sollte.
Daraufhin wurden in der
Schweiz
Personenwagen
mit
Gasbeleuchtungen
verboten und auch die Vorschriften für die
Fahrdienstleiter
und
Weichenwärter
angepasst. In Zukunft sollten solche Unglücke mit der Vorschrift, dass
sämtliche
Weichen,
die zu einer
Zugsfahrstrasse
weisen, in Stutzstellung zu verbringen sind, bevor ein Signal auf Fahrt
gestellt werden darf, verhindert werden. Doch auch das Fahrpersonal wurde
besser geschult.
Dabei wurde die
Meldung
des
Heizers
verändert. Bei Zügen in Richtung Bellinzona lautete die neue Meldung
«Äussere Bellinzona zu». Nur wenn der Zug in den
Rangierbahnhof
fahren sollte, erfolgte die Meldung «San Paolo zu». Für die 21 Opfer kamen
aber diese einfachen Änderungen zu spät und die vier
Lokomotiven hatten es nicht weit in die
Hauptwerkstätte,
war diese doch am San Paolo angeschlossen worden.
Die vier schwer
beschädigten
Lokomotiven der beiden Züge wurden daher in die nahe gelegene
Hauptwerkstätte
überstellt und dort vorerst abgestellt. Die SLM in Winterthur musste für
die Maschinen mehrere neue
Führerstände
herstellen und nach Bellinzona liefern. Erst dann erfolgten die
Reparaturen und alle vier beteiligten Maschinen kamen wieder in den
Betrieb, der sich in der Zeit, wie wir nun wissen, deutlich verändert
hatte.
Die Be 4/7 hatte beim
Lokomotivpersonal
durchaus einen guten Ruf, denn die Maschine lief sehr ruhig. Vor allem
ruhiger als die Baureihe
Be 4/6, welche oft recht
bockig sein konnte, was ihr auch den nicht so schönen Übernamen «Rehbock»
einhan-delte.
Daher verwundert es kaum, dass alle sechs Ma-schinen der Reihe Be 4/7 nach Möglichkeit einge-setzt wurden. Dabei waren die Lokomotiven durchaus erfolg-reich, denn die Reihe Be 4/7 erreichten in diesen Jahren jährliche Kilometer-Leistungen von bis zu 132 000 km.
Selbst die Baureihe
Be 4/6, welche die
klassische
Schnellzugslokomotive
für den Gotthard war, er-reichte an den beiden Standorten Erstfeld und
Bellinzona nur knapp die Hälfte.
Nicht so glücklich war
die Werkstatt in Erstfeld, denn dort durfte man immer wieder die
Schraubenfedern
austauschen. Eine Arbeit, die auch die
Hauptwerkstätte
hätte machen können. Daher war man nicht so unglücklich, als die sechs
Maschinen in Erstfeld abgezogen wurden. Ab 1927 hiess die neue Heimat für
die Westschweizerin Bellinzona. Dort konnte man sich mit der
Hauptwerkstätte um die lädierten
Federn
streiten.
Auch im Jahre 1928 fand
man alle sechs Maschinen in
Dienstplänen
am Gotthard. Sie leisteten immer noch vor den
Reisezügen ihre Arbeit. Im
Gegensatz zur Reihe
Be
4/6 kamen aber kaum
Güterzüge
hinzu. Der Grund war simpel, denn die Reihe Be 4/7 hatte bei hohen
Geschwindigkeiten einer bessere Laufruhe, als das Modell der BBC. Jedoch
begann der Stern zu sinken, denn neue Maschinen übernahmen die noblen
Schnellzüge.
Die Reihe Be 4/7 wurde
in leichtere Aufgaben eingeteilt. Man erhoffte sich so eine Besserung der
vielen Brüche bei den
Federn
der
Antriebe.
Oft mussten mehrere Maschinen zur gleichen Zeit repariert werden, was
natürlich den Leu-ten nicht gefiel. Als sich 1930 am Gotthard abzuzeichnen begann, dass die zahlreichen Maschinen der Reihe Ae 4/7 durch neue gigan-tische Lokomotiven der Baureihe Ae 8/14 ergänzt werden würden, waren die alten Modelle Be 4/7 am Gotthard je länger je mehr unerwünscht.
Es verwundert daher
nicht, dass sich die ersten drei
Loko-motiven in Bellinzona verabschiedeten und in den
Kreis
I und somit nach Lausanne abwanderten. Erstmals waren die sechs
Lokomotiven getrennt worden.
Das Intermezzo in
Lausanne dauerte nur kurz. Die
Lokomo-tiven wurden nur wenige Monate später nach Bern
ver-schoben. Das
Depot
schickte sie sogleich in Wallis und damit ins Depot Brig. Die Maschinen
sollten nun auf der Simplonstrecke eingesetzt werden. Möglich war dies,
weil nun auch hier die
Fahrleitung
umgebaut worden war. Der Drehstrom hatte den Kampf mit dem
Wechselstrom
bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB verloren.
Wer es etwas kritischer
betrachtet, kann durchaus annehmen, dass niemand sichtlich Freude an der
Maschine hatte. Die Umstellung der Simplonstrecke kam daher ganz gelegen.
Ab nach Brig damit, sollen die sich um die
Federn
kümmern. Für die Maschine bedeutete das jedoch weiterhin steile
Abschnitte, was sie natürlich mit gebrochenen
Schraubenfedern
quittierte. Das
Depot
in Brig musste sich dann darum kümmern.
Die Leistungen am Gotthard waren verschwunden und wurden von der Baureihe Ae 4/7 übernommen. Trotz-dem blieben die Lokomotiven am Gotthard weiterhin häufige Gäste.
Vor allen dann, wenn
man sie der
Hauptwerkstätte
zuführte, um gebrochene
Schraubenfedern
zu er-setzen. Neu wurden die Lokomotiven auch im Jura einge-setzt. Für die steilen Strecken am Simplon gab es nun auch stärkere und schnellere Lokomotiven der Baureihe Ae 4/7.
Gerade diese sollten
die Maschinen der ersten Generation in niedere Dienste verdrängen. Diese
waren aber nicht mehr nur mit
Reisezügen besetzt, sondern
hatten füllende
Leistungen
erhalten. Solche fanden sich bei leichten
Güterzügen,
die so
Ce 6/8 II
frei stellten.
Die Aufgaben im Jura
erstreckten sich von
Reisezügen über
Güterzüge,
bis zu Hilfsleistungen, wie
Vorspann-dienste oder ähnliches. Die ehemalige
Schnellzugslokomotive
wurde zum universellen Kämpfer auf allen Ebenen. Dabei war sie ideal, denn
auch der Jura hatte seine steilen Strecken, auch wenn sie nicht so lange
waren, wie jene am Gotthard und am Simplon. Die Maschine für
Bergstrecken
war daher in ihrem Element.
Weitere Zielorte dieser
Jurafahrten, waren Basel und Olten. Die Maschinen gelangten auch immer
wieder nach Thun, wo es oft zur Begegnung mit den
Lokomotiven der Reihe
Be 6/8,
oder später
Ae 6/8, kam. Beide Lokomotiven verfügten
über den gleichen
Westinghouseantrieb.
Nur hatte scheinbar die Lokomotive der
BLS-Gruppe
weniger Probleme mit den
Federn,
als die Reihe Be 4/7. Hinzu kam noch, dass die Maschine der BLS stärker
war.
Ob man in Bellinzona
darüber froh war, kann ich nicht sagen. Nur eines war sicher, die
Maschinen Be 4/7 verschwanden am Gotthard und somit von jener Strecke,
wofür sie letztlich gebaut wurden. Nach einigen Jahren ging das auch bei
den Leuten vergessen. So wurde die Reihe Be 4/7 zu vergessenen Gotthardlokomotive. Sie sollte immer im Schatten der beiden grossen Serien Be 4/6 und Ce 6/8 II stehen. Neue Arbeit gab es in der Westschweiz und so kehrte die Westschweizerin nach nur zehn Jahren am Gotthard wieder in die Heimat zurück.
Selbst die Leute in der
Hauptwerkstätte
sprachen nun Französisch. Doch lange sollte es dort auch nicht gut gehen
und Yverdon sollte die Arbeit nicht aus-gehen. Die neue Hauptwerkstätte hatte die Lokomotiven noch nicht lange zugeteilt, als eines schönen Tages die Be 4/7 mit der Nummer 12 502 auftauchte. Die Maschine sah ziemlich mitgenommen aus. Nur was war passiert?
Die
Lokomotive legte sich am 19. Mai 1941 in Münsingen etwas
zu sehr ins Zeugs und wurde beim Unfall beschädigt. Die Leute in Yverdon
stellten die Maschine jedoch wieder her und übergaben sie dem Betrieb.
Sollte Ihnen die Nummer
bekannt vorkommen? Genau, erneut traf es wieder jene Maschine, die am 24.
April 1924 den Unglückszug führte. Es scheint fast, als hätte die Nummer
12 502 das Glück nicht auf ihrer Seite. Auf jeden Fall, wurde auch jetzt
wieder alles gerichtet und die Maschine durfte wieder auf grosse Fahrt.
Zumindest bis die
Schraubenfedern
wieder das zeitliche segneten. Ein Problem, das scheinbar nicht zu lösen
war.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Das
Das
 Dabei
waren die
Dabei
waren die
 Da
der
Da
der 
 Der
Unfall zeigt aber auch, dass die Reihe Be 4/7 zusammen mit der Baureihe
Der
Unfall zeigt aber auch, dass die Reihe Be 4/7 zusammen mit der Baureihe  Grund
dafür waren die nagelneuen Maschinen der Reihe
Grund
dafür waren die nagelneuen Maschinen der Reihe  Als
1932 auch noch die letzten drei Maschinen Be 4/7 von Bellinzona nach Bern
verschoben wurden, waren sämtliche Maschinen wieder in einem
Als
1932 auch noch die letzten drei Maschinen Be 4/7 von Bellinzona nach Bern
verschoben wurden, waren sämtliche Maschinen wieder in einem
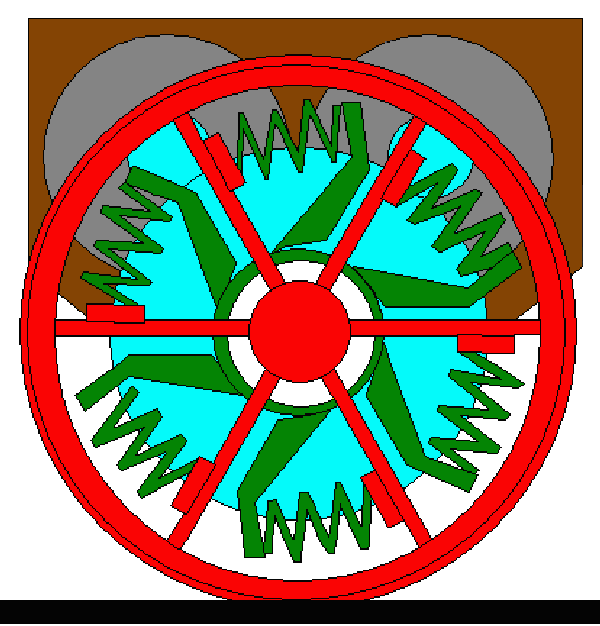 Mit
der neuen Verteilung der
Mit
der neuen Verteilung der