|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Es ist klar, dass die
Lokomotiven im Lauf der Jahre umgebaut wurden. Dabei
flossen die Erfahrungen aus dem Versuchsbetrieb bei den Änderungen ein.
Später kamen dann noch neue Erkenntnisse dazu. Anders gesagt, wurden die
beiden Maschinen immer wieder angepasst. Daher lohnt es sich, wenn wir uns
diesem Thema annehmen und so auch die Entwicklung bis zur normal
geregelten Lokomotive und den festgelegten Normen kommen.
Dieser konnte daher bei der Umstellung der
Frequenz
auf 15
Hertz
nicht mehr verwendet wer-den. Deshalb musste der Hauptgenerator abgeändert
werden. Doch bis dahin waren schon an-dere Änderungen nötig geworden.
Im Lauf der Versuche wurde die Dachausrüstung der
Lokomotive Nummer 1 mehrmals geändert. Die
Stromabnehmer
mit einer Rute und einem festen Rutenbock waren ungenügend. Deshalb baute
man zusätzliche Ruten und bewegliche Rutenböcke auf die Lokomotive. Die
Stromver-sorgung wurde somit verbessert. Noch blieb es vorderhand bei den
Rutenstromabnehmern. Warum ich dies erwähne, werden wir später noch
erfahren.
Nachdem am 10. November 1905 die Versuche mit 50
Hertz
ein Ende gefunden hatten, wurde die
Lokomotive bis zum Sommer 1906 vorerst so umgebaut, dass sie
weiterhin als Umformerlokomotive, aber nunmehr mit 15 Hertz betrieben
werden konnte. Während dieser Zeit liefen die Versuche auf der Strecke mit
der neuen zweiten Maschine. Diese war bereits entsprechend aufgebaut
worden und konnte daher eingesetzt werden. Im Jahre 1906 wurde die Lokomotive Nummer 1 von einer Umformer- in eine Direktmotorlokomotive analog der Nummer 2 umgebaut. Wer nun erwartete, dass Gleichrichter verbaut wurden und mit den gleichen Motoren eine Gleichrichterlokomotive entstand irrt sich. Der Grund dafür war simpel, denn es gab schlicht noch kleine brauchbaren Gleichrichter und die neuen Motoren waren gut.
Der mechanische Teil wurde nur soweit geändert, als dies zur
Aufnahme der grundlegenden neuen elektrischen Ausrüstung nötig war. Das
Laufwerk
und der unsymmetrische Kasten mit nur einem Endführerstand blieben deshalb
erhalten. Dadurch verschwand jedoch die spezielle Technik endgültig von
der
Lokomotive.
Für diese
Bügelfahrleitung
wurde auf dem Dach ein neu-artiger SSW-Bügelstromabnehmer benötigt. Dieser
war in einem hölzernen Rahmen montiert worden und ergänzte die bisherigen
Ruten der ursprünglichen
Fahrleitung
im Raum Seebach. Alle Stromabnehmer waren immer noch mit Druckluft an-getrieben. Auf dem Dach befanden sich neu jedoch eine sogenannte Hörner-Blitzschutzvorrichtung und in einem Kasten eine Induktionsspule.
Hier waren bei der
Lokomotive Nummer 1 bereits Ele-mente der Maschine Nummer 2
eingebaut worden. Deutlicher konnte man den Vorteil dieser Einrichtungen
nicht unter Beweis stellen. Eine Tatsache, die immer wieder angewendet
werden sollte. Die Maschine erhielt, wie die Lokomotive Nummer 2, ein-en Hauptschalter mit pneumatischer Betätigung. Es wur-den zudem zwei Transformatoren mit je einem Trenner eingebaut.
Die Regelung der
Spannung
besorgte nun eine
Batterie
von 16 elektromagnetischen
Schützen
mit zusätzlicher
Über-schaltdrosselspule,
die von einem
Steuerkontroller
im
Führerstand
aus betätigt wurden. Die
Schützensteuerung
hatte somit bereits Einzug gehalten.
Auch der
Wendeschalter
wurde vom
Führerstand
aus mittels
Druckluft
umgelegt. Es kamen achtpolige
Fahrmotoren
offener
Bauart
ohne Fremdventilation zum Einbau. Die Schaltung als
Reihenschlussmotor
mit phasenverschobenem Wendefeld war genial einfach. Zudem zeigten sie bei
der
Lokomotive mit der Nummer 2 sehr gute Eigenschaften. Sie
bewährten sich und waren ausgesprochen zuverlässig, was für die weitere
Verwendung sprach.
Neu wurden auch etwas umfangreichere
Hilfsbetriebe
bei der
Lokomotive Nummer 1 vorgesehen. Dabei war immer noch der
Kompressor
vorhanden, der für die notwendige
Druckluft
sorgte. Jedoch wurde nun an der Leitung auch ein
Widerstand
angeschlossen. Dieser diente zum Heizen des offenen
Führerhauses.
Die von der Technik abgegebene Wärme reichte hier schlicht nicht aus, so
dass man mit der
Heizung
etwas nachhelfen musste.
Deutlich verändert hatte sich auch der Klang. Das heulende
Geräusch des
Umformers
war schlicht verschwunden. Wenn sich nicht der
Kompressor
mit seinen Geräuschen bemerkbar machte, war von der eingeschalteten
Maschine lediglich ein leises Brummen des
Transformators
zu hören. Eine ruhigere
Lokomotive gab es eigentlich nur mit der Nummer 2, die sich
hier jedoch nicht von der umgebauten Nummer 1 unterschied.
Auch jetzt war noch keine
Batterie
vorhanden. Die
Spannung
für den nun benötigten Steuerstrom wurde über passende
Anzapfungen
am
Transformator
entnommen. Dabei kamen drei unterschiedliche Spannungen zur Anwendung. Mit
140
Volt
wurden mit dem
Kompressor
und der Führerstandsheizung die
Hilfsbetriebe
versorgt. Die
Schützensteuerung
benötigte für den Betrieb 90 Volt, während sich die
Beleuchtung
mit bescheidenen 20 Volt zufriedengab.
Nicht elektrisch betrieben wurden jedoch die Stirnlampen, da diese
auch leuchten mussten, wenn die Maschine ausgeschaltet war. Daher wurden
hier weiterhin die Lampen mit Kalzium-karbid verwendet. Interessant wird der Umbau erst, wenn man die technischen Daten der Lokomotive vergleicht. Es zeigt deutlich, wie schnell sich in jener Zeit die elektrischen Maschinen entwickelt hatten. So sank zum Beispiel das Gewicht der Lokomotive von 48 Tonnen auf neu 40.5 Tonnen.
Dabei konnte die
Lokomotive jedoch eine um 76 kW oder 100 PS höhere
Leistung erbringen. Viel gewonnen wurde, weil der schwere
Umformer
verschwunden war. Die Bedienung der Lokomotive Nummer 1 änderte sich durch den Umbau schlagartig. Die jetzt verwendeten Bedien- und Anzeigegeräte, entsprachen denen, anderer Lokomotiven jener Zeit, also der Lokomotive Nummer 2 und der neu dazu gekommenen Maschine von Siemens mit der Nummer 3. Die Geschwindigkeit wurde dabei nicht mehr über zwei Widerstände, sondern durch einen einzigen Steuerkontroller geregelt. Der Steuerkontroller schaltete dabei die entsprechen Fahrschütze oder, wie man bei der Bahn auch sagt, die Hüpfer.
Die
Lokomotive hatte daher eine klassische
Hüpfersteuerung,
wie sie später oft verwendet wurde, erhalten. Damit war sie sogar
einfacher aufgebaut worden, als die Nummer 2. Diese wurde in der Folge in
diesen Punkten auch angepasst. Somit waren technisch gesehen, zwei
identische Maschinen vorhanden. Die Lokomotiven wurden nun auch bezeichnet. Während man anfänglich sehr diskret das Logo der MFO und die Fahrzeugnummer angeschrieben hatte, erfolgte nun die Anschrift deutlicher, wobei auch die Versuchsstrecke angeschrieben wurde.
So kam es, dass die
Versuchslokomotiven
mit Seebach – Wettingen angeschrieben waren, obwohl es eine Strecke der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB war. Dies zeigt deutlich, dass die Züge
unter der Leitung der MFO verkehrten.
Die grössten Veränderungen gab es an beiden
Lokomotiven erst wieder nach dem Versuchs-betrieb.
Dieser endete erfolgreich am 3. Juli 1909. Der Grund dafür war die
Einschaltung der
Fahrleitung
zwischen Spiez und Frutigen, womit man auf diese Strecke im Raum Zürich
verzichten konnte. Die Lokomotiven der MFO wurden daraufhin auch nicht
mehr benötigt und abgestellt. Sie sollten keine weitere Verwendung mehr
finden.
Die Erfolge mit den beiden ersten
Lokomotiven flossen dabei in deren Konstruktion
ein. Neu orientierten sich die Versuche auch an der Entwicklung der
Triebfahrzeuge
und dabei fielen die ersten elektrischen
Triebwagen
für dieses System auf. Als die Schweizerischen Bundesbahnen SBB 1919 mit der Elek-trifizierung ihrer Strecken begann, kamen die beiden Lokomo-tiven aus dem Versuchsbetrieb zu den Staatsbahnen, wo sie für den Rangierdienst und leichte Züge benutzt werden konnten.
Nötig war dies in erster Linie, weil man schon einen Betrieb
auf-ziehen wollte, als die bestellten
Lokomotiven schlicht noch nicht vorhanden
waren. Da kamen die beiden abgestellten Maschinen gerade recht.
Damit dieser Einsatz jedoch möglich wurde, mussten die beiden
Lokomotiven jedoch grundlegend umgebaut
werden, wobei bei der Steuerung nur die Maschine Nummer 2 betroffen war.
Diese erfolgte auch hier nun mit den
Schützen
und einer eigenen Steuerspannung. Doch damit sollten die Veränderungen
nicht abgeschlossen sein. Die weiteren Anpassungen betrafen jedoch beide
Lokomotiven und daher müssen wir etwas genauer hinsehen.
Die
Stromabnehmer
aus dem Versuchsbetrieb wurden schlicht entfernt und es kam ein
Scherenstromabnehmer
auf die beiden
Lokomotiven. Dieser hatte zuerst
noch einfache
Schleifleisten erhalten, wurde später aber mit einer
doppelten Schleifleiste ausgerüstet. So war nun eine übliche Stromabnahme
ab der
Fahrleitung
vorhanden, so dass die Lokomotiven mit der nun vorhandenen Fahrleitung
funktionierten und daher eingesetzt werden konnten.
Durch die Reduktion der Breite des
Stromabnehmers,
beziehungsweise des
Schleifstückes,
bei der BLS und damit auch bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB
konnten aufwendige Erweiterungen bei den Anlagen verhindert werden. Erstmals erhielten die Lokomotiven nun Batterien eingebaut. Diese erlaubten eine elektrische Beleuchtung auch bei den Stirnlampen und dank dem nun vorhandenen Bordnetz auch einen Betrieb der Steuerung bei ausgeschalteter Maschine.
Somit verfügten nun beide
Lokomotiven erstmals über
elektrische Lampen. Jedoch auch über ein übliches
Bordnetz
mit
Gleichstrom,
das jedoch immer noch sehr wenige Verbraucher hatte.
Weiter wurden die beiden
Lokomotiven mit einer elektrischen
Zugsheizung
ausgerüstet. Diese war bisher nicht vorhanden, weil sie nicht benötigt
wurde. Sie erlaubte nun auch die angehängten
Reisezugwagen
zu heizen. Diese
Heizung
bedingte lediglich neue
Anzapfungen
an den vorhandenen
Transformatoren,
die deshalb entsprechend umgebaut wurden. Im
Führerstand
waren neu auch die entsprechenden Bedienelemente vorhanden.
Neben der Vereinheitlichung der Steuerungen auf der
Lokomotive Nummer 2 erfolgte noch
ein Umbau der Wendepolshunts, diese wurden zur besseren
Kühlung
auf dem Dach der Maschine montiert. Womit wir eigentlich schon fast alle
Änderungen behandelt haben. Somit gab es auch jetzt noch keinen
Ventilator
auf den beiden eigenartigen Lokomotiven. Die
Leistung wurde auch nicht gesteigert und die
Anpassungen waren eigentlich eher bescheiden.
Durch die Übergabe an die Schweizerischen Bun-desbahnen SBB verschwanden die bisherigen Be-zeichnungen MFO 1 und 2. Die Lokomotiven wurden nun nach dem Schema der Staatsbahnen bezeichnet. Die Maschinen er-hielten deshalb die neue Bezeichnung Fc 2x 2/2 und die Nummern 12 101 und 12 102.
Der Schriftzug Seebach – Wettingen verschwand, jedoch wurden
keine Bahnanschriften an-gebracht, so dass die
Lokomotiven wieder sehr neutral
war-en.
Nur ein Jahr später war dann die Bezeichnung endgültig umgestellt,
so dass wir nun von den Ce 4/4 Nummer 13 501 und 13 502 sprechen können.
Dabei fehlten die Bahnanschriften bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
die ganze Zeit. Dazu muss aber gesagt werden, dass die
Staatsbahnen
diese lange Zeit nicht angebracht hatten, denn erst mit den
Lokomotiven der Reihe
Re 4/4 begann man mit
den Bahnanschriften bei Lokomotiven.
Nachdem die neuen
Lokomotiven an die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden, verdingten sich die beiden Maschinen
als
Rangierlokomotiven.
Dieser Einsatz war zur geringen
Leistung passend, führte jedoch auch
dazu, dass die zwei Exoten nie grundlegend umgebaut wurden. Es sollten in
all den Jahren lediglich Änderungen und Anpassungen erfolgen. Mit
zunehmendem Alter wurden diese jedoch selten.
Somit gab es erst wieder Anpassungen in einer Zeit, wo die beiden
Maschinen bei den
Staatsbahnen
verschwunden waren. Sie kamen in der Folge zu anderen Bahnen, die dabei
lediglich die Anschriften und Nummern änderten. Erst ganz zum Schluss
erfolgten wieder die Anpassungen an den Versuchsbetrieb, aber damit wurden
die
Lokomotiven ausgemustert und für
die Zukunft in einem Museum vorbereitet. Ein Umbau, der keinen Betrieb der
beiden Maschinen mehr erlaubte.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
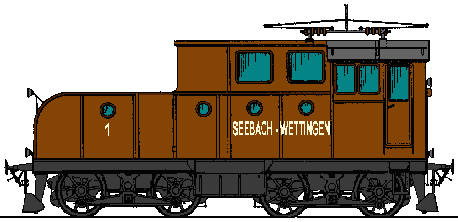 Anfänglich
war von den Veränderungen nur die
Anfänglich
war von den Veränderungen nur die
 Die
erste Veränderung, die beide
Die
erste Veränderung, die beide
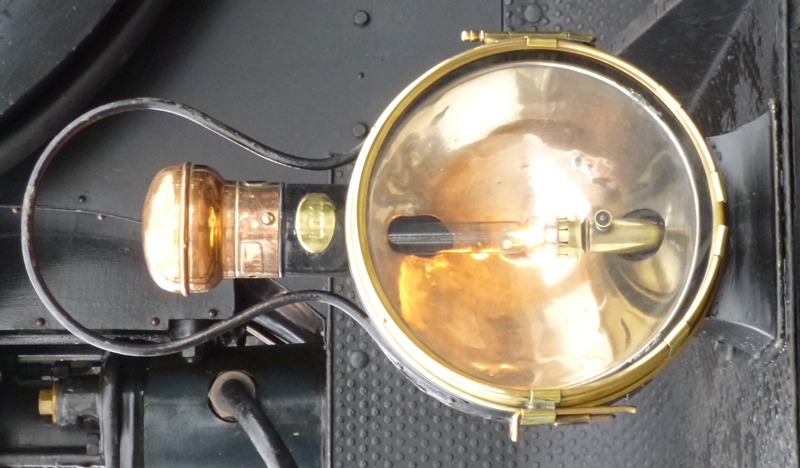 Es
war nun eine elektrische
Es
war nun eine elektrische 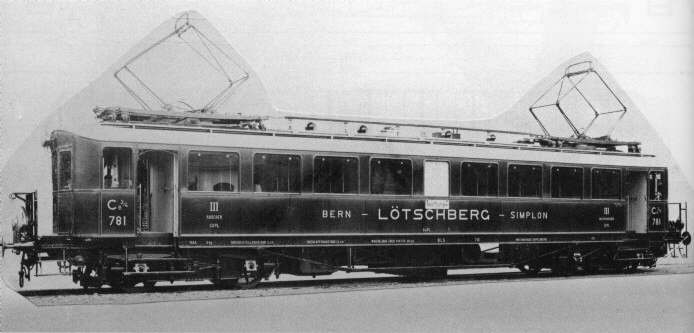 Wir
müssen bedenken, dass die nun im Berner Oberland erprobten Maschinen
deutlich mehr
Wir
müssen bedenken, dass die nun im Berner Oberland erprobten Maschinen
deutlich mehr
 Speziell
war da der vorhandene SSW-Bügel. Dieser hätte zwar zur
Speziell
war da der vorhandene SSW-Bügel. Dieser hätte zwar zur 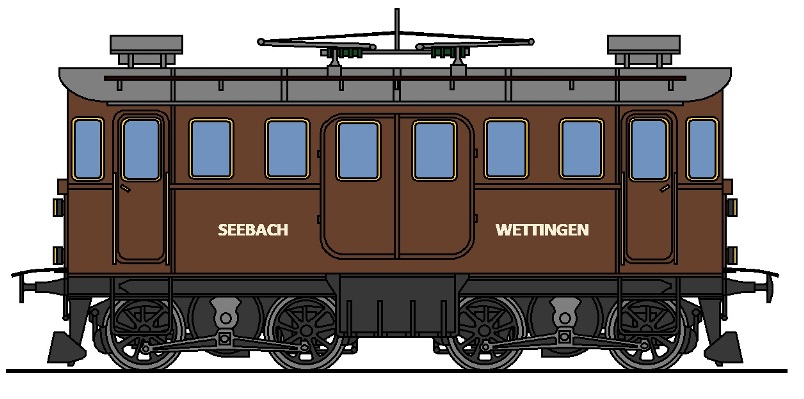 Was
nicht vergessen werden darf, die beiden Maschinen wurden nun mit einer
Was
nicht vergessen werden darf, die beiden Maschinen wurden nun mit einer