|
Der Versuchsbetrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Eigentlich sind die Inbetriebnahmen von neuen
Lokomotiven immer eine spannende Angelegenheit. Das ändert sich
hier nicht. Im Gegenteil die Lokomotiven MFO 1 und MFO 2 waren reine
Versuchslokomotiven,
die zur Erprobung eines kompletten Systems zwischen
Fahrleitung
und Fahrzeug dienten. Daher ist mit der
Inbetriebsetzung
eigentlich in erster Linie der Versuchsbetrieb gemeint. Aus diesem Grund
sehen wir uns diesen genauer an.
Die
Inbetriebsetzung
einer
Lokomotive läuft eigentlich immer nach einem bestimmten Muster
ab. Nach Versuchen im Werk kommen die ersten Fahrten unter Aufsicht des
Herstellers und dann die Übergabe an die Bahn, welche das Fahrzeug
bestellt hat. Bei den beiden hier beschriebenen Maschinen war das jedoch
nicht so, denn hier musste schlicht alles erprobt werden. Daher dauerte es
auch sehr lange, bis die Lokomotiven planmässig eingesetzt werden konnten.
Nicht nur die
Testfahrten
für die
Lokomotiven mussten durch die MFO durchgeführt werden, denn die
Firma war sogleich auch für die Versorgung und Ausrüstung der Strecke
zuständig. Das hiess deshalb auch, dass man Systemprobleme lösen musste.
Diese Probleme waren danach nicht mehr vorhanden, da man ja auf den
Erfahrungen mit diesen beiden Lokomotiven aufbauen konnte. Die
Inbetriebnahme konnte anschliessend vereinfacht werden.
Zumal dieses nun beim Fussballplatz steht, da Sie ja nicht zum Haus fahren können. In der Folge passen Sie die Zufahrt an den neuen Wagen an.
Sie haben somit die Strecke dem neuen Fahrzeug ange-passt. Das ist
beim Versuchsbetrieb nicht viel anders abgelaufen. Bei den hier vorgestellten Lokomotiven war das eigent-lich nicht komplett anders. Die Fabrik der Maschinen-fabrik Oerlikon MFO war mit dem elektrischen Netz der Stadt Zürich verbunden.
Dabei wurde diese Energie zur
Beleuchtung
der Hallen und der Plätze genutzt. Weitere Arbeiten umfassten je-doch die
häufigen Versuche mit den entwickelten elek-trischen Maschinen. Dazu
gesellten sich auch die Bau-gruppen für die
Lokomotive.
Irgendwann im Jahre 1903 wurde die
Lokomotive in den Hallen der MFO mit der dort montierten
provisorischen
Fahrleitung
verbunden. Der
Umformer
wurde angelassen und man prüfte zuerst einmal, ob alles grundlegend
funktioniert. Man konnte Fehler bei der Produktion nicht ausschliessen und
ein völliger Misserfolg, hätte im Schutz der Hallen keine grossen
Auswirkungen auf den Ruf der Firma gehabt. Was nicht gesehen wird,
passierte bekanntlich auch nicht.
Diese Arbeiten verliefen jedoch so gut, dass die
Lokomotive Nummer 1 im Oktober des gleichen Jahres erstmals die
Hallen verlassen konnte. Bisher wusste auch noch fast niemand von dieser
neuen Lokomotive, nur die entlang des
Anschlussgleises
aufgestellte
Fahrleitung
könnte ein Hinweis gewesen sein. Diese konnte man aber kaum von einer
normalen Stromleitung unterschieden, wurde doch nur ein Draht an
Holzmasten befestigt.
Auch wenn dies im Jahre 1903 erfolgte, für die erste Fahrt der
neuen Maschine galten die üblichen Regeln und daher musste gewartet
werden, bis sich diese im
Bahnhof
bewegen konnte. Doch nun wusste man für was die Leitung gedacht war. Das Anschlussgleis wurde extra zu diesem Zweck bis zum Bahnhof Seebach mit einer Fahrleitung überspannt und vom Firmennetz gespeist. Man kann heute vermutlich schlecht nachvollziehen, wie viele Probleme gelöst werden mussten, bis nur die erste Fahrt gelang.
Das so eingeschränkte Gebiet ermöglichte auch, dass die
Lokomotive bei einer schweren Störung gleich in die Halle
gestellt und umgehend repariert werden konnte. Dem aufmerksamen Betrachter musste damals die fahrende Lokomotive, wie das Werk des Teufels vor-gekommen sein. Es funkte überall und aus dem Gehäuse war ein beängstigendes Heulen zu hören. Wie oft die Ingenieure beschimpft wurden, weiss auch niemand.
Da der
Umformer
wegen seiner Trägheit nicht so anfällig auf kurze Ausfälle bei der
Spannung
war, konnte sich die Maschine durchaus ohne ruckeln bewegen. So waren die
ersten Schritte geschafft und es konnte zum nächsten Schritt gewechselt
werden. Parallel dazu flossen die Erfahrungen mit der Fahrleitung auf diesem kurzen Stück in den Bau der Fahrleitung auf der Strecke ein. So konnten grössere Schwierigkeiten noch vor der ersten Fahrt beseitigt werden.
Nur konnte man diese Strecke nicht mehr über das Firmennetz der
MFO betreiben und so musste auch die Versorgung neu gebaut werden. Der
Grund war simpel, die Versorgung der Firma reichte dazu schlicht nicht
mehr aus.
Auf der Strecke montierte man jedoch nicht nur eine
Fahrleitung.
Da es keinen
Tunnel
gab, musste ein solcher künstlich mit einem Holzgerüst erstellt werden.
Selbst Anzeigevorrichtungen für den Schaltzustand der Fahrleitung waren
vorhanden. Diese wurde zumindest anfänglich nur eingeschaltet, wenn man
neue Versuche anstellen wollte. Dazu musste das Personal jedoch über den
Schaltzustand informiert werden.
Dabei soll es auch vorgekommen sein, dass das zu hohe Heufuder in
Flammen aufging. Die hohe verwendete
Spannung
sorgte auto-matisch dafür, dass der
Lichtbogen
genug Energie hatte. Der Strombezug für die Strecke sollte ab einem in Wettingen zu erstellenden, über eine Hochspannungsleitung vom Kraftwerk Beznau (Flusskraftwerk) aus gespeisten Unterwerk, erfolgen.
Das
Unterwerk
sorgte auch dafür, dass die Anlagen autonom be-trieben werden konnte. Ein
Kurzschluss
auf der
Versuchsstrecke,
oder bei der
Lokomotive legte nicht gleiche alle Anlagen, die am
Kraftwerk
angeschlossen waren lahm. Durch die Wahl des Kraftwerkes war die Frequenz von 50 Hertz vorgegeben. Die Frequenz erachtete man sogar, gegenüber einer niedrigeren Frequenz, als vorteilhaft.
Einziger Nachteil waren die höheren induktiven Verluste, für die
man jedoch eine Lösung gefunden zu haben glaubte. So konnte die
Lokomotive nach Abschluss der Bauarbeiten ab 1904 auch auf der
Strecke getestet werden. Die Lokomotive war fertig und bekam ihr Baujahr.
Mit der ersten Fahrt unter der
Fahrleitung
im
Bahnhof
Seebach, war die
Lokomotive fertig. Mit dem Baujahr 1904 handelte es sich um die
erste Lokomotive für einphasigen
Wechselstrom
hoher
Spannung.
Mit dem
Umformer
musste man jedoch noch
Gleichstrom
erstellen, damit die
Fahrmotoren
funktionierten. Aus diesem Grund kann bei der Maschine auch von der ersten
Umformerlokomotive weltweit gesprochen werden.
Von Überall eilten die Leute herbei und bestaunten diese besondere
Lokomotive und die Anlagen der Strecke. An solchen Tagen
schweigt man natürlich über vorhandenen Probleme und hofft, dass die
Lokomotive bei der Präsentation einwandfrei funktioniert. So schön, wie es die Präsentation vermuten lässt, war es jedoch nicht. Da der Kontakt zur Fahrleitung immer wieder verloren ging, war die Umformergruppe Schwankungen unterworfen.
Das könnte mitunter ein Grund gewesen sein, dass man später auf
den Betrieb direkt ab der
Fahrleitung
verzichtete und die
Trans-formatoren
als Drosseln benutzt wurden. Zudem knallte es auch immer wieder, da eine
Isolation
nicht korrekt bemessen worden war. Man kann sich denken, dass diese Fahrten oft mit der Hilfe einer Dampflokomotive endeten, da die Fahrleitung und die Lokomotive kaum erprobt waren und es so immer wieder zu schweren Stör-ungen kam.
Grundsätzlich war aber zu erkennen, dass die Idee, so verrückt sie
damals von vielen Leuten angesehen wurde, funktionierte. Die
Loko-motive hatte keine grossen und schweren Störungen. Die
Hauptprobleme konnten mit einer zweiten Rute schnell beseitigt werden.
Das führte unweigerlich dazu, dass man etwas mutiger wurde. Die
Lokomotive
begann sich nun mit höherer Geschwindigkeit zu bewegen und befuhr auch
regelmässig die Strecke nach Regensdorf. Dabei begannen in den
Bahnhöfen
jedoch die
Telegrafen verrückt zu spielen. Erst, wenn die Lokomotive
langsamer wurde, beruhigten sich diese wieder. Man war auf erste grössere
Probleme gestossen und vermutete das Problem bei der
Frequenz.
Der Entscheid für die heutigen
Stromsysteme der mit
16,7
Hertz betrie-benen Bahnen wurde gefällt. Dadurch konnte aber die
Lokomotive Nummer 1 nicht mehr eingesetzt werden.
Mit der durchgeführten Reduktion der Frequenz auf 15 Hertz konnte man die auftretenden Störungen vorerst eliminieren. Dabei setzte man die neue Lokomotive mit der Nummer 2 ein.
Diese mit
Reihenschlussmotoren versehene
Maschine verursachte anfäng-lich keine Störungen. Damit sah sich das
Personal auf dem richtigen Weg und legte somit die
Frequenz
endgültig auf
diesen Wert fest. Jedoch war man damit etwas gar schnell.
Die
Lokomotive
MFO 2 verkörperte die erste Lokomotive für einphasigen
Wechselstrom hoher
Spannung und einer
Frequenz von 15
Hertz. Welt-weit gab
es noch keine vergleichbare Maschine, die zudem optisch auch nach einer
neuartigen Lokomotive aussah. Ihr Auftritt, so sensationell es fachlich
auch gewesen sein mochte, blieb immer im Schatten der ersten Maschine, die
immer wieder mit dem System in
Verbindung gebracht wurde.
Als jedoch auch die
Lokomotive
Nummer 2 schneller fuhr, kamen die
Störungen in den
Telegrafen wieder. In der Folge musste man nach anderen
Lösungen suchen. Daher wurden die Drähte der Telegrafenleitungen in
bestimmten Abständen gekreuzt. Die Störungen waren damit verschwunden und
die Fahrten verliefen ohne Störungen. Das grösste Problem des Systems war
mit einer einfachen Massnahme behoben worden.
Wäre damals vermutlich, die
Frequenz nicht schon reduziert, die
Lokomotive
Nummer 1 umgebaut und die Nummer 2 so erstellt worden, hätten alle Bahnen
heute 50
Hertz in der
Fahrleitung und niemand wüsste etwas von den 16 2/3
Hertz. Nur der Schritt war getan und wurde nicht rückgängig gemacht.
Einerseits fürchtete man, dass die Störungen erneut auftreten konnten und
zudem wollte man sich allmählich an den fahrplanmässigen Betrieb wagen.
Dabei erfolgten immer wieder Anpassungen an der Fahrleitung, so dass beide Lokomotiv-en, ange-passt werden mussten.
Hinzu kamen auch noch
eine neuartige
Fahr-leitung, die zwischen Regensdorf und Wettingen
eingebaut wurde und damit auch die
Lokomotive Nummer 3. Diese dritte Lokomotive wurde von Siemens gebaut und kam auch hier zum Einsatz.
Der deutsche Hersteller brachte dabei auch die neuartige
Fahrleitung mit abgespanntem
Fahrdraht und Aufhängung mit Kettwerk zum
Versuchsbetrieb. Diese zeigte sich in der Folge deutlich besser bei der
Übertragung der hohen
Spannung auf die
Lokomotive. Man hatte den
Wechselstrom damit zu einem funktionierenden System gebracht.
Nach 17 Monaten endete dann der Versuchsbetrieb mit den drei
Lokomotiven
auf der Strecke und die elektrischen Maschinen wurden planmässig
eingesetzt. Dieser Schritt war vertraglich festgelegt worden. Mit
lediglich knapp 1.5 Jahren, war man sehr schnell zu diesem Schritt bereit.
Das System hatte sich in kurzer Zeit durchsetzen können und musste wohl
auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf Zustimmung gestossen
sein.
Erst jetzt konnte man die Praxistauglichkeit erproben, denn das System
funktionierte nun so gut, dass man problemlos mit fahrplanmässigen Zügen
fahren konnte. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB übergaben deshalb den
planmässigen Verkehr, wie es im Vertrag stand, der MFO. Damit wurden die
beteiligten drei
Lokomotiven
auch sehr auffällig mit Seebach – Wettingen
beschriftet, auch wenn es keine passende
Bahngesellschaft gab.
Es wurde daher nie auf der ganzen Strecke ein Typ
montiert. Ein Umstand, der den Betrieb jedoch nur geringfügig behinderte.
Der Bügel wurde dabei im Stillstand gewechselt.
Dabei mussten sämtliche Züge mit den drei
Lokomotiven
gefahren werden. Die
beförderten Gewichte lagen für alle Maschinen etwa bei 250 Tonnen und die
Geschwindigkeit erreichte immer wieder 40 km/h. Dabei war wirklich ein
anspruchsvolles Programm vorhanden, denn wenn eine Maschine wegen
Unterhalt fehlte, mussten die anderen mehr leisen. Trotzdem wurde kaum
etwas über grössere Störungen bekannt.
Die Kostenberechnung anhand der Abgaben der
Staatsbahnen konnten nun
ebenfalls angestellt werden. Dabei zeigte sich schnell, dass die
elektrische Traktion durchaus wirtschaftlicher arbeiten konnte. Die
Lokomotiven
benötigten weniger Unterhalt, mussten nicht Wasser fassen und
auch die Vorräte gingen nicht aus. Das galt auch, wenn man die damals sehr
billige
Kohle berücksichtigte, denn weniger
Stilllager bedeutet weniger
benötigte
Triebfahrzeuge.
Am 3. Juli 1909 wurde der elektrische Betrieb auf der Strecke zwischen
Seebach und Wettingen eingestellt. Die Erfahrungen mit den neuen
Lokomotiven
hätten durchaus eine Weiterführung zugelassen, doch die
Strecke hatte ihre Schuldigkeit getan, denn für Versuche stand nun die
Strecke zwischen Spiez und Frutigen zur Verfügung. Die MFO benötigte somit
weder die Strecke noch die beiden dort vorhandenen
Versuchslokomotiven.
In der Folge wurde in Deutschland die
Elektrifizierung mit einphasigem
Wechselstrom von 15 000
Volt und 16 2/3
Hertz in Angriff genommen. Jedoch wurden im Gegensatz zur Schweiz die
Schleifleisten nicht schmaler ausgeführt.
Noch ein paar Worte zum Artikel 12 des Vertrages mit der Staatsbahn. Die Versuchsstrecke wurde nach dem erfolg-reichen Ende des Versuchsbetriebes von der Fahrleitung befreit. Die Idee, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB den Betrieb mit den beiden Maschinen weiterführen würde, konnte nicht umgesetzt werden.
Die MFO entfernte in der Folge die Anlagen und zwischen
Seebach und Wettingen herrschten wieder Dampfloko-motiven.
Erst im Jahre 1944 überspannten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die
Strecke erneut mit einer
Fahrleitung. Am 13. Februar 1944, fast genau 40
Jahre nachdem die MFO mit den
Staatsbahnen verhandelte, wurde endgültig
der elektrische Betrieb zwischen Zürich Seebach und Wettingen eingeführt.
Die Strecke Seebach – Wettingen ist somit wohl die einzige Strecke der
Schweiz, die zweimal mit dem gleichen System elektrifiziert wurde. Die nicht mehr benötigten Lokomotiven 1 und 2 verschwanden irgendwo in der Versenkung. Überraschenderweise wurden die Maschinen jedoch nicht abgebrochen, sondern nur «eingelagert». Dabei liessen die an die BLS gelieferten Maschinen schnell erkennen, dass nicht mehr auf den beiden Versuchslokomotiven aufgebaut werden konnte. Man benötigte diese schlicht nicht mehr, sie hatten ihre Schuldigkeit getan.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Stellen
Sie sich vor, sie müssten nachdem sie den neuen Wagen beim Händler gekauft
haben, feststellen, dass die Zufahrt zum Haus schlicht zu eng ist. Das ist
eine direk-te Folge des neuen Fahrzeuges.
Stellen
Sie sich vor, sie müssten nachdem sie den neuen Wagen beim Händler gekauft
haben, feststellen, dass die Zufahrt zum Haus schlicht zu eng ist. Das ist
eine direk-te Folge des neuen Fahrzeuges.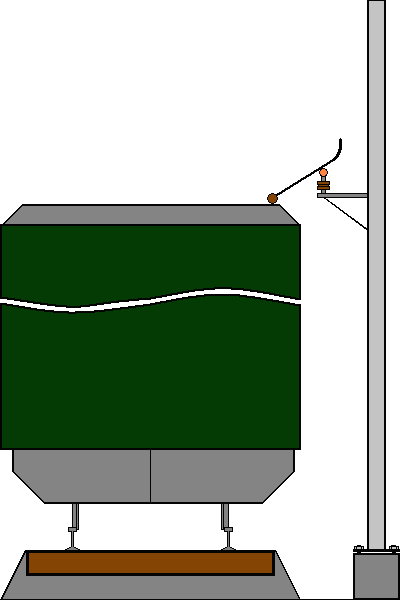 Es
war also ein Tag im Oktober, als die
Es
war also ein Tag im Oktober, als die
 Probleme
mit der
Probleme
mit der
 Es
war nun an der Zeit, die
Es
war nun an der Zeit, die
 Die Lösung für das Problem mit den
Die Lösung für das Problem mit den
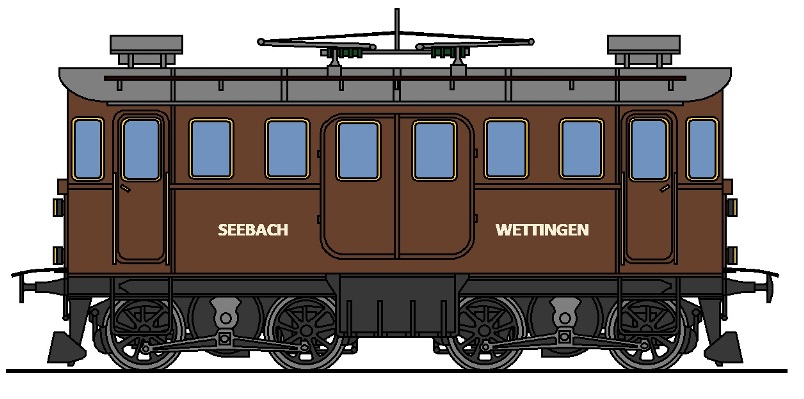 Zusammen mit der
Zusammen mit der
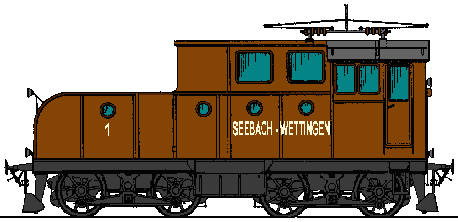 Zusammen mit der von Siemens und somit aus Deutschland stammenden Nummer 3
wurde der fahrplanmässige Betrieb zwischen Seebach und Wettingen
aufgenommen. Im
Zusammen mit der von Siemens und somit aus Deutschland stammenden Nummer 3
wurde der fahrplanmässige Betrieb zwischen Seebach und Wettingen
aufgenommen. Im
 Die
Die