|
Bedienung und Seuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Um eine Steuerung vorzustellen, muss auf dem
Triebfahrzeug
eine solche vorhanden sein. Die beiden
Lokomotiven besassen jedoch kein eigenes
Bordnetz
für die Steuerung und die Bedienung erfolgte direkt. Damit standen jedoch
gewisse Funktionen nur zur Verfügung, wenn die Maschine mit der
Fahrleitung
verbunden war. Da dazu nur der
Stromabnehmer
den Kontakt mit der Leitung herstellen musste, war das nicht besonders
schwer.
Wenn wir einen Punkt hervorheben wollen, der auch vorhanden sein
musste, wenn die
Lokomotive nicht eingeschaltet war, kommen wir schnell zur
Beleuchtung.
Diese musste so erfolgen, dass alle erforderlichen
Signalbilder
gezeigt werden konnten. Damit es hier keine zu grossen Probleme gab,
verwendete man die Lampen, die schon bei den Dampflokomotiven verwendet
wurde. Daher waren diese ebenfalls nur in den Halterungen eingesteckt
worden.
Damit war das eingeschaltete Licht zwar zu erkennen, jedoch konnte
der Bereich um die Maschine nur spärlich erhellt werden. Daher war auch
bei den elektrischen
Lokomotiven das Mitführen der entsprechenden Lampen
erforderlich. Auch sonst gab es auf den Maschinen kein elektrisches Licht. Wenn wir eine Ausnahme erwähnen wollen, dass war dies eigentlich nur das Voltmeter zur Anzeige der Spannung in der Fahrleitung.
Dieses hatte eine Lampe erhalten, damit der Wert auch bei
Dunkelheit abgelesen werden konnte. Dabei war jedoch das Licht nicht viel
besser, als wenn man eine Laterne genommen hätte. Jedoch brannte die Lampe
auch nur, wenn
Spannung
vorhanden war. Auf den beiden Lokomotiven gab es auch keine Heizung. Die Wärme der elektrischen Apparate wurde zur Erwärmung der Führerstände genutzt. Was im Winter jedoch kaum ausreichend war und bei der offenen MFO 1 sehr kalte Situationen ergab.
Mit anderen Worten, im Winter musste sich das
Lokomotivpersonal
besser anziehen, als bei den Dampflokomotiven, wo die
Feuerbüchse
immer etwas Wärme in den
Führerstand
abgab. Die Führerstände waren dazu auch noch sehr spartanisch ausgerüstet, so dass man problemlos auf eine Batterie zur Stützung eines Bordnetzes verzichten konnte. Daher bleibt nur noch die Bedienung der Lokomotiven, denn mehr gab es auch nicht.
Zudem war es natürlich auch klar, dass hier nur speziell
geschultes Personal eingesetzt wurde. Die damaligen Lokführer waren noch
nicht im Umgang mit
Elektrizität
geschult worden. Bevor jedoch die Lokomotive eingeschaltet wurde, mussten die üblichen, auch bei Dampf-lokomotiven erforderlichen Handlungen ausgeführt werden. Dazu gehörte, dass die Gleitlager geschmiert wurden.
Im Vergleich zu den vorhandenen Modellen für
Kohle,
waren hier aber deutlich weniger Schmierstellen vorhanden. Trotzdem die
Arbeit war erforderlich. Ein Nachteil war jedoch, dass die
Schmiermittel
im Winter nicht erwärmt werden konnten.
Bisher gab es zwischen den beiden
Lokomotiven keine Unterschiede, denn die Arbeiten waren auch
bei den Dampflokomotiven erforderlich und gehörten somit zum Ritual, das
vor Fahrten grundsätzlich vollzogen wurde. Die Lampen wurden aufgesteckt,
der Heizer drehte seine Runden mit der Ölkanne und nur, falls erforderlich
wurde auch das Licht angemacht. Damals fuhr man am Tag noch ohne Licht
durch die Gegend.
Bedient wurden die
Lokomotiven, wie es damals üblich war, stehend. Diese Form der
Bedienung wurde von den Dampflokomotiven übernommen und erlaubte auch,
dass die
Führerräume
sehr schmal ausgeführt werden konnten. Besonders bei der Maschine MFO 2
war das ein sehr wichtiger Punkt, wollte man an der kurzen Lokomotive
festhalten. Zudem waren durch diese Bedienung keine weiteren Nachteile zu
befürchten.
|
|||
|
Bedienung MFO 1 |
|||
|
Beginnen wir die spezifische Bedienung mit der
Lokomotive
MFO 1. Diese war älter und sie hatte wirklich eine ausgesprochen spannende
Art um in Betrieb gesetzt zu werden. Dazu musste die Maschine zuerst
«angelassen» werden. Ein Vorgang, der in mehreren Schritten erfolgte und
der durchaus etwas Zeit benötigte. Eine schnelle Inbetriebnahme war daher
bei dieser Lokomotive schlicht unmöglich, so dass man sie meistens am Netz
beliess.
Vor allem bei den Antriebsmaschinen für Grubenaufzüge und in
Walzwerken kam sie zur An-wendung. Unter Ersatz des Asynchron- oder
Synchronmotors
durch einen
Dieselmotor
fand das Prinzip auch Eingang in die
Triebwagen
BCm 2/5 der
Regionalbahn
im Val de travers (RVT). Bevor die Umformerlokomotive der MFO betriebsbereit war, musste der Hauptumformer seine normale Drehzahl erreicht haben. Der Lokomotivführer hatte dabei in einer bestimmten Reihenfolge vorzugehen.
Diese Reihenfolge werden wir im Anschluss genauer betrachten.
Dabei dauerte es bis zur betriebsbereiten
Lokomotive gut zwei Minuten. Eine im Verhältnis lange Zeit, da
aber die Lokomotive nicht eingeschaltet, sondern angelassen wurde, war das
eine vertretbare Zeit.
Zuerst musste der
Stromabnehmer
an der
Fahrleitung
angelegt und an einem Voltmeter die korrekte
Spannung
kontrolliert werden. Dazu wurde im
Führerstand
ein pneumatischer Schalter umgelegt. Der Stromabnehmer, also die Ruten,
wurde daraufhin ausgeklappt und berührten in der Folge den
Fahrdraht.
Jetzt konnte der Lokführer am im Führerstand montierten Voltmeter die
Fahrleitungsspannung
erkennen. Er konnte nun zu den nächsten Schritten übergehen.
Spannend hier ist die Tatsache, dass für den
Stromabnehmer
Druckluft
benötigt wurde. Diese konnte jedoch nur auf dem Fahrzeug erzeugt werden,
wenn auch die
Spannung
aus der
Fahrleitung
vorhanden war. Damit auch ohne Luftvorrat der Stromabnehmer angelegt
werden konnte, war eine
Handluftpumpe
vorhanden. Damit konnte mit wenigen Stössen genug Druck erzeugt werden,
dass die Ruten den Draht berührten.
Dieser Schritt dauerte einen Augenblick, da sich die Maschine
langsam zu drehen begann und immer schneller wurde. Die weiteren Schritte
konnten erst ausgeführt werden, wenn der synchrone Lauf des
Umformers
vorhanden war. War diese Situation erreicht, wurde der Erregerumformer umgeschaltet und ab der Fahrleitung in Bewegung versetzt. Damit war der erste Schritt abgeschlossen worden und der Hauptumformer konnte über den Hauptgenerator gestartet werden.
Der Lokführer ging somit zum nächsten Schritt über und stellte die
erforderliche
Verbindung
zum Hauptgenerator her. Dabei kam jetzt der vom Erregergenerator erzeugte
Gleichstrom
zur Anwendung. Der Generator wurde nun als mit Gleichstrom betriebener Motor geschaltet. Die Drehzahl des Hauptumformers erhöhte sich durch den Motor allmählich. Dieser Vorgang erfolgte in mehreren Schritten, bei denen die Spannung des Generators laufend erhöht wurde.
Nur so konnten die grossen Massen des Hauptgenerators in Bewegung
gesetzt werden. Sie müssen bedenken, dass der grösste Teil der zehn Tonnen
in Beweg-ung versetzt werden mussten.
Sobald der Hauptumformer die normale Drehzahl ungefähr erreicht
hatte, wurde sein Motor mit der
Spannung
der
Fahrleitung
verbunden. Dabei konnte zwischen der direkten
Wicklung,
oder die Lösung über den
Transformator
erfolgen. Welche Variante genommen wurde, war eigentlich vom Befinden des
Personals abhängig. Die
Lokomotive war nun betriebsbereit und konnte für die Bespannung
eines Zuges genutzt werden.
Der Sound, den diese
Lokomotive von sich gab, während sie betriebsbereit gemacht
wurde, kann wohl kaum mit dem einer modernen soundoptimierten Lokomotive
verglichen werden. Die Maschine begann buchstäblich immer lauter zu
heulen, als ob sie vor der anstehenden Arbeit Angst hatte. Zwar etwas
leiser, aber durchaus mit einem
Triebwerk
eines modernen Flugzeuges zu vergleichen. Nach Abschluss der
Inbetriebnahme war ein deutliches Heulen zu hören.
Diese Regulierwiderstände besassen einen Bedienknopf. Mit diesem
konnte ohne Rastrierung ein be-liebiger Wert eingestellt werden. Damit war
es möglich die Drehzahlen an den
Fahrmotoren
stufenlos zu verändern. Mit dem einen Widerstand konnte die Spannung des vom Hauptgenerator erzeugten Gleichstroms einge-stellt werden. Mit dem anderen Widerstand wurde die Feldstärke in den Triebmotoren eingestellt. Somit regulierte man die Drehzahl mit der Spannung und die Zugkraft mit der Feldstärke.
Es war damit eine von den Dampflokomotiven abgeleitete Regelung
vorhanden. Jedoch zeigte sich schnell, wie die
Lokomotive optimal bedient wurde.
Innert gewissen Grenzen konnte beim Fahren mit der Maschine der
eine oder andere
Widerstand
bedient werden, wobei aber das Verändern der
Spannung
gegenüber der Feldschwächung, als die üblichere Art betrachtet wurde. Man
fuhr also mit der einfachen Regelung der Spannung am
Fahrmotor.
Womit eigentlich nur noch ein Widerstand verwendet wurde. Es konnten so
aber wertvolle Erfahrungen bei der Bedienung von elektrischen
Lokomotiven gesammelt werden.
Es wurde von den verantwortlichen Leuten speziell darauf
hingewiesen, wie ausserordentlich einfach die Bedienung der
Lokomotive MFO 1 trotz der «Zusammengesetztheit der Ausrüstung»
sei. Nebst der Luftbremse habe der Lokomotivführer nur die beiden
Regulierwiderstände zu bedienen und die beiden zugehörigen Ampéremeter zu
beachten. Man muss dabei bedenken, dass man als Massstab die
Dampflokomotiven hatte.
Wollte man die Fahrgeschwindigkeit reduzieren, veränderte man den
Widerstand,
worauf die
Fahrmotoren,
die immer noch erregt wurden, Energie abgaben, die dann im
Umformer
in Energie für die
Fahrleitung
umgewandelt wurde. Da dies aber eine aufwendige Schaltung war, wurde die
pneumatische
Bremse
bevorzugt, so dass es selten zur
Nutzbremsung
mit der
Lokomotive kam. Sie war somit einfach da, wurde jedoch
nicht genutzt.
Da jedoch die
Westinghousebremse
fehlte, war es das ein-zige
Ventil,
das zur Abbremsung der Maschine genutzt werden konnte. Es war daher auch
hier eine sehr einfache Bedienung vorhanden. Es versteht sich von selber, dass die Lokomotive bei kurzen Aufenthalten im Bahnhof nicht abgestellt wurde, denn man musste vor jeder Fahrt die Lokomotive zuerst wieder anlassen und das benötigte Zeit.
Der
Umformer
der
Lokomotive lief daher im Betrieb dau-ernd und
benötigte deshalb auch Energie, wenn die Loko-motive nicht bewegt wurde.
So war klar, dass immer Energie bezogen wurde und die Maschine sehr
unwirt-schaftlich wurde.
War man am Ziel
angekommen und wollte die
Lokomotive wegstellen, musste man sie wieder
abstellen. Dazu trennte man einfach die Maschine von der
Fahrleitung
und der
Umformer
wurde nur noch durch die Massenträgheit bewegt, es erfolgte keine Erregung
des
Fahrmotors
und des
Generators
mehr. Es war hier somit sehr wenig Arbeiten erforderlich. Wobei beim
Abheben der
Stromabnehmer
von der Fahrleitung ein
Lichtbogen
entstand.
Nach dem «abstellen»
der
Lokomotive dauerte es
fünf bis zehn Minuten, bis der Hauptumformer zum Stillstand kam. Dabei war
auch die Geräuschkulisse vorhanden. Der Betrachter bemerkte eigentlich gar
nicht, dass die Lokomotive nicht mehr in Betrieb stand. Die Turbine lief
einfach leer aus und veränderte somit die Geräusche nur in geringem Masse.
Ein flexibler Betrieb war daher mit dieser Lokomotive nicht möglich.
|
|||
|
Bedienung MFO 2 |
|||
|
Die Vorgaben bei der
zweiten
Lokomotive waren schon etwas anders gelagert
worden. Es ging nun auch darum, wie elektrische Maschinen bedient werden
sollten. Die Lösungen, die bei den Dampflokomotiven angewendet wurden,
konnten hier nicht mehr verwendet werden. Es musste daher eine neue Logik
für die Bedienung geschaffen werden. Das begann bereits bei den Begriffen,
denn hier wurde «eingeschaltet» und nicht «angelassen» gesagt.
Dazu fehlten ja der Umformer und die einfach zu regelnden Fahrmotoren für Gleichstrom. Wir kommen nun der Bedienung der nachfolgenden elektrischen Lokomotiven schon sehr nahe, denn im Grunde, hatte sich daran viele Jahre kaum etwas verändert.
Sehen wir uns deshalb die Bedienung dieser
Loko-motive an.
Mit einem
Steuerschalter
wur-den auch hier die Ruten an den
Fahrdraht
angelegt. Nachdem dies erfolgt war, erkannte der Lokführer am eingebauten
Voltmeter, dass die
Spannung
der
Fahrleitung
vorhanden war. Damit war die
Lokomotive bereits eingeschaltet und der
Kompressor
erzeugte allenfalls die für die
Bremsen
benötigte
Druckluft.
Der Vorgang dauerte daher so lange, wie die
Stromabnehmer
benötigten, die Fahrleitung zu finden.
Das Personal konnte nun mit der
Lokomotive sofort losfahren und musste nicht noch
warten, bis sie bereit war. Hingegen mussten auch hier vor der Fahrt die
Funktion der
Bremse
geprüft und die
Handbremse
gelöst werden. Diese benötigte daher bereits mehr Zeit, als es brauchte um
die Maschine einzuschalten. Eine Lösung, die später wegen den hohen
Leistungen
nur noch durch einen
Hauptschalter
ergänzt wurde. Kleine Fahrzeuge, wie
Traktoren,
blieben jedoch so einfach.
Zur Fahrt hatte der Lokführer zwei unterschiedliche Regelungen zur
Verfügung. Er konnte sich also zwischen der Kurbel und dem
Steuerkontroller
entscheiden. Die Wahl der damit verbundenen Regelung der
Fahrstufen
stellte er mit einem einfachen Umschalter ein. In der Folge schalteten die
Wendeschalter
die gewählte Regelung zu den beiden
Fahrmotoren.
Die Fahrt konnte damit beginnen und hier gab es zwischen den beiden
Lösungen kaum Unterschiede.
Der Grund dafür fand sich bei den Zahlen auf dem Ziffernblatt.
Auch bei den später gebauten Maschin-en sollte von diesem Grundsatz nicht
abgewichen werden. Es sollte so eine einfache Bedienung der elektrischen
Lokomotiven eingeführt werden. Je nach Wahl der Regelung wurden die Schaltungen hergestellt. Und die Lokomotive beschleunigte. Da nun die einzelnen Stufen geschaltet wurden, er-folgte keine rucklose Beschleunigung mehr. Dabei gab es weder eine Beschränkung der Fahrstufen und des Stromes, noch wurde die Zu-schaltgeschwindigkeit begrenzt.
Ein flinker Lokführer schaffte so die 20
Fahrstufen
in wenigen Sekunden. Beim Kontroller war er etwas schneller, als bei der
Kurbel, die pro Stufe ein Um-gang benötigte. Dabei musste der Lokführer den Strom an den Fahr-motoren im Auge behalten. Es gab keine Be-grenzung des Stromes. Das führte dazu, dass bei zu schnellem Schalten, die Fahrmotoren beschädigt worden wären.
Eine Einrichtung, die
diese Situation verhindert hät-te, gab es nicht. Es waren keine
Schutzrelais
zur Begrenzung der maximalen
Ströme
vorhanden. Viel-mehr lag es ganz in der Hand der Bediener, die da-her
vorsichtig agieren mussten.
Soweit kann man die
Bedienung dieser
Lokomotiven schon beenden, denn sie war wirklich
sehr einfach aufgebaut worden. Dabei waren die Elemente zur Regelung
bereits vorhanden, es gab aber kaum Schalter im
Führerstand.
Mit der Reduktion der
Zugkraft
wurde daher auch die Beschleunigung beendet. Eine
elektrische
Bremse war jedoch bei dieser Maschine nicht mehr
möglich, da die entsprechenden Schaltungen noch nicht bekannt waren.
Verzögert wurde die
Lokomotive ausschliesslich mit der pneumatischen
Bremse. Der Lokführer schaltete die
Fahrstufen
zurück auf null und fing die rollende Lokomotive mit der
Regulierbremse
ab. Eine Lösung, die danach bei Maschinen ohne
elektrische
Bremse ebenfalls angewandt wurde. Sie sehen
also, die Bedienung war schon sehr nahe bei den nachfolgenden Lokomotiven.
Mit ein paar
Relais
und zusätzlichen Schaltern ergänzt, sind wir bei der Lösung angelangt. Die Bremsen der Lokomotive wurden analog zur Lokomotive Nummer 1 und zu den Dampflokomotiven geregelt. Dabei hatten diese kleine Änderungen erhalten, denn hier waren ja zwei Führerstände vorhanden. Musste dieser gewechselt werden, gab es eine Verbindung durch den Maschinenraum und die Maschine musste mit der Handbremse gesichert werden.
Trotzdem kann man
sagen, dass die
Lokomotive Nummer 2 einfach zu bedienen war.
Daher belassen wir es bei diesen wenigen Worten. Es bleibt nur noch, die
Maschine auszuschalten und dazu wurden einfach die
Stromabnehmer
abgehoben. Fertig war die Sache.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
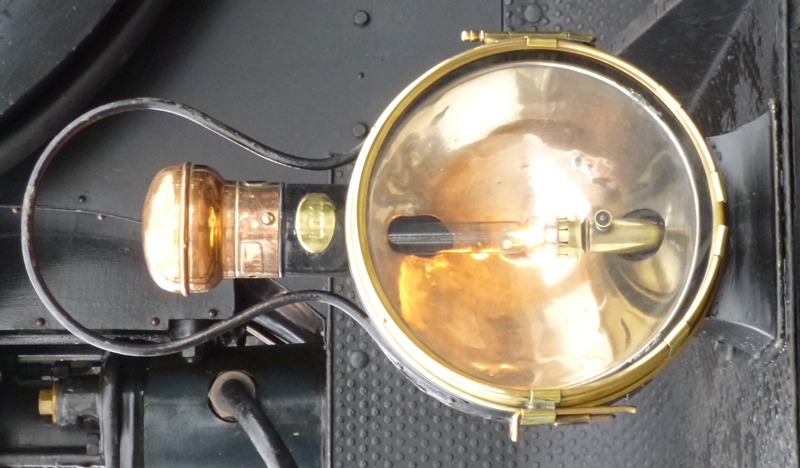 Verwendet
wurden die damals üblichen Laternen, die mit Kalziumkarbid betrieben
wurden. Wurden sie angemacht, brannte eine ruhende weisse Flamme, die
durch den Reflektor verstärkt wurde.
Verwendet
wurden die damals üblichen Laternen, die mit Kalziumkarbid betrieben
wurden. Wurden sie angemacht, brannte eine ruhende weisse Flamme, die
durch den Reflektor verstärkt wurde.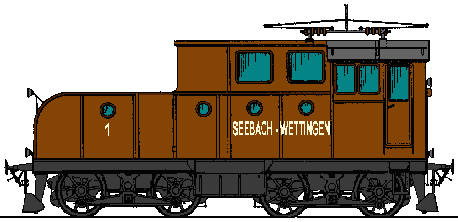 Die
auf der
Die
auf der 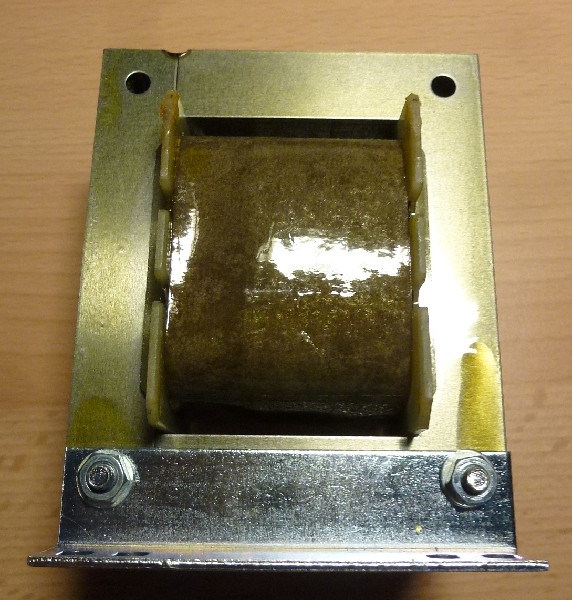 Sobald
die
Sobald
die  Der
Hauptumformer erzeugte nun einen
Der
Hauptumformer erzeugte nun einen
 Bedient
wurde die pneumatische
Bedient
wurde die pneumatische 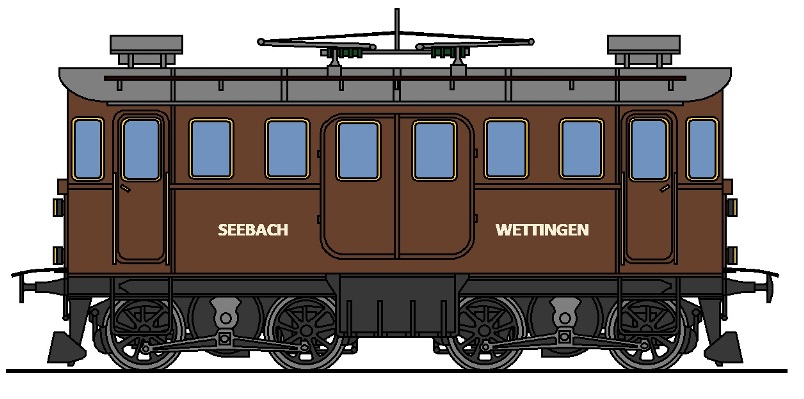 Es
ist klar, dass man bei der zweiten
Es
ist klar, dass man bei der zweiten
 Daraufhin
begann der Bediener an der Bedienein-richtung zu drehen. Dabei galt die
Regel, dass im Uhrzeigersinn zugeschaltet wurde und in der an-deren
Richtung die
Daraufhin
begann der Bediener an der Bedienein-richtung zu drehen. Dabei galt die
Regel, dass im Uhrzeigersinn zugeschaltet wurde und in der an-deren
Richtung die