|
Umbauten und Änderungen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Eigentlich ist dieser Teil sehr schnell erledigt, denn grössere
Umbauten gab es nicht. Die
Neigezüge
waren trotz der neuen Technik und der kurzen Lieferfrist ausgereift und
beklagten nur geringe Kinderkrankheiten. Diese waren in den meisten Fällen
auf ein einmaliges Versagen und wegen fehlerhaftem Material verursacht
worden. Daher sind auch sie kaum erwähnenswert.
Diese hätte es hier geben können, denn der verkürzte Vorserienzug
war zu leicht konstruiert worden. Die bauliche Struktur der Kasten reichte
nicht um die entstehenden Kräfte aufzunehmen. Die geplante Einbindung in
die Serie konnte daher nicht umgesetzt werden.
Ein grosser Verdienst muss trotzdem den vor der Serie gebauten
Fahrzeugen zugesprochen werden. Der Versuchszug für die Erprobung der
Drehgestelle,
aber auch der Zug, der als Vorabfahrzeug gebaut wurde, hatten ihre
Berechtigung. Dort konnten Mängel und Probleme rechtzeitig erkannt werden.
So gelang es, ein schnell funktionierende Fahrzeug an die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB zu liefern. Die Zuverlässigkeit der Neigezüge war wirklich grossartig. Wobei in diesem Punkt viel Erfahrung mit der Lokomotive Re 460 einfloss und so bewährte Technik eingebaut wurde. Zudem half auch die Redundanz diesen Aspekt zu verdeutlichen. Auch wenn eine Einheit ausfiel, der Triebzug hatte noch eine funktionierende Hälfte, die voll funktionierte. Der Zug kam dann, zwar mit Einschränkungen, ans Ziel. So fehlten die grossen Schlagzeilen.
Im Vergleich mit dem ein paar Jahre älteren
Triebzug
ETR 470 konnte der
Neigezug
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB viele Punkte gewinnen. Die Probleme
mit der
Neigetechnik
waren unbekannt und auch die Reisenden beklagten beim
ICN
etwas weniger gesundheitliche Probleme, als beim Italiener. So kam es,
dass allgemein der «Cisalpino» verteufelt und der ICN geliebt wurden.
Hier lag der Fehler jedoch nicht bei den beteiligten Herstellern,
denn die benötigten Standards dieser
Zugsicherung
waren schlicht noch nicht de-finiert und so musste auf den Einbau
verzichtet werden. Für ETCS Level 2 mussten zusätzliche Baugruppen eingebaut werden, dazu gehörten in den beiden Führerständen das DMI für die Anzeige der Daten bei der Fahrt.
Jedoch auch den dazu passenden
Zugfunk
mit den Teilen des
Datenfun-kes
benötigte man auf dem
Triebzug.
Wobei es nicht nur bei diesen Veränderungen im
Führerstand
blieb. Das System benötigte noch weitere Bereiche, wie eine eigene
Bremswirkgruppe. Alles in allem ein Umbau, der zwar nur einen Teil der Flotte betraf, der aber für den Betrieb wichtig war. Nebeneffekt war, dass nun alle Trieb-züge dieser Baureihe auf dem gleichen Stand waren. Es wurde
so ein freizügiger Einsatz ermöglicht. Doch wie jeder Umbau, hatte auch
dieser seine Schattenseite, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben.
Denn
ETCS
Level 2
war nicht gerade leicht ausgefallen und das bei einem
Neigezug?
Die Baugruppen von
ETCS
hatten ein Gewicht. Beim
Triebzug,
der vor dem Einbau gewogen wurde, hatte das eine Veränderung zur Folge.
Das anfängliche Gewicht von 355 Tonnen wurde durch den Einbau von ETCS
höher, so dass die Triebzüge in der Folge ein Leergewicht von 359 Tonnen
bekommen hatten. Das hatte jedoch nur geringe Auswirkungen auf die
Achslasten,
da auch hier die Teile verteilt wurden.
Da der
Neigezug
bei den
Bremsen
durchaus Reserven zur Verfügung hatte, wirkte sich diese Erhöhung des
Gewichtes nicht auf die zugelassenen
Bremsreihen
aus. Der
Triebzug
konnte daher immer noch nach der
Zugreihe N
180% verkehren. Es entstanden so keine betrieblichen Einschränkungen mehr
und auch
ETCS-Strecken,
wie die
Neubaustrecke,
konnten nun von allen Zügen befahren werden.
Ein Punkt, den man bei der Lieferung schon erkannte und der dank
den neuen Anlagen in den Servicestandorten auch kein grösseres Problem
darstellen soll-te. Nur, wie so oft, es kam anders. Die in den Waschstrassen verwendeten Chemikalien zur Reinigung bekamen der Farbe nicht besonders gut. Dabei muss erwähnt werden, dass es damals durchaus üblich war, spezielle Säuren für die Reinigung für Schienenfahr-zeugen zu verwenden.
Diese Mittel griffen jedoch die Dispersionsfarben an. Die Folge
war, dass die
Neigezüge
schnell unschöne Flecken bekamen und damit auch verwahrlos aus-sahen. Es war unausweichlich, das Problem musste gelöst werden. Die Farben sollten dabei erhalten bleiben. Daher wurden in den Waschstrassen neue Reinigungs-mittel verwendet und der Lack auf den Fahrzeugen mit einem Schutz versehen.
Der Erfolg war, dass sich die Situation bei den RABDe 500 etwas
besserte. Jedoch waren die Farben bereits stark beschädigt und konnten so
ihrer Auf-gabe immer schlechter nachkommen.
Ein Farbauftrag ziert das Fahrzeug nicht nur, er hat auch die
Aufgabe, die Metalle vor Rost zu schützen. Da hier Aluminium verwendet
wurde, könnte man meinen, dass diese Schäden nicht zu erwarten waren. Das
stimmt nur bedingt, denn die Rückstände des Reinigungsmittels wirkten als
Elektrolyt und so begannen die Kästen zu korrodieren. Auch die Bildung von
Oxyden konnte beobachtet werden. Es mussten Massnahmen ergriffen werden.
Mit der ansehenden
Revision
wurde daher der Kasten saniert und der
Triebzug
mit einem neuen Farbauftrag versehen. Dabei kamen moderne Farben zu
Anwendung, die in Zukunft etwas besser mit den Reinigungsmitteln
harmonieren sollten. Bei der Farbkombination änderte man jedoch nicht
viel, denn das Grundkonzept blieb weiterhin bestehen.
Wurde bisher bemängelt, dass die Türen von sehbehinderten Personen
schlecht zu erkennen waren, besserte sich mit dem neuen Anstrich die
Situation nicht besonders. Zwar wird rot als Signalfarbe eher
wahrgenommen, aber eine farbliche Abgrenzung war nicht vorhanden. Wie so
oft war das Design des
Triebzuges
mit den Vorstellungen von Behin-derten nicht zu kombinieren.
Auch das Fensterband beim
Speisewagen
wurde nicht mehr auf der ganzen Länge des Fahrzeuges rot eingefärbt.
Viel-mehr wurde nur noch der Bereich mit dem Speisesaal mit einem roten
Fensterband versehen. Für den Reisenden wurde damit der bisherige
Speisewagen kleiner. Jedoch passte man den Anstrich auch in diesem Bereich
den
Triebzügen RABe 503
an. Die einheitlichen Farbschemen der Unternehmung waren daher umgesetzt
worden.
Zudem begann auch das Unternehmen wieder vermehrt auf dem Zug
präsent zu sein. Seitlich war das schon immer der Fall und dort wurde auch
nichts geändert. Jedoch wurde die
Front
mit einem Signet ergänzt. Es sollte so auch hier erkenntlich sein, welchem
Bahnunternehmen der
Neigezug
gehört. Eine Massnahme, die jedoch auch andere Baureihen betreffen sollte.
Die
Triebzüge passten sich so der restlichen Flotte an.
Letztlich kam es noch zu einer Änderung, die eigentlich hier nicht
erwähnt werden müsste. Die
Triebzüge wurden mit der neuen Nummer nach den
TSI-Vorgaben
bezeichnet. Ein Vorgang, der auch bei anderen Fahrzeugen erfolgte, hier
jedoch grössere Auswirkungen hatte, denn die neuen Normen regelten bei
Triebzügen auch die Kennzeichnung von einzelnen Fahrzeugen in einem
Gliederzug
und das wirkte sich beim
Neigezug
aus.
Bisher wurden die einzelnen Fahrzeuge mit einer veränderten Ziffer
an der vierten Stelle verwirklicht. Mit den Nummern nach
TSI,
verschob man diese nun an die neue fünfte Stelle. Damit verschwand sie aus
der bekannten sechsstelligen Nummer. Eine Veränderung, die eigentlich
nicht so dramatisch wäre, dass man ihr mehr Bedeutung zuwenden müsste.
Jedoch gab es auch Veränderungen bei der Reihenfolge der einzelnen
Fahrzeuge.
Die Wagen, die bisher der Reihe nach durchnummeriert wurden,
wurden nun nach den Normen der
TSI
umgesetzt. Wie sich das auf das Fahrzeug auswirkte, wollen wir uns um
Detail ansehen. Als Muster für die Veränderungen bei den Nummern nehmen
wir den Zug mit der Nummer 500 000-5. Dieser
Neigezug
sollte neu auf die Bezeichnung 94 85 0 500 000-0
CH-SBB geändert werden. Die einzelnen Wagen wurden
entsprechend mit den Nummern versehen.
Weil nun die Angelegenheit schwer zu beschreiben ist, kann uns nur
eine Tabelle helfen, denn nur so könnten wir die Angelegenheit
einigermassen erkennen. Zum Verständnis muss gesagt werden, dass bei den
Vorschriften nach
TSI
die beiden
Endwagen
zuerst aufgeführt werden müssen. Danach kann die Wagenreihung jedoch
beliebig erfolgen. |
|||||||||||
|
Fahrzeug |
Wagen Nr. Alt |
Wagen Nr. neu |
Neue Nummer |
||||||||
|
Bt |
7 | 2 |
94 85 2 500 000-6 |
||||||||
| B | 6 | 3 |
94 85 3 500 000-4 |
||||||||
|
WRA |
5 | 4 |
94 85 4 500 000-2 |
||||||||
|
A |
4 | 5 |
94 85 5 500 000-9 |
||||||||
| AD | 3 | 6 |
94 85 6 500 000-7 |
||||||||
|
B |
2 | 7 |
94 85 7 500 000-5 |
||||||||
| Bt | 1 | 1 |
94 85 1 500 000-8 |
||||||||
|
Auf den ersten Blick erscheint es nun so, dass die Richtung im Zug
komplett gedreht wurde. Jedoch blieb diese bestehen, denn bei all den
Verschiebungen, der erste Wagen des
Triebzuges
ist geblieben, denn dieser trug und trägt die Nummer 1. Nur bei den
anderen Fahrzeugen wurden die Nummern aus Gründen der Einfachheit
durchnummeriert. Das führt zu dieser verwirrenden Reihung in der Tabelle.
Dieser arbeitete mit schlecht brennbaren Stoffen und den Brandschutztüren bei den Durchgängen auf andere Wagen.
Jedoch reichte diese Massnahme nicht für die
Zulassung
für Fahrten im
Basistunnel
am Gotthard, denn der ver-langte einen besseren Brandschutz. Die Anforderungen an die Brenndauer ohne betriebliche Einschränkungen konnte der Zug bereits erfüllten, so dass hier kaum Anpassungen für den Einsatz im Basis-tunnel erforderlich wurden.
Der
Neigezug
sollte damit auch im Falle eines Feuers die nächste Nothaltestelle
problemlos anfahren können, was eine wichtige Vorschrift für Fahrten im
Basistunnel
am Gotthard war.
Jedoch mussten in den Technikräumen und in den Ab-teilen
zusätzliche Rauchmelder eingebaut werden. Diese detektierten den Rauch in
Kombination mit Wärme in einem Abteil und meldeten diesen Alarm an die
Leittechnik
und an das Personal. Dieses konnte so schneller mit einem
Feuerlöscher
eingreifen und den Brand bekämpfen, bevor dieser an den Strukturen des
Fahrzeuges grössere Schäden verursachen konnte.
Damit können wir die Umbauten und Änderungen bereits wieder
beenden. Nach einem Einsatz von 20 Jahren wurden an den
Neigezügen
nur kleinere Anpassungen vorgenommen und das Fahrzeug an die neuen
Anforderungen angepasst. Einen grundlegenden Umbau wurde jedoch nicht
erforderlich. Das zeigt, wie gut die Leute beim vermeintlich letzten in
der Schweiz gebauten Fahrzeug gearbeitet haben.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
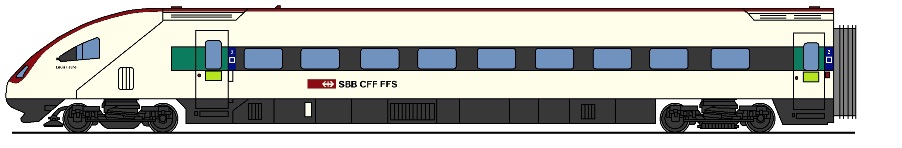 Eigentlich
ist es einfach, wird eine Baureihe kurz nach der Auslieferung verändert,
sind markante Probleme aufgetreten.
Eigentlich
ist es einfach, wird eine Baureihe kurz nach der Auslieferung verändert,
sind markante Probleme aufgetreten.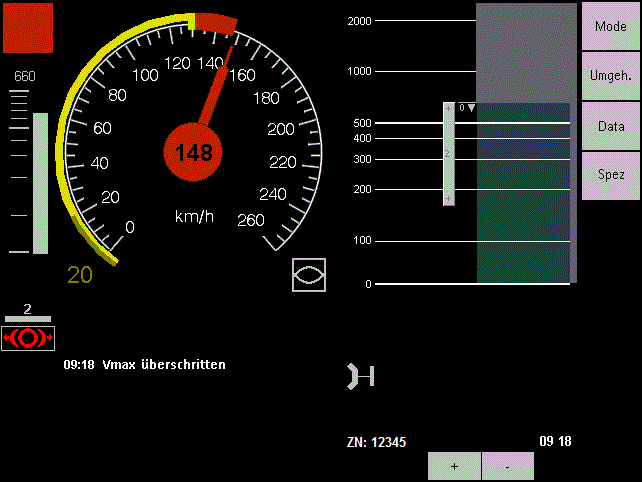 Trotzdem,
ohne Veränderungen ging es nicht und diese müssen wir uns ansehen, wollen
wir objektiv über den
Trotzdem,
ohne Veränderungen ging es nicht und diese müssen wir uns ansehen, wollen
wir objektiv über den
 Was
sich jedoch als grösseres Problem zeigte, als erhofft, war der Anstrich.
Die weisse Farbe war anfällig auf Verschmutzungen. Daher musste der der
Was
sich jedoch als grösseres Problem zeigte, als erhofft, war der Anstrich.
Die weisse Farbe war anfällig auf Verschmutzungen. Daher musste der der
 Jedoch
wurden die Bereiche um die Türe neu gestaltet. Die bisher recht bunten
Bereiche des
Jedoch
wurden die Bereiche um die Türe neu gestaltet. Die bisher recht bunten
Bereiche des
 Bei
der
Bei
der