|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wie in diesem Kapitel üblich, beginnen wir
mit den
Nebenbetrieben.
Auch wenn es sich um eine
Güterzugslokomotive
handelte, die an ein
EVU
geliefert wurde, das sich mit dem
Güterverkehr
befasste, waren auf der
Lokomotive Nebenbetriebe erstellt worden. Auch hier
zeigte sich, dass die Maschine eigentlich als universelles Modell
entwickelt worden war und zumindest zum Teil wurde diese Anlage auch hier
genutzt.
Dabei waren die beiden Systeme, die mit
Gleich-strom
arbeiteten noch sehr einfach, denn dort wurde die
Spannung
der
Fahrleitung
zugeführt. Es musste ein einfaches Schaltelement verwendet wer-den, denn
die Leitung wurde nicht immer benutzt. Wesentlich umfangreicher musste man die Spann-ung für die Zugsammelschiene bei Wechselstrom herstellen. Die in der Regel hier vorhandene einf-ache Anzapfung in der Primärspule, gab es bei dieser Baureihe nicht mehr.
Es musste daher eine andere Lösung gesucht
wer-den und dabei fand man das normale Magnetfeld des
Transformators.
Dieses konnte genutzt werden um eine zusätzliche
Spule
mit Energie zu versorgen. Die Wicklung war so aufgebaut worden, dass die beiden Spannungen abgenommen werden konnten. Die beiden Unterschiedlichen Frequenzen ergaben sich mit dieser Lösung automatisch. Diese wurde mit dem Magnetfeld im
Transformator
ohne Umwandlung übertragen. Es musste also nur für die korrekte
Spannung
bei diesen Systemen gesorgt werden. Auch hier war mit einem
Heizhüpfer
das erforderliche Schaltelement vorhanden.
Nach den Schaltelementen wurden die
Spannungen
für die
Zugsammelschiene
einer einfachen Leitung zugeführt. Es war Aufgabe der Steuerung dafür zu
sorgen, dass nicht zwei Spannungen vorhanden waren. Diese Leitung konnte
nun aber genutzt werden und sie wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt. Eine Nutzung auf der
Lokomotive war jedoch nicht vorhanden. Das war aber bei
Triebfahrzeugen
schon immer so gewesen.
Der Grund war die hier vorhandene
Leistung,
denn diese konnte
Ströme
liefern, die für eine Steckdose zu hoch waren. Mit der zweiten Dose konnte
die Leistung erhöht werden. Auch sonst war in diesem Bereich die Maschine
gut aufgestellt. Die an den Stossbalken montierten Heizkabel waren längst verschwunden. Bei den international einsetz-baren Lokomotiven konnte aber nicht mit der in der Schweiz üblichen Lösung gearbeitet werden.
Daher führte die
Lokomotive schlicht ein passendes
Heizkabel
mit. Dieses war verkürzt worden, da we-gen den beiden Dosen auf die
Kreuzung des Kabels unter der
Kupplung
verzichtet werden konnte. Auch hier ergab sich somit ein Vorteil.
Wie schon erwähnt, war das die gesamte Anlage für die Nebenbetriebe. Wer es genau nimmt, der würde noch die Strommessung vorfinden.
Diese war in dem Sinn speziell, dass je nach
der
Spannung
höhere oder geringere
Ströme
zugelassen waren. Daher war auch diese Messung von der Steuerung
übernommen worden. Gerade hier zeigte sich, wie viel diese bei den
modernen
Mehrsystemlokomotiven
in andere Bereiche eingriff.
Jedoch fehlt uns nun die Versorgung der Bauteile,
die nicht direkt mit der Traktion der
Lokomotive verbunden waren. Für
diesen Bereich wurden jedoch schon seit Jahren die
Hilfsbetriebe
verwendet. Es war ein Netz auf dem Fahrzeug, dass jene Baugruppen
versorgte, die nicht für den
Antrieb erforderlich waren. Wichtig waren sie
trotz dem Namen, denn ohne Hilfsbetriebe konnte ein
Triebfahrzeug schlicht
nicht benutzt werden.
Hier waren insgesamt vier
IGBT-Stromrichter
vorhanden und jeder hatte eine
Leistung von 90 kVA erhalten. Jedoch war
diese Leistung immer noch so knapp bemessen, dass es bei einem Ausfall zu
grösseren Einschränkungen kom-men konnte. Die grosse Anzahl Stromrichter für die Hilfsbetriebe war erforderlich, da sich das Netz in zwei Bereiche und die beiden Drehgestelle aufteilte. Wobei sich diese Unter-schiede bei den Stromrichtern noch nicht zeigte.
Jeder konnte einen
Drehstrom von 440
Volt
erzeugen. Die dabei vorhandene
Frequenz konnte jedoch durch die Steuerung
zwischen zwei und 60
Hertz geregelt werden. Dies erlaubte die Drehzahl der
Bauteile zu verändern. Aufgeteilt wurden die Hilfsbetriebestromrichter auf die zwei Einheiten für die Antrie. Dabei wurden immer zwei Umrichter zugeteilt.
Während einer davon mit einer variablen
Frequenz betrieben
wurde, hatte der zweite
Stromrichter eine fest eingestellte Frequenz
erhalten. Dabei waren die nun folgenden Verbraucher an einem der
Hilfsbetriebeumrichter HBU angeschlossen worden. Damit Sie den Einbau
erkennen, wird die Nummer aufgeführt.
Beginnen wir mit dem
Kompressor. Dieser wurde für
die Erzeugung von
Druckluft benötigt und dessen
Drehstrommotor musste mit einer
festen
Frequenz betrieben werden. Daher wurde diese Baugruppe am HBU 2.2
angeschlossen. Dabei bedeutet dies, dass wir den zweiten
Umrichter des
Drehgestells zwei hatten. Als Ersatz konnte hier der HBU 2.1 genommen
werden und damit kommen wir zu den wichtigsten Nutzer der
Hilfsbetriebe.
Die
Ventilatoren hingegen
wurden mit der variablen
Frequenz versorgt und konnten bei der
Leistung an
den Bedarf angepasst werden. Daher lohnt sich ein genauer Blick auf die
Kühlung der Bauteile. Den Anfang macht auch hier der Transformator. Die-ses Bauteil wurde für beide Antriebsstränge benötigt und dabei wurde das bei der Kühlung berücksichtigt. Bei dem unter der Lokomotivbrücke aufgehängten Transformator kam eine Kühlung mit Flüssigkeiten zur Anwendung.
Das bisher
in diesem Bereich verwendete
Transfor-matoröl, war bedenklich, da es in der Umwelt
grosse Gefahren bot. Daher wurde hier eine andere Lösung benutzt. Hier verwendete man für die Kühlung des Transfor-mators Polyolester. Dieser Stoff hatte nahezu gleiche Eigenschaften, wie die Kühlmittel der alten Modelle und konnte daher gut verwendet werden.
Der grosse Vorteil von
Polyolester war, dass wir hier
ein für die Umwelt verträgliches Mittel erhalten hatten. Beim weiteren
Aufbau ergaben sich jedoch keine Unterschiede mehr, denn auch hier wurde
das Mittel mit einer Pumpe bewegt.
Die Kühlmittelpumpe war am HBU 1.2 angeschlossen
worden und sie setzte den
Polyolester in Bewegung. Die in den
Wicklungen
entstandene Wärme wurde vom Ester aufgenommen und mit der Pumpe durch die
Leitungen zu den beiden
Kühlern geschickt. Sie haben richtig gelesen, es
gab zwei Kühler, die in den beiden hier verbauten Kühltürmen eingebaut
wurden. So lange einer funktionierte, war die
Kühlung gesichert.
Durch den Aufbau der
IGBT-Transistoren
konnten diese aber mit Wasser gekühlt werden. Um zu verhindern, dass
dieses bei kalten Tagen gefrieren konnte, war es mit einem
Frostschutzmittel versehen worden. Trotz dem Mit-tel war die Gefahr für die
Umwelt gering. Die Kühlwasserpumpe führte das Kühlmittel ab und in den benachbarten Kühlturm. Die Pumpe wurde mit einer festen Frequenz betrieben und mit dem Kühler sind wir wieder im Kühlturm gelandet.
Diesen müssen wir uns nun ansehen, denn er versorgte die Rückkühlung der
erwähnten
Flüssigkeitskühlungen mit Luft. Dabei waren jedoch genau
genommen drei Kühl-türme verbaut worden und das stellte rechnerisch ein
grosses Problem dar. Sowohl einer der beiden vorhandenen Kühler des Trans-formators, als auch jener des benachbarten Umrichters wurden in einem Kühlturm montiert.
Die im Dachbereich bezogene und mit
Filtermatten
gereinigte Luft wurde durch einen
Ventilator beschleunigt und an den
Kühlern vorbei geblasen. So nahm diese die Wärme auf und diese gelangte
unter dem Fahrzeug wieder ins Freie und damit kommen wir zum dritten
Kühlturm.
Künstlich gekühlt werden mussten auch die
Bremswiderstände. Im Betrieb konnten diese sehr heiss werden. Mit einem
Ventilator wurden die
Widerstände mit Luft gekühlt. Dabei wurde diese so
heiss, dass sie nicht unter dem Fahrzeug ins freie gelangen konnte, denn
dort wurden eventuell Menschen gefährdet. Hinzu kam, dass die Widerstände
nur bei Bedarf und auch nur beim Betrieb mit
Gleichstrom gekühlt werden
mussten.
Diese
Lüfter wurden mit den anderen
vergleichbaren Ein-heiten an einem HBU mit variabler
Frequenz betrieben.
Verlangte eine davon mehr
Leistung, wurde diese bei den anderen Baugruppen
auch erhöht. Dabei waren meistens die
Fahrmotoren dafür verantwortlich. Die Lokomotive war also mit einer bedarfsabhängigen Steuerung der Ventilation versehen worden. Dabei wurde diese durch die Steuerung anhand der gemessenen Tem-peratur an den Bedarf angepasst.
Ausnahmen gab es nur beiden den
Widerständen der
elektrischen
Bremse, denn
diese
Kühlung aktivierte sich nur bei Fahrten mit
Gleichstrom und beim
Bremsbetrieb. Das auch, wenn die
Leistung vom Netz aufgenommen wurde. Wir sind nun bei den Kleinverbraucher angelangt. Wobei diese nicht unwichtig waren und wir dazu in die beiden Führerstände gehen müssen.
Auch dort war es mittlerweile üblich eine
Kühlung der
Führerkabine zu verbauten. Da sie auch für die
Heizung derselben genutzt
wurde, sprach man von einer
Klimaanlage. In jedem
Führerstand konnte die
Wärme automatisch, oder manuell durch das Personal geregelt werden.
Die
Lüftung der
Klimaanlagen war mit Druckklappen
versehen worden. Diese waren erforderlich, um die Luftstösse bei Fahrten
in
Tunnel, oder bei Begegnungen von zwei Zügen zu mindern. Die
Lokomotive
hatte daher eine druckdichte Kabine erhalten. In dieser waren jedoch neben
der Klimaanlagen noch weitere Baugruppen vorhanden, die von den
Hilfsbetrieben versorgt wurden und das waren zahlreiche Heizungen.
Auch wenn das nicht so wichtig erscheinen
mag, denn in der Regel trägt das Personal bei der Arbeit Schuhe. Jedoch
ergaben sich so auch thermische Vorteile, die kalte Zugluft im Bereich der
Füsse verminderte. Es war ein gute thermische Kabine vorhanden. Wenn wir noch schnell in den Führerständen bleiben, dann gab es noch spezielle Ausstattungen. In der Nische des Beimannes war eine übliche Steckdose vorhanden und ein Kühlschrank der auch geheizt werden konnte, gab es auf der Lokomotive.
Es waren also spezielle Bereiche
vorhanden. Diese waren für sehr lange Fahrten ausgelegt worden und es
waren Merkmale, die auch bei den Modellen der
Baureihe
Re 484 vorhanden
waren. Nicht mehr über die Hilfsbetriebe geführt wurde die An-zeige der Fahrleitungsspannung. Das war schlicht nicht möglich, da hier die Spannung unabhängig davon war.
Aus diesen Grund musste eine
andere Lösung verwendet werden und das waren die Wandler. Jedoch wirkten
diese auf die Steuerung und diese werden wir anschliessend ansehen. Doch
nun wird deren Versorgung wichtig, denn diese erfolgte ab den
Hilfsbetrieben.
Für die
Batterieladung wurde am
Hilfsbetriebeumrichter
HBU 1.2 das dafür erforderliche
Ladegerät
angeschlossen. Das
Batterieladegerät der
Lokomotive war so aufgebaut
worden, dass die Versorgung der Steuerung übernommen werden konnte, und
dass die Ladung der
Batterien gesichert werden konnte. Doch dazu mehr im
nächsten Kapitel mit der
Beleuchtung und der Steuerung, die auch hier
nicht von der
Fahrleitung abhängig war.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Bei
den
Bei
den
 Beim
Beim
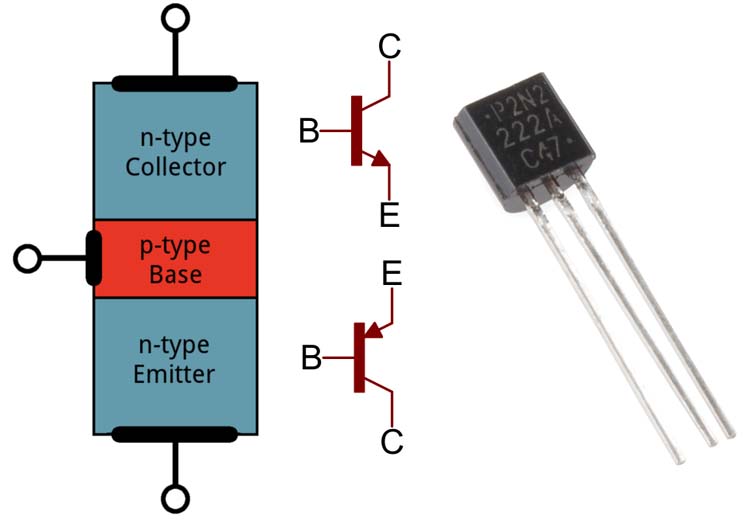 Ich habe es bereits erwähnt, denn um die
Ich habe es bereits erwähnt, denn um die
 Es war die
Es war die
 Bevor wir uns diesen Kühlturm genauer ansehen,
müssen wir noch die
Bevor wir uns diesen Kühlturm genauer ansehen,
müssen wir noch die
 Somit wird es Zeit, dass wir uns den
Somit wird es Zeit, dass wir uns den
 Neben den bekannten
Neben den bekannten