|
Entwicklung und Beschaffung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Eine neue
Rangierlokomotive für die Post war für die Industrie ein seltener Auftrag.
In der Regel bestellten Bahnen die Maschinen. Benötigt wurden die
Fahrzeuge in den grösseren Postzentren. Sie sollten dort die älteren
Maschinen endlich ablösen und daher überrascht es nicht gross, dass viele
Eckpunkte des
Pflichtenheftes den vorhandenen Exemplaren entsprachen.
Trotzdem sollten auch neue Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Wichtig für
die Lieferung war, dass die Serie für die Schweizerische Post bescheiden
ausfallen würde. Daher sollten die grossen Kosten für die Entwicklung
geringgehalten werden. Ein Punkt, der gerade beim Beschaffungspreis
wichtig sein sollte. Das in solchen Fällen übliche Muster fehlte jedoch
und auf den
Antrieb
mit
Triebstangen der alten Maschinen wollte niemand mehr
zurückgreifen. Dazu waren die Einzelachsantriebe zu gut geworden.
Sie haben richtig gelesen, auch bei der
Staatsbahn gab es neue Rangierfahrzeuge. Der Grund waren die neuen
Ablaufberge, die zwingend schwere Verschublokomotiv-en benötigten. Daher
wurde eine elektrische Variante und eine mit
Dieselmotor
beschafft.
Sowohl die
Baureihe Am 6/6, als auch die Reihe Ee 6/6 II wurden für den schweren
Verschub gebaut und besass daher sechs
Triebachsen, was natürlich zu gross
für die Post war. Trotzdem sollten diese Modelle als Muster verwendet
werden. Es lohnt sich daher, wenn wir einen kurzen Blick auf die Reihe Ee
6/6 II blicken. Wobei Sie mir glauben können, letztlich ginge auch die
schwere
Diesellokomotive der Baureihe Am 6/6.
Der
mechanische Teil dieser grossen
Lokomotiven konnte nicht direkt verwendet
werden. Jedoch gab es dort Komponenten, wie der
Antrieb und die Ausrüstung
der
Druckluftbremsen, die übernommen werden konnten. Gerade der Antrieb musste für
die bei dreiachsigen Modellen übliche Bauweise mit einem starren
Plattenrahmen, ausgelegt werden und da war natürlich das
Drehgestell der
Reihe Ee 6/6 II als passende Konstruktion bestens geeignet.
Im
elektrischen Bereich war das Muster auf dem neusten Stand der Technik. Die
Reihe Ee 6/6 II besass einen neuartigen
Umrichter, der bei den
Antrieben
die Verwendung von robusten Motoren für
Drehstrom erlaubte. Eine noch
junge Technik, deren Erfolg man damals noch nicht absehen konnte. Die
Lokomotive für die Post sollte daher mit der für die Reihe
RBDe 4/4
entwickelte Technik ausgerüstet werden. So hatten man die wichtigsten
Punkte.
Wie die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB konnte auch die Post den Lieferanten nicht frei wählen.
Zudem war diese Firma auch beim Bau der als Muster dienenden Reihe Ee 6/6
II verwendet worden und kannte sich so mit den
Laufwerken aus. Das galt auch für den Elektriker, der hier in der Form der Firma Brown Boveri und Co BBC mit Sitz in Baden auf-treten sollte. Neu wurden die Lokomotiven jedoch nicht mehr in Münchenstein montiert.
Nach der Übernahme der MFO
stand deren Werk in Oerli-kon für die Montage der elektrischen Ausrüstung
und die erst Inbetriebnahme zur Verfügung. Jedoch waren das auch die
ersten Anzeichen vom drohenden Untergang der entsprechenden Industrie. Die schweizerische Post bestellte im Jahre 1982 vom vorgeschlagenen Muster vier Lokomotiven. Speziell dabei war eigentlich nur, dass die Bestellung öffentlich nicht bekannt gegeben wurde.
Das war damals in der Schweiz eine
unübliche Praxis. Daher war 1985 selbst die Fachpresse beim auftauchen
dieser Maschinen, die mit den Nummern 8 bis 11 eingereiht werden sollten,
überrascht. Zudem stand die Maschine auch im Schatten anderer Baureihen.
Wenn eine
neue elektrische
Lokomotive für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB und
ein neuer
Triebwagen für die
Privatbahnen ausgeliefert werden, kann es
schon passieren, dass die
Rangierlokomotive der Post «vergessen» geht.
Zumal damals noch nicht so viele Leute wussten, dass in den Postzentren
die Rangieraufgaben nicht von den
Staatsbahnen übernommen wurden. Die neue
Reihe Ee 3/3 sollte daher auch diesen Umstand aufzeigen.
Da sie
zeitlich mit dem Modell für die Gürbetalbahn GBS ge-liefert wurden, kamen
hier die Anpassungen dieser Maschine zu Anwendung. Jedoch verzichtete die
Post hier auf den Einbau von
Akkumulatoren.
Erklärt
werden muss jedoch die Lücke. Diese war die Folge davon, dass die Post
zwischenzeitlich zwei Maschinen von den
Staatsbahnen übernommen hatte. Das
waren ältere Modelle, die bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht
mehr benötigt wurden. Bei der Post verzichtete man jedoch auf eine Aktion
zur Vergabe neuer Nummern. Neue Anschaffungen, wurden einfach mit der
anschliessenden Nummer versehen.
Dieser
Nachbestellung schloss sich auch die EBT-Gruppe an. Diese
Bahngesellschaft
bestellte insgesamt vier Ee 3/3 nach dem Muster der Post. Drei Maschinen
wurden mit den Nummern 132 bis 134 versehen und kamen zur eigentlichen
EBT. Für die VHB war schliesslich noch die Nummer 151 vorgesehen. Damit
hatten wir 1990 bereits neun Modelle in Betrieb, beziehungsweise im Bau.
Ausgerüstet wurden diese Maschinen für den Betrieb unter
Wechselstrom.
Weil sich
das Modell für die GBS sich von den anderen Maschinen unterscheiden
sollte, kommen wir nicht darum herum, dessen Entwicklung etwas genauer zu
beleuchten. Dabei war der
Güterverkehr
auf dieser Strecke das Problem und
nicht die Rangierarbeiten in einem grossen
Bahnhof. Dieser konnte jedoch
nicht von den elektrischen
Lokomotiven der BLS-Gruppe übernommen werden.
Die eigene Re 4/4 lief daher bei der BLS.
Dieser war jedoch gerade im Bereich
zwischen Thun und Uetendorf der Aufgabe längst nicht mehr gewachsen.
Ge-rade wenn für die Schweizer Armee die schweren Wagen mit Panzern
zugestellt werden mussten, war der
Traktor am Anschlag. Das wirkte sich bei der Fahrzeit aus, denn mit einer schleichenden Fahrt konnte der Fahrplan nicht mehr eingehalten werden und das war ein Problem. Im Gürbetal verkehrten wegen der Nachfrage immer mehr Züge des Nahverkehrs.
Diese
belegten auf der einspurigen Strecke die meisten Trassen. Dazwischen
musste dann noch der langsame
Traktor mit dem
Güterzug verkehren. Das ging
jedoch schlicht nicht ohne
Verspätungen.
Zudem war
auch der Platz nicht vorhanden, um die anstehenden Lasten mit zwei Zügen
zu führen. Entweder hätte man einen zweiten
Traktor gemietet und wäre mit
dem vorhandenen Modell wieder zurückgefahren, um den zweiten Teil der Last
zu holen. Beide Lösungen waren mit hohen Kosten verbunden und kamen daher
nicht in Frage. Es war klar, es musste eine passende
Lokomotive für diesen
besonderen Einsatz gefunden werden.
Der
Verwaltungsrat der GBS entschied sich daher im Jahre 1988 unter dem
Vorbehalt der Finanzierung durch den Bund und den Kanton Bern eine neue
Rangierlokomotive zu beschaffen. Die Finanzierung dieser neuen
Lokomotive
sollte jedoch über den 7. Rahmenkredit des Bundes erfolgen. Dieser sah
immer einen Beitrag des betroffenen Kantons vor. Aber Ziel dieses
Rahmenkredites war, dass auch kleinere Bahnen mit modernem
Rollmaterial
beglückt werden konnten.
Bemerkenswert daran ist, dass sowohl der
Anteil des Kantons, als auch der Anteil des Bundes aus der gleichen Stadt
kamen. Daher wurde in diesem Zusammenhang von Bundesbern gesprochen, damit
man klar Bund und Kanton unterscheiden konnte.
Da die
Entwicklung bei
Lokomotiven immer das teuerste war, entschied man sich für
einen Nachbau einer bestehenden Lokomotive. Gross war dabei die Auswahl
nicht, waren die meisten Maschinen doch schon mehr als 30 Jahre alt. Diese
konnten nicht sinnvoll nachgebaut werden, besassen sie doch noch einen
Antrieb
mit
Triebstangen und es gab auch kein Modell das die Abschnitte
ohne
Fahrleitung hätte befahren können.
Trotzdem
konnte man bei der schweizerischen Post eine moderne
Rangierlokomotive mit
der passenden
Leistung finden. Die damalige PTT setzte bereits vier
elektrische Maschinen neueren Baujahres ein. Diese
Lokomotive passte ideal
zu den Ideen der Gürbetalbahn GBS, sie musste aber angepasst werden. Das
führte letztlich dazu, dass die Bezeichnung der Maschine mit der Nummer
402 verändert werden musste. Jedoch sehen wir uns die Anpassungen zuerst
an.
Unter den
vielen Änderungen gegenüber der
Lokomotive der Post, sind hier nur die
wichtigsten zu erwähnen, die den gänzlich anderen Charakter der
GBS-Lokomotive aufzeigen sollen. Die
Höchstgeschwindigkeit
wurde auf 75
km/h erhöht und die Lokomotive zusätzlich mit den Einrichtungen für die
Zugsicherung ausgerüstet. Auch eine
Zugsammelschiene für
Reisezugwagen war
hier vorhanden. Diese gab es bei der Lokomotive der Post nicht.
Es musste ein zweiter Antriebsstrang eingebaut werden. Um auch dem
Umweltschutz ge-recht zu werden, kam dabei kein
Dieselmotor, sondern eine
Traktionsbatterie zur Anwend-ung. Neben dem Umweltschutz, der damals noch nicht so auf Verbrennungsmotoren ausge-richtet war, war auch der Lärm ein Problem. Die Lokomotive der Gürbetalbahn bediente die Anschlüsse oft in den frühen Morgenstunden.
Zudem befanden sich diese in dicht besiedeltem Gebiet. Man erhoffte sich
daher auch eine im Vergleich deutlich leiser arbeitende Maschine. Ob die
neue Baureihe dieses Ziel erreichen konnte, werden wir später erfahren.
Durch diese
Tatsache änderte sich die Bezeichnung auf Eea 3/3. Da sich dieser
Bestellung sowohl die schweizerische Post, als auch die EBT-Gruppe mit den
vorher vorgestellten Modellen nach dem Muster Ee 3/3 anschlossen, konnten
die Kosten gesenkt werden. Daher blieb die Nummer 402 der GBS die einzige
Lokomotive mit der zusätzlichen Versorgung, denn diese wurde wirklich nur
im Gürbetal dringend benötigt.
Im weiteren
Verlauf werden wir uns auf die Baureihe Eea 3/3 konzentrieren. Wo es bei
den anderen Modellen dazu Abweichungen gab, werden diese jedoch erwähnt
werden. Das ist auch der Grund für den Titel. Es sollen die
Rangierlokomotiven der Reihen Ee 3/3 und Eea 3/3 vorgestellt werden. Diese
wurden an drei
Privatbahnen und an die Schweizerische Post geliefert.
Wobei letztere alleine fünf Modelle beschafft hatte.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
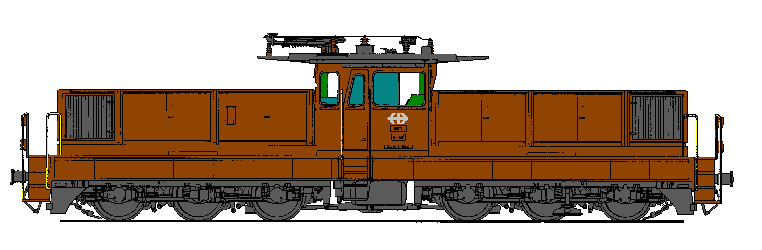 Wenn man um
1980 nach einer modernen elektrischen
Wenn man um
1980 nach einer modernen elektrischen
 Für den
mechanischen Teil der neuen
Für den
mechanischen Teil der neuen
 Da sich die
vier Maschinen in den ersten Jahren bewährten, kam es 1992 zu einer
weiteren Lieferung an die Post. Diese wurde mit der Nummer 14 versehen und
beim Elektriker trat nun die neue Asea Brown Boveri ABB auf.
Da sich die
vier Maschinen in den ersten Jahren bewährten, kam es 1992 zu einer
weiteren Lieferung an die Post. Diese wurde mit der Nummer 14 versehen und
beim Elektriker trat nun die neue Asea Brown Boveri ABB auf. Der Grund
war die Bedienung der
Der Grund
war die Bedienung der
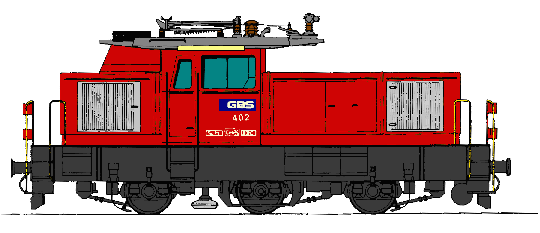 Oft mussten
aber die manchmal willkürlichen Entscheide der Behörden abgewartet werden.
Für die Gürbetalbahn GBS verlief die Sache jedoch gut, so dass die Gelder
aus Bern gesprochen wurden.
Oft mussten
aber die manchmal willkürlichen Entscheide der Behörden abgewartet werden.
Für die Gürbetalbahn GBS verlief die Sache jedoch gut, so dass die Gelder
aus Bern gesprochen wurden. Konnte sich
die Post mit einer reinen elektrischen
Konnte sich
die Post mit einer reinen elektrischen