|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
| Baujahr: | 1982 - 1991 | Leistung: | 600 kW / 810 PS | |
| Gewicht: | 50 t | V. max.: | 60 - 75 km/h | |
| Normallast: | 220 t bei 30 km/h | Länge: | 11 200 mm | |
|
Nur
schon der Titel mag Sie überraschen. Es wird keine
Bahngesellschaft
aufgeführt und auf den ersten Blick handelte es sich um zwei
unterschiedliche Typen. Das war in diesem Fall jedoch erneut ein
spezieller Fall, der durch die in der Schweiz übliche Praxis mit den
Bezeichnungen entstand. Ein Effekt, den es auch bei anderen Baureihen
schon gegeben hatte. Gutes Beispiel dafür sind die Reihen
Re 4/4 II und
Re 4/4 III
der
Staatsbahnen.
Es
gab einfach noch eine Ergänzung, die auf Grund der geänderten Bedürfnisse
der späteren Besteller vorgesehen wurden. Dabei lässt die Bezeichnung
schon die Richtung erahnen.
Auch das war nicht so neu, wie man meinen könnte. Jedoch stellt sich damit
auch die Frage, wieso diese als
Rangierlokomotiven
konstruierten Modelle überhaupt entwickelt wurden. Maschinen in diesem
Bereich sind bekanntlich nicht die grossen Stars auf den
Schienen.
Daher erreichten sie lange Einsätze. Ein Blick in die lange Geschichte von
speziellen
Lokomotiven
für den
Rangierdienst
soll diesen Punkt klären.
Die
hier vorgestellte Maschine sollte eine dritte Generation von
Rangierlokomotiven
erschaffen. Sie sollten in einem Bereich eingesetzt werden, der von vielen
Leuten kaum beachtet wurde. Jedoch sah die Industrie gerade in diesem
Bereich um 1980 einen grossen Bedarf. Die
Staatsbahnen
führten ein Erneuerungsprogramm durch und in diesem Bereich erhoffte man
sich bei den Herstellern auch ein Auftrag für neue Rangierlokomotiven.
Es
war eine einfache Rechnung, denn die ältesten eingesetzten
Lokomotiven
der Schweiz waren die
Rangierlokomotiven.
Die in der Schweiz eingesetzten Modelle waren daher schon älter und sie
wurden seit einigen Jahren nicht mehr gebaut. Das zeigte zwar, wie gut
gelungen die Modelle waren, aber mit dem zunehmenden Alter wurden die
Fahrzeuge anfälliger auf Störungen. Zudem war der
Stangenantrieb
nicht mehr zeitgemäss.
Ein
Problem das bei den damals knappen finanziellen Mitteln gross war. Je
grösser daher eine Serie wurde, desto geringer waren die Kosten für ein
Exemplar. Das war nicht neu, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Bevor wir uns jedoch mit genaueren Modellen be-fassen, sehen wir uns daher die Entwicklung von speziellen für den Rangierdienst gebauten Lokomo-tiven an. In den Anfängen gab es sie schlicht noch nicht.
Die
Aufgaben wurden von den normalen im Einsatz stehenden Maschinen
übernommen. Das funktionierte sehr gut und daher erachtete niemand bei den
Bahnen die Entwicklung von speziellen Fahrzeugen als dringend erforderlich
an.
Mit
zunehmender Geschwindigkeit und der Erhöhung der
Leistung
änderte sich das jedoch. Die alten Maschinen aus den Anfängen des
Betriebes konnten auf der Strecke nicht mehr mithalten. Sie hatten eine zu
geringe Leistung und auch beim Tempo war mit 40 km/h längst kein grosser
Erfolg mehr zu erreichen. Die Züge fuhren um 1900 bereits mit bis zu 90
km/h durch die Schweiz. Daher war eine grosse Zahl Modelle vorhanden, die
nicht mehr gebraucht wurden.
Das
bedeutete, dass diese entweder verkauft, oder auf den Schrott gestellt
wurden. Lediglich bei grösseren
Bahngesellschaften
behielt man die Modelle und verwendete sie in den grossen
Bahnhöfen
für die Formation der Züge. Es entstanden spezielle
Rangierlokomotiven.
Trotzdem gab es damit ein Problem, denn es waren oft auch alte Maschinen.
Gerade bei Dampflokomotiven führte das zu einen grösseren Aufwand bei den
Kesseln.
Käufe von kleineren und finanziell schwachen Bahnen linderten lange den
Notstand in diesen Be-reich. Das änderte sich, als auch diese
Gesell-schaften keine passenden Modelle mehr im Bestand hatten. Es musste eine für diesen Zweck entwickelte Bau-reihe angeschafft werden. Diese Maschinen waren so ausgelegt worden, dass sie in Bahnhöfen ver-kehrten und selten bis gar nie die Strecke befuhren.
Dabei sollten sie möglichst wenig vom vorhandenen Platz beanspruchen.
Kurze handliche Maschinen waren gefragt, denn die Anlagen waren längstens
am Anschlag angekommen und da war bei den Rangierarbeiten oft die
Lokomotive
im Weg. Ein Ausziehgeleise hatte eine bestimmte Länge. Diese wurde von den Wagen und der Lokomotive beansprucht.
Je
geringer jedoch der Anteil für das
Triebfahrzeug
war, desto mehr Wagen konnten mitgenommen werden. So mussten die
Kompositionen
nicht getrennt werden. Statt zwei Fahrten war die Arbeit in einem
Manöver
beendet. Die
Weichen
wurden so weniger lang belegt und die Züge konnten früher wieder auf die
Reise gehen.
Durch den Verzicht auf Laufachsen, wurde die maximale Geschwindigkeit
begrenzt. Das erlaubte bei der
Lokomotive
kleinere
Räder
und damit eine deutlich höhere
Zugkraft.
Entstanden war so eine für den
Rangierdienst
passende Lokomotive. Hatten die ersten Modelle noch zwei
Triebachsen
erhalten, musste deren Anzahl schnell um eine erhöht werden. Es entstand
so eine dreiachsige
Rangierlokomotive,
die in den
Bahnhöfen
gute Arbeit leistete.
Die
Maschine für den
Rangierdienst
wurde schnell unter dem Namen «Tigerli» bekannt. Diesen bekam sie, weil
sie kräftig war. Die kleine Grösse sorgte letztlich noch für den Zusatz
«li». Der «Tiger» war ein grosser Erfolg. Die Schweiz bekam so eine erste einheitlich auf-gebaute Rangierlokomotive. Sie wurde speziell für diesen Einsatz vorgesehen. So war nur eine ein-fache Bremse mittels eines Wurfhebels vorhanden.
Die
Zugkraft
wurde mit dem
Regulator
bestimmt, da die Steuerung lediglich drei Stellungen kannte. Auf eine
Anpassung der Füllung wurde schlicht verzichtet. Entweder wurde gezogen,
oder gebremst. Mehr gab es nicht.
Ein
weiterer Punkt war die Auslegung des
Kessels.
Dieser war so dimensioniert worden, dass er genug Dampf erzeugen konnte.
Das führte dazu, dass das Feuer nicht jederzeit optimal genährt werden
musste. Man konnte dadurch auf den
Heizer
verzichten und die Maschine nur mit dem Lokführer besetzen. Dieser sah bei
Gelegenheit nach dem Wasserstand und dem Feuer. Dazu wurden immer die
kurzen Standzeiten genutzt.
Der
«Tiger» war eine so gute Entwicklung gewesen, dass er in grosser Stückzahl
für die grossen Gesellschaften und später für die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB gebaut werden konnte. Das reduzierte die Kosten pro
Einheit und erlaubte es daher auch kleineren Bahnen solche
Lokomotiven
zu beschaffen. Diese wollten damit jedoch Züge führen. Kleinere
Anpassungen waren dazu erforderlich, aber sie zeigten, wie gut das Modell
war.
Sie
wurde deshalb für diesen Einsatz etwas modifiziert. Damit konnten die
Wagen geheizt werden. Ein Umstand, der mit einer verbesserten Befeuerung
erreicht werden konnte. Da-her waren auf der Strecke oft wieder
Heizer
anzutreffen. Wir erkennen daher, wie wandlungsfähig die Maschine seiner-zeit gebaut wurde und sie war auch von den ersten neuen elektrischen Lokomotiven nicht sonderlich beeindruckt, denn rangiert wurde weiterhin mit Dampf.
Elektrische
Lokomotiven
waren teuer. Daher beschaffte man anfänglich nur die Modelle für die Züge.
Bei den niederen Aufgaben in den
Bahnhöfen,
wurden die arbeitslos gewor-denen Maschinen verwendet.
Gerade die Lötschbergbahn beschränkte sich auf die Baureihe
Fb 5/7 und nutzte für den
anfallenden
Rangierdienst
die sonst nicht mehr benötigten Modelle der Spiez – Frutigen – Bahn.
Niemand sah darin ein Problem und das war auch so, als die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB mit den elektrischen
Lokomotiven
den Betrieb aufnahmen. Wobei dort bekanntlich der Gotthard im Vordergrund
stand. Die
GB
hatte bereits spezielle
Rangierlokomotiven.
Doch gerade bei den
Staatsbahnen
sah man auch die Lösung von elektrischen Modellen für den
Rangierdienst
vor. Aus diesem Grund wurde die Beschaffung von speziellen
Prototypen
für den Rangiereinsatz ausgelöst. Diese beiden Maschinen kamen letztlich
als Reihe Ee 3/4 in den
Einsatz und sie mussten sich im direkten Vergleich mit der Baureihe
E 3/3 messen. Erst
dieser Vergleich sollte über eine spätere Beschaffung entscheiden.
Durch den nun möglichen Verzicht auf die
Lauf-achse
konnte man die Baureihe als
Ee 3/3 bezeich-nen. Der Buchstabe E wurde daher auch zur
Be-zeichnung von
Rangierlokomotiven.
Wir hatten da-mit eine erste andere Deutung. In den folgenden Jahren wurden in mehreren Serien, die immer wieder angepasst wurden, viele Rangierlokomotiven der Baureihe Ee 3/3 beschafft.
Der
Erfolg war so gut, dass auch
Privatbahnen
und Werksbahnen auf diese Modelle setzen konnten. Die Kosten für eine
Maschine waren dank der grossen Serie erneut sehr gering, daher konnten
sich die Gesellschaften den Erwerb leisten. Auf der Strecke verkehren
sollten sie jedoch nicht mehr.
Wie
gut jedoch die elektrische
Rangierlokomotive
war, zeigt sich, als auch die BLS-Gruppe
eine solche Maschine beschaffte. Selbst die schweizerische Post entschied
sich für ein solches Modell. Lediglich die an die SNCF gelieferten Modell
sollten auf der Strecke verkehren. Diese wurden zudem für diesen Einsatz
mit einem zweiten
Stromsystem
versehen. Die
Staatsbahnen
beschafften anschliessend für den
Grenzbahnhof
Basel ähnliche Modelle und führten sie als Reihe
Ee 3/3 II.
Diese Maschinen der grossen Serie hatten jedoch einen Nachteil, denn sie
konnten nur unter einem
Stromsystem
verkehren und sie benötigten eine
Fahrleitung.
Wo diese fehlte, war immer noch die Baureihe
E 3/3 im Einsatz.
Auch wenn nun die Hauptlast bei den elektrischen Modellen lag, auf die
alte Dampflokomotive konnte man daher nicht verzichten. Ein Problem, das
die
Staatsbahnen
der Schweiz mit neuen
Diesellokomotiven
lösten.
Um
die Kosten zu senken, griffen die
Staatsbahnen
auf Teile der neuen
Diesellokomotive
der Reihe Em 3/3
zurück. Diese löste letztlich die alten
E 3/3 auf Anlagen
ohne
Fahrleitung
ab. Damit war die Ent-wicklung von elektrischen
Rangierlokomotiven
abgeschlossen. Damit war die Ausrüstung des Rangierdienstes abgeschlossen. Um 1970 kamen damit die letzten Rangierlokomotiven in Betrieb. In den folgenden Jahren wurden nur noch kleinere Traktoren beschafft.
Das
war für viele kleinere
Privatbahnen
nicht gut, denn er gab auf dem Markt schlicht nichts, das geordert werden
konnte. Besonders dann nicht, wenn die erforderliche
Zugkraft
deutlich über jener der
Rangiertraktoren
liegen sollte.
Wenn wir nun über die Grenzen hinwegsehen, erkennen wir schnell, dass in
den anderen Ländern mit wenigen Ausnahmen mit
Diesellokomotiven
gearbeitet wurde. Gerade die zahlreichen Modelle für den leichten bis
mittelschweren
Rangierdienst
waren so aufgebaut worden. Somit bildete die Schweiz die grosse Ausnahme
und das erkannte man auch bei der Industrie. Daher war die Entwicklung
neuer elektrischer Modelle eingestellt worden.
Auch wenn die neusten Modelle erst wenige Jahre im Einsatz standen. Die
ältesten noch eingesetzten Maschinen waren seit bald 70 Jahren in Betrieb.
Gerade im nicht immer sanften
Rangierdienst,
war das eine enorme
Leistung.
Man konnte um 1980 daher damit rechnen, dass es bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB zu einer neuen Entwicklung von
Lokomotiven
für den Rangierdienst kommen könnte. Diese Beschaffung kam jedoch nicht.
Auch bei einigen
Privatbahnen
war dieser Trend zu beobachten. Lediglich bei der Post mussten immer noch
die einzelnen Wagen rangiert werden. Doch auch dort entstand immer mehr
grosse Paketzentren, die den Aufwand jedoch nicht verringerten. Es wurden daher immer noch leistungsfähige Ran-gierlokomotiven benötigt. Da aber kein grosser Auftrag zu erwarten war, machte man sich bei der Industrie nur halbherzig ans Werk.
Der
Grund war klar, denn in diesen Jahren wurden grosse Serien für den
Personenverkehr
erwartet, denn in der Schweiz sollte 1982 der
Taktfahrplan
eingeführt werden. Neue
Pendelzüge
benötigten je-doch keine
Rangierlokomotive
mehr.
Eigentlich sah das nur die Schweizerische Post etwas anders. Sie rangierte
ihre Wagen in den grossen Zentren selber und benötigte daher
Rangierlokomotiven.
Es war daher die Post, welche sich um zusätzliche Rangierlokomotiven
bemühen musste. Mit von den
Staatsbahnen
übernommenen Maschinen konnte anfänglich der Not etwas begegnet werden.
Trotzdem war das für die verantwortlichen Stellen alles andere als
Befriedigend.
Jedoch waren die Kosten für die Entwicklung einer neuen Baureihe sehr hoch
und daher sollte nicht ein speziell für die Post entwickeltes Modell
entstehen. Eine neue
Rangierlokomotive,
die so ausgelegt werden sollte, dass auch die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB davon hätten profitieren können. Doch es sollten letztlich kleinere
Privatbahnen
aufsteigen. Die anfänglich von der Industrie erhoffte grosse Serie bleib
daher aus.
Im
folgenden Artikel wollen wir daher auf diese
Rangierlokomotive
eingehen. Doch bereits jetzt haben wir die Klärung für den Titel, denn es
sollte ein Modell entstehen, das selbst den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB geliefert werden sollte. Warum es nicht dazu kommen sollte, ist darauf
zurückzuführen, dass die Baureihe
Ee 3/3 wirklich verflucht gut gebaut worden war. Die «Neue»
musste sich daher daran messen.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
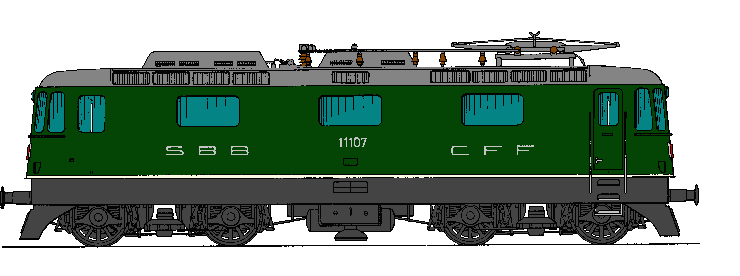 Die
lange Entwicklung der hier vorgestellten
Die
lange Entwicklung der hier vorgestellten 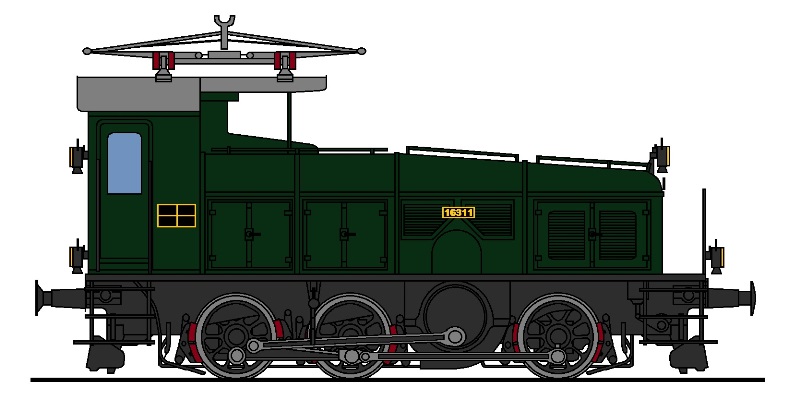 Daher
fehlte eigentlich ein modernes Modell, das auch von kleineren Unternehmen
geordert werden konnte. Diese konnten sich jedoch keine neue Entwicklung
leisten, da nur einzelne Modelle in den Bestand kommen sollten.
Daher
fehlte eigentlich ein modernes Modell, das auch von kleineren Unternehmen
geordert werden konnte. Diese konnten sich jedoch keine neue Entwicklung
leisten, da nur einzelne Modelle in den Bestand kommen sollten. Je
umfangreicher die Anlagen jedoch wurden, wie knapper wurde der Bestand.
Die ersten Maschinen reichten nicht mehr für den Einsatz. Daher mussten
die einzelnen Gesellschaften nach passenden Mo-dellen Ausschau halten.
Je
umfangreicher die Anlagen jedoch wurden, wie knapper wurde der Bestand.
Die ersten Maschinen reichten nicht mehr für den Einsatz. Daher mussten
die einzelnen Gesellschaften nach passenden Mo-dellen Ausschau halten.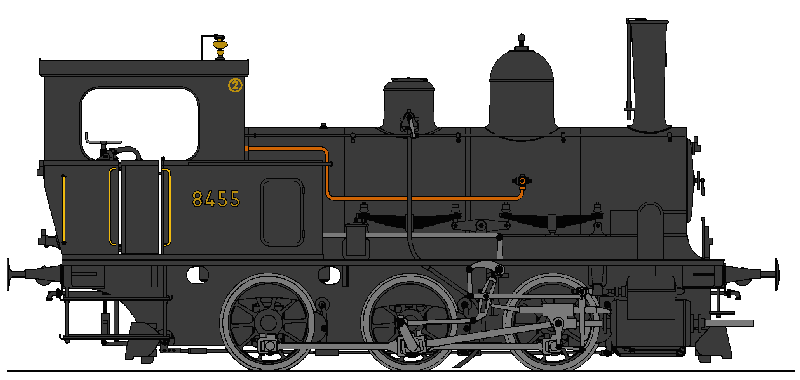 Bekannt
wurde dabei die Baureihe
Bekannt
wurde dabei die Baureihe 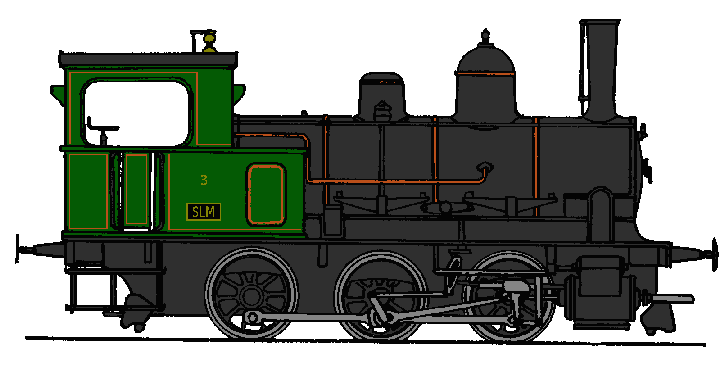 Besonders
zu erwähnen ist hier sicherlich die nahezu baugleiche
Besonders
zu erwähnen ist hier sicherlich die nahezu baugleiche 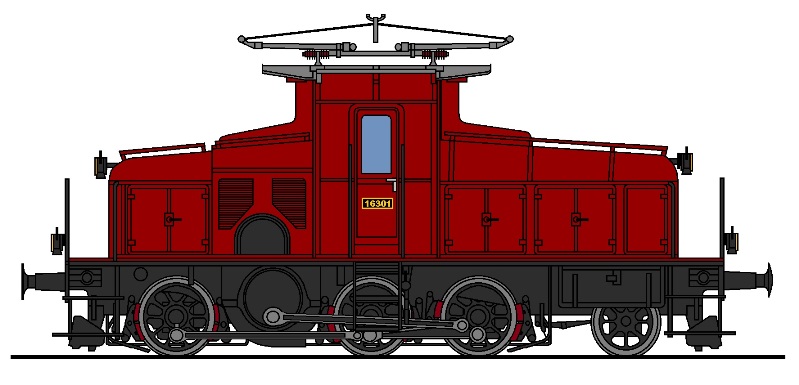 Gerade
dieser Vergleich zeigte, dass sich elektri-sche
Gerade
dieser Vergleich zeigte, dass sich elektri-sche
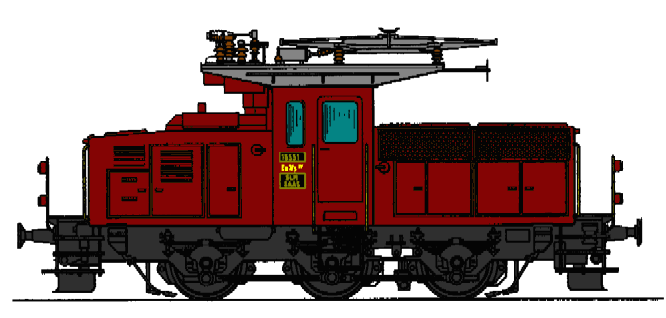 Um
auch Anlagen mit
Um
auch Anlagen mit  Da
bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Aufwand beim
Da
bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Aufwand beim