|
Entwicklung und Bestellung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Die Entwicklung der neuen Baureihe für die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB begann in deren Büro in Bern. Dort musste
das Personal zuerst einmal herausfinden, was im Betrieb benötigt wird. So
definierte man das neue
Triebfahrzeug nach dem Bedarf. Die gewünschte
Maschine sollte zugkräftig sein, hohe Geschwindigkeiten erreichen und
dabei sowohl vor Reise- als auch vor
Güterzügen eingesetzt werden können.
Anders ausgedrückt wünschte man eine universell
einsetzbare
Lokomotive. Diese hätte mit allen Zügen auf dem gesamten Netz
verkehren können. Man erhoffte sich so Einsparungen bei der Vorhaltung von
Ersatzteilen. Ebenfalls erleichtert werden sollte, die Schulung des Personals, denn dieses musste nur
einen einzigen Typ kennen lernen. Ein Prinzip, das auch die BLS im Jahre
1913 mit ihrer Baureihe Be 5/7 verfolgt hatte. Es funktionierte sogar noch
recht gut.
Erstmals sollte also eine Universalmaschine
entstehen, die sowohl am Gotthard, als auch im
Flachland verwendet werden
konnte. Solche
Lokomotiven sollten in der Folge bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB immer wieder beschafft werden, wobei im Bestand der
Staatsbahnen kaum eine Lokomotive so vielseitig eingesetzt wurde, wie die
hier beschriebene Maschine. Nur, bis jetzt gab es diese noch gar nicht. Auch wenn von Seiten des Bestellers in den Unterlagen vom Gotthard gesprochen wurde, erwartete man vergleichbare Werte auch auf der steilen Südrampe des Simplontunnels. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sahen die Strecke über den Gotthard als Muster. In der Folge waren die nassgebenden Neigungen immer in diesem Bereich bei 26‰ angesiedelt worden. Eine für die Hersteller vereinfachte Lösung.
Blickte man in den Bestand der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB, waren zwar
Lokomotiven mit vier
Triebachsen vorhanden,
aber allesamt waren zu langsam und gehörten zur ersten Generation von
Lokomotiven. Die Technik war aber schon weit fortgeschritten, so dass eine
geänderte Maschine dieser Typen nicht mehr in Frage kam. Jedoch war da
noch die Baureihe Ae 4/8. Eine einzelne Maschine, die eigentlich nie
weiterverfolgt werden sollte.
Die
Lokomotive konnte gerade einmal das
Pro-gramm der Maschinen mit drei
Triebachsen er-füllen. Ein Nachbau war
deshalb nicht sinnvoll. Die Ae 4/8 mit der Nummer 11 000 (ab 1929: 11 300)
sollte deshalb ein Einzelstück bleiben.
Zudem war klar, die neue
Lokomotive sollte keine
Gelenklokomotive sein, sie sollte über einen
Einzelachsantrieb verfügen
und es sollte eine
Rahmenlokomotive sein. Die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB zogen eine Lokomotive mit Rahmen der Drehgestellbauart vor, weil sie
einfacher im Aufbau war. Im Unterhalt erschien diese Konstruktion zudem
billiger. Heute wissen wir, dass Drehgestell-Lokomotiven unschlagbar sind,
aber im Jahre 1925 war das noch anders.
Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB erinnerte
man sich dabei auch an eine Studie, die bei der Planung der Baureihe Ae
3/6 I angestellt wurde. Diese sah eine abgeänderte Maschine mit vier
Triebachsen vor. Darauf konnte man aufbauen, denn die Zeit drängte und
eine völlig neu konstruierte
Lokomotive war nicht rechtzeitig verfügbar.
Wenn man die Ae 3/6 I genauer betrachten würde, könnte man erkennen, dass
die Lokomotive den anderen Maschinen in allen Punkten überlegen war.
Die Maschine zeigte deutlich, was im
BBC-Einzelachsantrieb nach Buchli steckte. Das war ein Punkt, den die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB hoch werteten, denn man wollte nicht
wieder die Probleme der Reihe Ae 3/5 erleben. Die neue
Lokomotive sollte
gut funktionieren. Schlicht sollte die
Zugkraft der Baureihe
Be 4/6 mit
der Baureihe Ae 3/6 I kombiniert werden. Jetzt musste das nur noch der
entsprechenden Industrie verkauft werden.
Das war neu, denn bisher gewährte die
Staatsbahn viele Frei-heiten.
So konnten die Hersteller ihre Ideen umsetzen. Die Folge davon waren
letztlich drei unterschiedliche Baureihen mit der Bezeichnung Ae 3/6. Das
durfte nicht mehr passieren.
So war klar vorgeschrieben, dass die
Lokomotive die
Achs-anordnung 2’Do1’ haben muss. Diese
Achsfolge war also vom Besteller
zwingend vorgeschrieben und sollte nicht geändert werden. Hier könnte aber
ein Problem entstehen, denn die Geschichte zeigte, dass die
Be 5/7 der BLS
nicht so ruhig um die
Kurven fuhr, wie das die Baureihe
Ce 6/8 II mit den
Drehgestellen tat. Doch die Vorgabe war klar, man erwartete diese
Achsfolge.
Gleiches galt für den BBC-Einzelachsantrieb nach
Buchli. Somit stand schnell fest, dass die
Lokomotive die Typenbezeichnung
Ae 4/7 erhalten sollte. Damit haben wir im mechanischen Teil genau die
Kombination der Einleitung erhalten. Oft wird deshalb die Baureihe Ae 4/7
als eine um eine
Triebachse erweiterte Maschine der Reihe Ae 3/6 I sei.
Dies stimmt jedoch nicht, da die neue Maschine völlig neu konstruiert
werden musste.
Was auf den ersten Blick unkonventionell erscheint,
war klar durchdacht und erst noch mit modernen Ideen zu vertreten. Die
einheitlichen
Antriebe und
Triebachsen konnten die Kosten beim Unterhalt
senken, denn es mussten weniger spezielle Ersatzteile beschafft und an
Lager gehalten werden. Das senkte Kosten und schaffte in den Werkstätten
auch Platz. Die Vorteile lagen damit klar auf der Seite der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Wie das jedoch gemeint war, zeigt die Bestellung. Der
mechanische Teil wurde bei der Schweizerischen Lokomotiv- und
Maschinenfabrik in Winterthur SLM bestellt. Dort sollte das
Laufwerk, der
Kasten, die
Führerstände und die
Antriebe eingebaut werden. Diese Hülle
wurde anschliessend dem Elektriker übergeben, der daraus eine
Lokomotive
machte. Daher waren diese Teile gänzlich von der elektrischen Ausrüstung
unabhängig.
An die elektrische Ausrüstung waren jedoch grosse
Anforderungen gestellt worden, denn die
Lokomotive sollte bei einer
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h noch eine genügend grosse
Zugkraft für
die
Steilrampen des Gotthards und des Simplons haben. Wobei natürlich
diese Geschwindigkeit in den genannten Steigungen wegen den
Kurven gar
nicht gefahren werden konnte. Hier war daher den Herstellern eine gewisse
Freiheit eingebaut worden.
So war klar gefordert worden, dass die
Lokomotive auf
Strecken mit 2 ‰ Steigung 600 Tonnen schwere Züge mit 90 km/h befördern
musste. Auf 12 ‰ sollten mit unveränderter Last noch 65 km/h möglich sein.
Für den Gotthard und daher für Steigungen von bis zu 26‰, forderte man
noch 360 Tonnen bei 65 km/h. Somit erwarten die Schweizerischen
Bundesbahnen ab Steigungen von 12‰ erste Einbussen bei der verfügbaren
Zugkraft.
Bei der neuen Lokomotive er-wartete die Staatsbahn eine Steigerung von 60 Tonnen und erst noch eine Steigerung bei der Geschwindigkeit auf 65 km/h.
Dies sollte im
Pflichtenheft le-tztlich auch das grösste Problem sein und die geforderte
Normallast sollte nicht erreicht werden.
Die zulässigen
Achslasten wurden mit 20 Tonnen auf
den
Triebachsen und mit 15 Tonnen auf den
Laufachsen angegeben. Maximal
waren damit eigentlich 125 Tonnen möglich gewesen. Die Schweizerischen
Bundesbahnen erwarteten jedoch, dass die
Lokomotive nicht schwerer als 120
Tonnen sein sollte. Eine Toleranz von lediglich 2% wurde den Erbauern
jedoch zugestanden. Mit den geforderten
Normallasten keine leichte
Aufgabe.
Die Lokomotive durfte jedoch eine
Meterlast von 7,2
t/m nicht überschreiten. Damit konnte die Maschine auf Strecken eingesetzt
werden, die über die
Streckenklasse C3 verfügten. Es war also klar, dass
die neue
Lokomotive nicht auf allen
Nebenstrecken eingesetzt werden
konnte. Hier muss erwähnt werden, dass davon eigentlich nur
Nebenbahnen
betroffen waren, denn dort gab es noch Strecken, die nur die
Streckenklasse B erlaubten.
Damit hatte man die
Lokomotive definiert und das
Pflichtenheft wurde der Industrie übergeben. Die einzelnen Hersteller
konnten anhand dieser Angaben ihre Vorschläge einreichen. Damit waren
jedoch viele Ideen durch das Pflichtenheft vernichtet worden. Was jedoch
im Pflichtenheft fehlte, war eine
elektrische
Bremse, so dass es hier
sicherlich von den Herstellern abhing, was letztlich angeboten wurde und
diese Angebote sehen wir uns an.
Damit hatte es der Mechaniker
eigentlich noch einfach, denn das war ja die Forderung der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB. Leichte konstruktive Anpassungen wurden jedoch
vorgesehen, so dass die Maschine mo-derner wirken sollte. Die Brown Boveri und Co BBC in Münchenstein sah eine elektrische Ausrüstung vor, die über den bewährten Stufenschalter der Baureihe Be 4/6 geregelt werden sollte.
Eine
elektrische
Bremse wurde
nicht vorgesehen und ge-genüber der Baureihe Ae 3/6 I sollten leicht
stärkere Mo-toren verbaut werden. Bei der
Leistung sah man 2 300 kW oder
3 125 PS vor. Sie haben richtig gesehen, man richtete sich nun nach den kW
und nicht mehr nach den PS.
Besonders war hier, dass die BBC bei der elektrischen
Ausrüstung auch komplett neue Wege vorgeschlagen hatte. Darunter befand
sich eine ganze spannende Idee. Bei der Baureihe Ae 4/7 sollte die
Spannung der
Fahrleitung in einem
Umrichter umgeformt werden. Damit hätten
hier auch andere
Fahrmotoren, wie solche für
Drehstrom, verwendet werden
können. Die Idee war damals jedoch so absurd, dass sie nicht
weiterverfolgt wurde.
Von der Maschinenfabrik Oerlikon MFO wurde eine
ähnliche elektrische Ausrüstung für die Reihe Ae 4/7 vorgeschlagen, jedoch
sollte die Regelung der
Fahrstufen durch
Hüpfer erfolgen. Bei der Anzahl
Fahrstufen war man sogar ein wenig über der geforderten Menge. Damit
sollte eine feinfühlige Regelung der
Zugkraft möglich sein. Gerade bei
schweren Anfahrten schien dies ein grosser Vorteil zu sein, da die Kraft
besser aufgebaut werden konnte.
Daher sah die MFO bei ihrer Maschine eine elektrische Nutzstrombremse nach Behn-Eschenburg vor, wie sie schon bei der Baureihe Ce 6/8 II sehr erfolgreich umge-setzt worden war.
Hier
muss erwähnt werden, dass es damals nur der MFO möglich war, solche
Bremsen zu verwirklich.
Andere Hersteller nutzten
Widerstände. Bei der Société Anonym des Ateliers de Sécheron SAAS beabsichtige man eine elektrische Ausrüstung, die eben-falls mit Hüpfern gesteuert wurde.
Speziell hier war, dass man in Genève als Abgrenzung von
den beiden anderen Herstellern des elektrischen Teils die Möglichkeit
einer
Vielfachsteuerung vorgesehen hatte. Jedoch erachtete man auch hier
eine
elektrische
Bremse als nicht unbedingt notwendig und verzichtete
daher darauf.
Den Auftrag zum Bau von vorerst zwei
Prototypen
erteilten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Oktober 1925. Die beiden
Lokomotiven sollten von der SLM (mechanischer Teil) und von der BBC
(elektrische Ausrüstung und Antriebe) erbaut werden. Sie sollten die
Fahrzeugnummern 10 901 und 10 902 erhalten. Die beiden Lokomotiven hatten
je eine
Leistung von 2 300 kW oder 3 120 PS und die Bezeichnung Ae 4/7
erhalten.
Bei der anschliessenden Bestellung wurden auch die
unterlegenen Anbieter MFO und SAAS berücksichtigt. Jedoch konnten diese
nicht frei arbeiten, denn der mechanische Teil blieb identisch. Damit auch
die
Antriebe von BBC und die
Fahrmotoren. Bei der eigentlichen
elektrischen Ausrüstung waren sie jedoch weitestgehend frei und konnten so
ihre Erkenntnisse bei der
Lokomotive zumindest bei den in Serie gebauten
Maschinen einbringen.
Bei den
Lokomotiven
befürchtete man wegen den Erfahrungen mit den beiden
Be 4/6 ein
kompliziertes System, das nur schwer eingerichtet werden könn-te. Daher der
Verzicht.
Insgesamt wurden die
Lokomotiven der Baureihe Ae 4/7
in vier weiteren Losen bestellt. Die letzte Bestellung wurde am 21. April
1931 frei gegeben. Es entstanden so 127 nahezu identisch aussehende
Lokomotiven. Elektrische Unterschiede sollten aber erneut vorhanden sein.
Trotzdem verzichtete man bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf die
Führung eines Index. Die Lokomotiven hatten daher durchwegs die
Bezeichnung Ae 4/7 erhalten.
Eine grössere Serie
Lokomotiven sollte es in der
Schweiz erst wieder mit der Baureihe
Re 4/4
II zusammen mit der
Re 4/4
III
geben, die dann aber die Ae 4/7 um Längen überholte und mit nahezu 300
Lokomotiven die grösste Serie der Schweizerischen Bundesbahnen SBB blieb.
Die Ae 4/7 konnte aber den zweiten Rang lange über ihr Ausscheiden hinaus
behalten. Was deren gute Konstruktion untermauerte und die erhoffte
einheitliche Lokomotive ergab.
Obwohl diese
Lokomotiven optisch identisch waren, gab
es im elektrischen Bereich gewaltige Unterschiede, die hier noch nicht im
Detail behandelt werden sollten. Damit Sie sich trotzdem ein Bild machen
können, liste ich hier die Maschinen auf. Dabei müssen Sie aber bedenken,
dass alle drei Hersteller hier nur als Elektriker aufgeführt sind und
sämtliche
Antriebe und die Motoren von der BBC stammten. Mechanisch
stammten alle Lokomotiven aus Winterthur.
|
|||||||||||
|
BBC |
MFO |
SAAS |
|||||||||
|
10 901 – 10 916 |
10 917 – 10 918 |
10 939 – 10 951 |
|||||||||
|
10 919 – 10 938 |
10 973 – 11 002 |
11 009 – 11 017 |
|||||||||
|
10 952 – 10 972 |
|||||||||||
| 11 003 – 11 008 | |||||||||||
|
11 018 – 11 027 |
|||||||||||
|
Ihnen ist
sicherlich aufgefallen, dass man anhand der Nummern nicht auf eine
bestimmte Zuordnung der
Gruppen schliessen konnte. So waren die einzelnen
Elektriker durch die Serie verteilt. Eine Lösung, die bei späteren
Bestellungen aufgenommen wurde und sich bis zum Zusammenschluss der
Elektriker behaupten konnte. Intern wurden die Indexe I BBC, II MFO und
III SAAS jedoch noch geführt, jedoch nie angeschrieben.
Bevor wir
nun zu den eigentlichen
Lokomotiven und deren Aufbau kommen, muss noch
erwähnt werden, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit der
Leistung
dieser Lokomotive am Gotthard nicht vollumfänglich zufrieden waren. Der
Grund war, dass die in Steigungen bis 26‰ geforderten
Anhängelasten nicht
ermöglicht werden konnten. Die Baureihe Ae 4/7 musste sich mit 320 Tonnen
begnügen und lag damit 40 Tonnen unter dem
Pflichtenheft.
Zwar wären
mit den
Zugkräften höhere Lasten theoretisch möglich gewesen. Jedoch
klemmten die vier
Triebachsen in den engen Radien. Dadurch musste mehr
Kraft für die Überwindung des Rollwiderstandes aufgebracht werden. Damit
sank aber die mögliche
Anhängelast. Hätte man mehr Zugkraft gehabt, hätten
die Lasten gezogen werden können. Jedoch war das mit der damaligen Technik
noch nicht möglich gewesen.
Das Problem Gotthard sollten schliesslich die
Maschinen der Baureihe
Ae 8/14 lösen. Dabei fällt die
Lokomotive mit der
Nummer 11 801 auf. Dieses Exemplar sah optisch nahezu ähnlich aus, wie die
Reihe Ae 4/7, hatte jedoch von diesem Modell lediglich die
Antriebe
erhalten. Alle anderen Punkte waren für den Gotthard angepasst worden.
Daher wird die Nummer 11 801 in diesem Artikel nicht näher erwähnt werden.
Sie finden die Angaben dazu auf der entsprechenden Seite zur Reihe
Ae 8/14.
Beschafft
wurde diese gigantische
Lokomotive im Anschluss an die Reihe Ae 4/7. Sie
können also im direkten Vergleich erkennen, wie sich die Technik während
dem Bau der Baureihe Ae 4/7 veränderte. Jedoch wollen wir uns nun eine der
erfolgreichsten Lokomotiven der Schweiz genauer ansehen und dabei kommen
wir zuerst zur Arbeit der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik
SLM, die auch Anpassungen vorgenommen hatte.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||

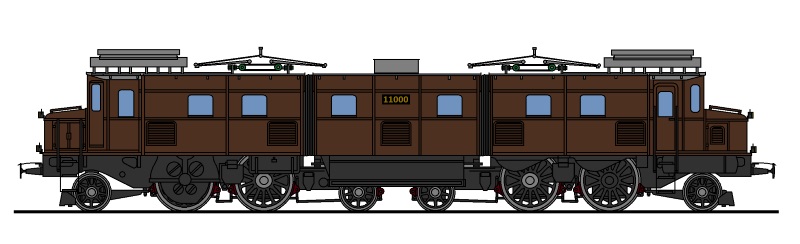 Die als
Die als
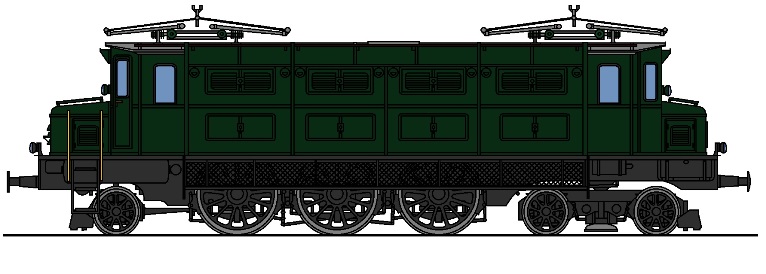 Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB erarbeiteten
deshalb ein
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB erarbeiteten
deshalb ein
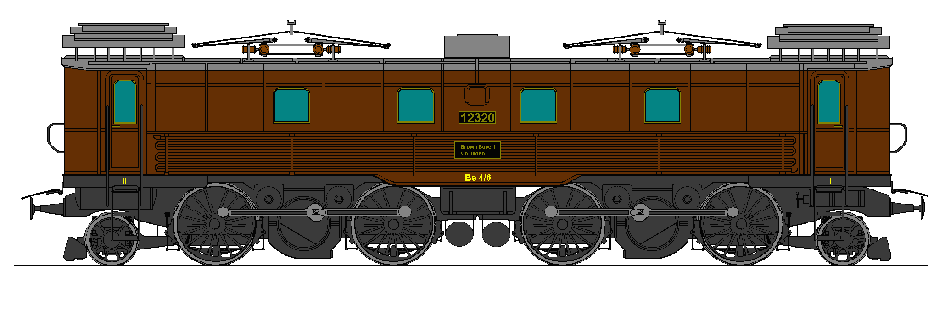 Die Zahlen alleine zeigen die er-wartete Steigerung
nicht auf. Die sieben Jahre alte Baureihe
Die Zahlen alleine zeigen die er-wartete Steigerung
nicht auf. Die sieben Jahre alte Baureihe
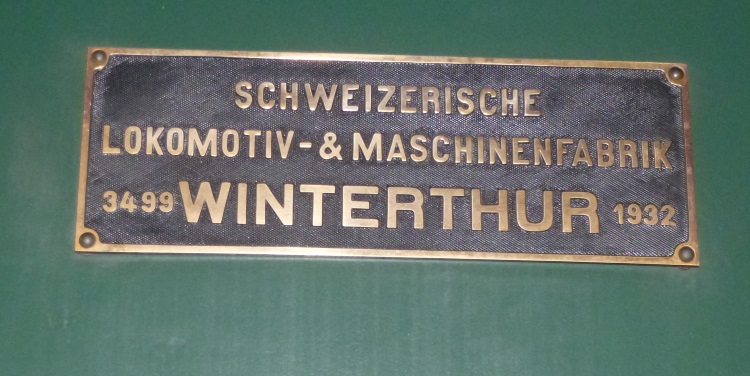 Da die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik
SLM in Winterthur den mechanischen Teil erstellen sollte, wurde dort eine
Da die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik
SLM in Winterthur den mechanischen Teil erstellen sollte, wurde dort eine
 Zudem erachtete man in Oerlikon eine
Zudem erachtete man in Oerlikon eine
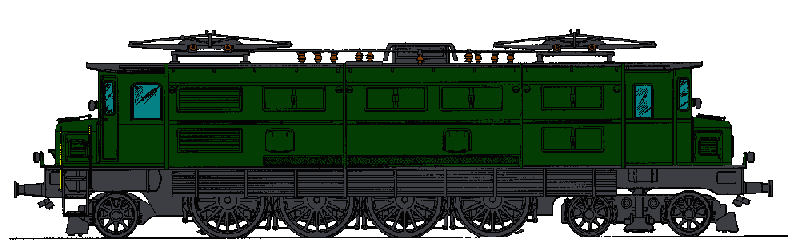 SAAS verzichtete jedoch beim Bau auf die
SAAS verzichtete jedoch beim Bau auf die
