|
Rahmen und Kasten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Für den tragenden Rahmen und den darauf aufgebauten Kasten mit den
beiden
Führerständen,
zeichnete sich bei allen
Lokomotiven die Firma Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM in Winterthur verantwortlich. Hinzu kamen noch das
Laufwerk,
die
Antriebe
und der Anstrich.
Diese fertige Hülle wurde dann den einzelnen Elektrikern zugeführt, welche
anschliessend darin die elektrische Ausrüstung einbauten.
Gegenüber den früheren Baureihen der Schweiz, konnten die Gussteile
reduziert werden. Dadurch konnte im mech-anischen Bereich etwas Gewicht
eingespart werden. Der so entstandene stabile Rahmen wurde an beiden Enden mit einem Stossbalken abgeschlossen. Dieser bestand aus einem etwas kräftigeren Blech. Da dieses jedoch die Kräf-te nicht aufnehmen konnte, musste es im zentralen Be-reich verstärkt werden.
Seitlich stützte sich der
Stossbalken jedoch gegenüber
dem Rahmen mit einfachen Streben ab. Diese Bauweise hatte sich in den
vergangenen Jahren bewährt und wurde daher beibehalten.
Zentral im
Stossbalken
montiert wurden die
Zugvor-richtungen
der
Lokomotive. Dabei wurde der
Zughaken
im Rahmen beweglich montiert. Dadurch war er in der Lage sich in
Längsrichtung zu bewegen. In den anderen Richtungen war er jedoch stabil
und im Stossbalken geführt. Damit er sich in der Ausgangsposition behielt,
war die Längenänderung mit kräftigen
Spiralfedern
versehen worden. Diese
Federn
waren so ausgelegt worden, dass der Haken normalerweise zurückgezogen
wurde.
Am
Zughaken
wurde schliesslich die
Schraubenkupplung
nach
UIC
beweglich befestigt. Dieser Teil der
Zugvorrichtung
war beweglich und mit einer Spindel zur Veränderung der Länge versehen
worden. Wurde die Kupplung jedoch nicht benötigt, lagerte sie entweder im
Zughaken, oder wurde in einem zusätzlich am Stossbalken angebrachten
Hilfshaken eingelegt. Ergänzt wurde die
Kupplung
mit einer ebenfalls am Haken montierten
Notkupplung.
Da
die
Schraubenkupplung
keine
Stosskräfte
aufnehmen konnte, musste sie durch die
Stossvorrichtungen
ergänzt werden. Diese wurden seitlich auf Höhe der
Kupplung
mit Hilfe von Schrauben montiert. Unter diesen
Puffern
befand sich noch der übliche Kupplergriff. Damit gab es bei der Montage
dieser Teile zu den vorhandenen Fahrzeugen keine besondere Änderung, denn
hier waren internationale Normen vorhanden, die eingehalten werden
mussten.
So
hatten die bis ins Jahr 1929 ausgelieferten
Lokomotiven die üblichen
Stangenpuffer
erhalten. Diese waren mit
Spiralfedern
abgefedert worden und entsprachen in der Ausführung, den schon bei
früheren Baureihen verwen-deten Modellen. Diese Stangenpuffer wurden mit runden Puffertellern versehen. Diese wurden jedoch unterschiedlich ausgeführt. Beim linken Modell kam ein flacher Puffer-teller zur Anwendung.
Damit die Kräfte auf den Tellern besser übertragen werden konnten, wurde
der rechte
Puffer
mit einem gewölbten Modell versehen. Somit entsprachen die Puffer auch in
dieser Hinsicht den üblichen Modellen, so dass hier noch keine Erneuerung
eingeführt wurde.
Ab
1930 wurden jedoch
Hülsenpuffer
mit
Gummifedern
verwendet. Diese
Puffer
waren kräftiger aufgebaut, so dass es im Betrieb zu weniger Beschädigungen
kommen sollte. Es muss erwähnt werden, dass die bisherigen
Stangenpuffer
den Kräften von elektrischen
Lokomotiven schlicht nicht mehr gewachsen waren und
daher überall diese neuen Modelle nachgerüstet wurden. Da die Baureihe Ae
4/7 zu jener Zeit ausgeliefert wurde, erfolgte das im Werk.
Bevor wir jedoch die Länge der
Lokomotive bestimmen können, müssen wir noch eine
Massnahme ansehen, die nur die Maschinen der Maschinenfabrik Oerlikon MFO
und auch dort nur die Modelle mit
elektrischer
Bremse betraf. Diese Lokomotiven waren schwerer geraten und
daher für die Länge zu schwer. Daher wurde bei diesen Maschinen zwischen
Stossbalken
und
Puffer
ein verkleideter Balken aus Eichenholz eingebaut.
Daher müssen zu den nachfolgend aufgeführten Massen für die Länge der Lokomotive noch 340 mm zugegeben werden.
Daher hatten diese Maschinen eine Länge von 17 100 mm erhalten.
Alle anderen Modelle der Baureihe Ae 4/7 wur-den jedoch mit 16 760 mm
gemessen. Ergänzt wurden diese Stossbalken mit dem üblichen Übergangsblech. Es konnte hochgeklappt und in dieser Stellung fixiert werden. Damit war es nicht im Weg, wenn gekuppelt werden musste.
Die bei den älteren Modellen dazu gehörenden Handläufe waren
jedoch nicht mehr vorhanden. Daher war der Durchgang auf der Fahrt sehr
abenteuerlich. Man kann sogar behaupten, dass die Person die das
versuchte, sich auf ein Himmelfahrtskommando begab.
Letztlich wurde auf diesem tragfähigen Rahmen der ei-gentliche Kasten und
die beiden
Führerstände
aufgebaut. Damit diese unabhängigen Elemente einen Boden hatten, wurde
dazu der Rahmen mit einem einfachen jedoch nicht geschlossen Blech
abgedeckt. Wegen der speziellen Bauform im Bereich der beiden Führerstände
war diese Abdeckung im Bereich der
Stossbalken
sehr gut zu erkennen. Sie wurde dort vom Personal auch als Umlaufblech
genutzt.
Beginnen wir die Betrachtung der Aufbauten mit dem eigentlichen
Kasten. Dieser war so aufgebaut worden, dass er in der Werkstatt komplett
zerlegt werden konnte. Dazu wurden auf dem Boden mehrere
Portale
aus Winkelprofilen mit Schrauben montiert. Lediglich an den beiden Enden
wurden diese Profile mit einer Wand ausgefüllt. Dieser Abschluss des
Kastens bildete später die Trennwand zwischen dem
Maschinenraum
und dem
Führerstand.
Die beiden Seitenwände unterschieden sich bei dieser Baureihe
wegen den
Antrieben deutlich voneinander. Der Grund war, dass
der
BBC-Einzelachsantrieb
bei diesen Maschinen einseitig montiert worden war. Zwar wäre eine
beidseitige Montage möglich gewesen. In der Schweiz wurden jedoch
sämtliche Maschinen mit dem
Buchliantrieb
nur einseitig ausgerüstet. Die Folge waren die Seitenwände, die nicht
identisch waren.
Sie ist zudem nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es wurde
offiziell mit diesen Begriffen gearbeitet. Dabei wurde die Apparateseite
der
Lo-komotiven auf der rechten Seite montiert und somit
die
Antriebe links.
Jetzt müssen wir nur noch die Richtung der
Lokomotive wissen und haben die Position der Wände
definiert. Hilfe bietet uns das
Laufwerk
mit der
Achsfolge.
Diese wurde grundsätzlich mit 2’Do1’ angegeben. Damit musste der
Führerstand
eins über dem
Laufdrehgestell
zu liegen kommen. Die Richtungen in diesem Artikel beziehen sich daher bei
der Lokomotive immer so, dass in Fahrrichtung geblickt wird und dass sich
das
Drehgestell
vorne befindet.
Da sich diese Seitenwände deutlich unterschieden, beginne ich die
Betrachtung mit der Apparateseite. Sie war leicht zu erkennen, da es auf
dieser Seite keine Fenster gab und die Wand daher geschlossen wirkte.
Wegen den
Portalen
und den einzelnen Segmenten, wirkte dieser Effekt jedoch nicht so
deutlich. Es gab vorne ein kurzes Segment und anschliessend zwei längere
Abschnitte. Sie wurden zudem in zwei Reihen aufgebaut.
Abgegrenzt wurden diese Segmente mit Hilfe der Nietenbänder. Diese
gab es im Bereich der
Portale
und zur Unterteilung der Wand in horizontaler Richtung. Jedoch gab es nur
innerhalb der Wand Nieten. Gegenüber dem Boden und der beiden Wände vorne
und hinten, wurde die Wand jedoch verschraubt. Dank dieser Lösung konnte
die ganze Seite ohne entfernen der Nieten geöffnet werden. Eine
Erleichterung für den Unterhalt.
Wie wichtig diese Unterteilung der Wand war, zeigt sich schnell,
wenn ich erwähne, dass gewisse Segmente bei den
Lokomotiven nicht identisch ausgeführt wurden. Damit es
nicht zu kompliziert wird, betrachten wir jedes Segment einzeln und dabei
beginnen wir vorne und unten. Als Hilfe für jene, die es immer noch nicht
wissen, das war im Bereich des
Drehgestells und somit hinter dem
Führerstand
I. Wir befinden uns im Bereich der kurzen Segmente.
Ein massiver Riegel in der Mitte verschloss die Türchen und damit
die Öffnung. Damit sich diese Türen während der Fahrt nicht öffnen
konnten, wurde der Bedienhebel mit einem zusätzlichen Gewicht beschwert.
Er war daher sehr gut zu erkennen. Auf dem weiteren Weg durch die Wand der Apparateseite können wir davon ausgehen, dass die oben erwähnten Wartungsluken ohne andere Hinweise dieser Ausführung entsprachen.
Das galt auch für das obere Segment dieses kurzen Ab-schnittes. Es
hatte lediglich am oberen Rand zusätzlich die Ösen für die Hebewerkzeuge
bekommen. Diese wurden jedoch bei allen Segmenten der oberen Reihe in den
Ecken angeordnet.
Die weiteren Segmente dieser Wand waren von identischer Länge und
in ihrer Abmessung etwa doppelt so lang, wie das vorher beschrieben erste
Paar. In der zweiten Reihe gab es unten eine einfache Wand, die lediglich
mit einem einfachen Deckel versehen wurde. Dieser war mit Verschlüssen
ohne Griff verriegelt worden und die Lucke konnte nach unten aufgeklappt
werden. Beim der oberen Reihe waren in diesem Bereich zwei Wartungsluken,
wie vorher beschrieben, eingebaut worden.
Damit kommen wir zur letzten Sektion mit Segmenten. Dabei war der
untere Bereich mit einem weiteren Fach wie vorher beschrieben versehen
worden. Das Segment entsprach dem zuvor vorgestellten Exemplar. Dieses
Fach war auf der rechten Seite angeordnet, damit links genug Platz für ein
Lüftungsgitter
vorhanden war. Dieses Gitter hatte die Grösse der schon erwähnten
Wartungsluken und verfügte über waagerecht verlaufende Lamellen.
Auf der linken Seite wurde eine weitere Wartungsluke vorge-sehen,
die aber zusätzlich als
Lüftungsgitter
diente. Davon aus-genommen waren die
Lokomotiven mit den Nummern 11 018 bis 11 027,
denn diese hatten ein normales Lüftungsgitter in der
Bauart
des unteren Segmentes erhalten. Zum Abschluss der Apparateseite bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, dass die längeren unteren Segmente nicht vollständig geschlossen waren und sich am unteren Rand eine vergitterte Stelle befand, die als Band zu erkennen war.
Sie wurde zur
Kühlung
der
Lokomotive benötigt. Jedoch gab es in diesem Band
keine Jalousien und es war ein einfaches schlichtes feines Gitter.
Unterhalb waren letztlich noch die Leit-ungen der
Kühler
montiert worden.
Die Antriebsseite war ebenfalls in die gleichen Segmente
unter-teilt worden. Die Unterteilung ergab sich, weil die gleichen
Portale
verwendet wurden. Zudem war hier ein einfacherer Aufbau vorhanden, so dass
wir die Segmente eigentlich gar nicht benötigen würden. Es bleibt dazu nur
noch zu erwähnen, dass die Nietenbänder und Verschraubungen identisch
ausgeführt wurden. Daher konnte auch diese Seite leicht entfernt werden.
Die obere Reihe mit Segmenten hatten die Fenster zur Ausleuchtung
des
Maschinenraumes
erhalten. Insgesamt wurden fünf identische Fenster eingebaut, die eine
rechteckige Form hatten und die gleichmässig auf die Länge der Seitenwand
verteilt wurden. So kann hier nicht mit einer bestimmten Position in den
jeweiligen Segmenten gesprochen werden. Es reicht jedoch die gleichmässige
Verteilung in der oberen Reihe.
Die Fenster dienten daher nicht nur der Ausleuchtung, sondern
waren auch als Fluchtweg vorgesehen. War der normale Ausgang über die
Führerstände
nicht mehr mög-lich, konnte der
Maschinenraum
auch über eines der fünf Fenster verlassen werden. Die unteren Segmente waren einfach aufgebaut und waren nur im unteren Bereich mit einem feinen Gitter versehen worden. Wie auf der anderen Seite der Lokomotive wurde dieses Gitter für die Kühlung der Lokomotive benötigt.
Weitere Merkmale gab es hier jedoch nicht mehr, so dass wir
eigentlich den einzigen freien Bereich kennen gelernt haben. Ein
besonderes Merkmal dieser Baureihe, das nur wegen der Aufteilung in die
Antriebs- und Apparateseite entstand. Da der Kasten nun soweit aufgebaut ist und da die beiden Führerstände nicht die Breite des Kastens erreichten, können wir die Breite der Lokomotive bestimmen.
Diese wurde von keinem weiteren Bauteil der Maschine
überschritten. In den Unterlagen wurde die Breite mit 2 950 mm angegeben.
Vom
Lichtraumprofil
wären für diese Baureihe jedoch maximal 3 150 mm zugelassen gewesen. Damit
füllte die
Lokomotive den Raum sehr gut aus.
Damit kommen wir zu den beiden
Führerständen.
Diese wurden auf Wunsch der Schweizerischen Bundesbahnen SBB von anderen
Baureihen übernommen und waren nicht so breit, wie der restliche Kasten.
Sie waren von der Reihe Ce 6/8 II
abgeleitet worden. Das war jedoch nicht zu erkennen, da dort die langen
Vorbauten
diese Tatsache verdeckten. Jedoch gab es wegen den neuen Erkenntnissen
auch leichte Anpassungen, die erwähnt werden müssen.
Viel gibt es dazu nicht zu sagen, denn der Bereich wurde bei der fertigen Lokomotive durch die Vorbauten abgedeckt und war daher nicht mehr zu sehen.
Es ist jedoch wichtig, dass wir eine Wand zu den Hau-ben vor dem
Führerstand
hatten und es so eigentlich zwei Baugruppen waren. Im oberen Bereich waren die drei Frontfenster einge-baut worden. Dabei wurden die beiden seitlichen Fen-ster grösser ausgeführt. Dadurch wurde das mittlere Fenster recht schmal. Speziell dabei war, dass dieses Fenster, das mit Schei-ben aus Sicherheitsglas versehen wurde, geöffnet wer-den konnte.
Das war nötig, damit bei der Lampe der
Dienstbe-leuchtung
vor diesem
Frontfenster
die
Glühbirne
ge-wechselt und Steckscheiben angebracht werden konn-ten. Die beiden seitlichen Fenster der Front waren identisch aufgebaut worden. Sie bestanden aus einer fest in der Wand eingebauten Scheibe aus Sicherheitsglas.
Dieses konnte mit einer Fensterheizung aus feinen Dräh-ten geheizt
werden. Zur Reinigung wurden vor den Scheiben einfache
Scheibenwischer
montiert. Dabei wurde jedoch nur das Modell auf der Seite des Lokführers
mit einem pneumatischen
Antrieb ausgerüstet.
Weil die
Frontwand
nicht bis ganz nach aussen geführt wurde, gab es zwei seitliche
Eckpartien, Diese wurden in einem Winkel von 50 Grad nach hinten gezogen.
Damit wurde die Strömung der Luft bei der Fahrt etwas verbessert und das
bei rechteckiger Kante entstehende pfeifen konnte gemildert werden. Einige
geringe aerodynamische Massnahmen, die aber eher der Ethik und der
technischen Funktion dienten, als dass viel auf die Strömung der Luft
geachtet worden wäre.
Sie diente dem Personal als Weg, wenn dieses vom Zug auf die
Lokomotive gelangen wollte. So musste in diesem
Fall nicht abgestiegen werden. Theoretisch hätte dieser Wechsel auch
während der Fahrt erfolgen können, nur das blieb eine waghalsige Aktion. Sowohl in der Türe, als auch in der Eckpartie der rechten Seite, waren Fenster eingebaut worden. Diese Fenster waren, wie jene der Front, fest eingebaut worden und konnten nicht öffnet werden.
Eine Beheizung, oder gar eine Reinigung mit
Scheibenwischer
war auch nicht vorhanden. Die Gläser erlaubten dem Personal einen etwas
besseren Überblick auf den Bereich vor der
Lokomotive. Wobei diese Zone auch sonst nicht überblickt
werden konnte. Wir kommen damit zu den beiden Seitenwänden des Führerstandes. Diese waren gerade so lang, dass zwischen dem eingebauten Führertisch und der Rückwand genug Platz vorhanden war, dass dort eine Person stehen konnte.
Trotzdem blieben es enge Platzverhältnisse. Im Aufbau
unterschieden sich die beiden Seiten bei dieser Baureihe jedoch deutlich.
So war auf der linken Seite eine einfache geschlossene Wand mit Fenster
vorhanden. Dieses recht grosse Fenster konnte vom Führerraum her geöffnet werden. Dabei war es als Senkfenster ausgeführt worden und es konnte komplett geöffnet werden.
Es hatte, wie das identische Fenster in der
Einstiegstüre
auf der rechten Seite, einen senkrechten weissen Strich erhalten. Dieser
war neu eingeführt worden und diente als Information über diese
Senkfenster und so den Zugang zum
Lokomotiv-personal
im besetzten
Führerraum.
Bleibt somit noch die rechte Seite. Dort war keine Wand vorhanden,
denn der Bereich wurde als Einstig von der Seite genutzt. Dazu war eine
Türe vorhanden, die nach innen geöffnet wurde und die über ein Schloss
verfügte. Der Zugang zum
Führerraum
erfolgte mit einer Leiter und den beiden seitlichen
Griffstangen.
Unterschiede zu anderen Baureihen waren hier jedoch nicht vorhanden, da
diese Einstiege kaum anders gelöst werden konnten.
Bevor wir zu diesen
Vorbauten
kommen, muss hier noch der Zugang auf der linken Seite erwähnt wer-den.
Dieser erfolgte über eine Leiter beim
Stoss-balken.
Die beiden seitlichen
Griffstangen
waren da-bei freistehend. Der Vorbau hatte diverse Türchen mit Lüftungsgitter erhalten und selbst der Deckel konnte geöffnet wer-den. Das erlaubte einen vereinfachten Unterhalt der darin montierten Bauteile.
Er nahm nicht die ganze Breite der
Lokomotive ein, so dass ein Umlaufblech entstand. Die
Breite der Hau-be entsprach der
Frontwand.
Speziell waren die hier auf allen Seiten des
Vorbaus
angebrachten waage-recht verlaufenden Haltestangen.
Sowohl der Kasten, als auch die
Führerstände,
muss-ten mit einem gewölbten Dach abgedeckt werden. Dieses Dach war nur
leicht gewölbt worden und hatte die Breite der Führerstände erhalten.
Gerade dort, wurde es bei der
Front
über diese hinaus verlängert. Im Bereich des
Maschinenraumes
konnte dieses Dach entfernt werden und es war in drei Segmenten gestaltet
worden. Jedoch hatte diese Konstruktion im Bereich des Maschinenraumes ein
Problem.
Zwischen den Seitenwänden und dem Dach blieb eine Lücke. Diese
musste jedoch geschlossen werden, wolle man einen geschlossenen
Maschinenraum.
Dazu wurden Eckelemente eingebaut, die stark gerundet wurden und so einen
harmonischen Übergang von der Wand zum Dach erlaubte. Eine Konstruktion,
die auch bei anderen
Lokomotiven beobachtet werden konnte. Diese Rundungen
gehörten jedoch weder zur Wand, noch waren sie Bestandteil des Daches.
Das Dach selber besass im Bereich der Seitenwände zu den beiden
Führerständen
eine schmale Dachrinne. So wurde verhindert, dass hier Wasser eindringen
konnte. Im Bereich des
Maschinenraumes
war diese Rinne jedoch nicht mehr vorhanden, hier wurden dafür seitliche
Stege montiert. Diese dienten dem Personal, das über eine Beim Führerstand
eingebaute
Dachleiter
auf diese gelangen konnte, als sichere Standfläche.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Kernstück
der
Kernstück
der
 Jedoch
gab es bei den
Jedoch
gab es bei den
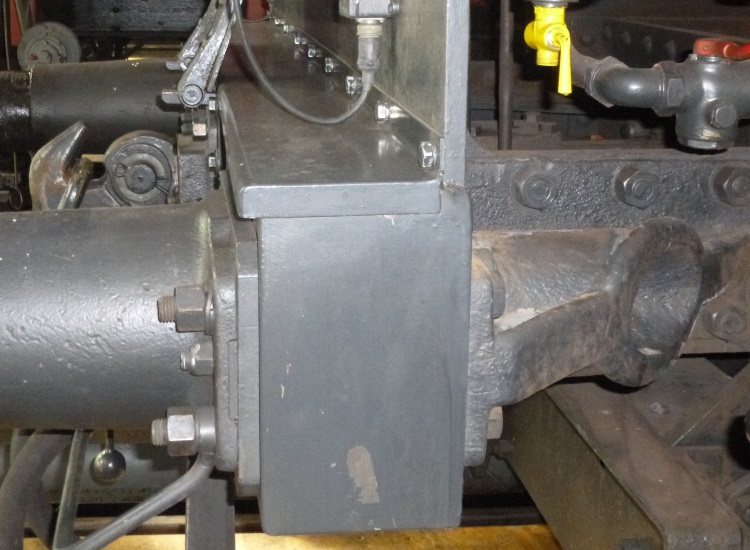 Durch
die Massnahme mit dem Holzbalken wurden die Ma-schinen mit den Nummern
10 973 bis 11 002 länger und konnten die zugelassene
Durch
die Massnahme mit dem Holzbalken wurden die Ma-schinen mit den Nummern
10 973 bis 11 002 länger und konnten die zugelassene
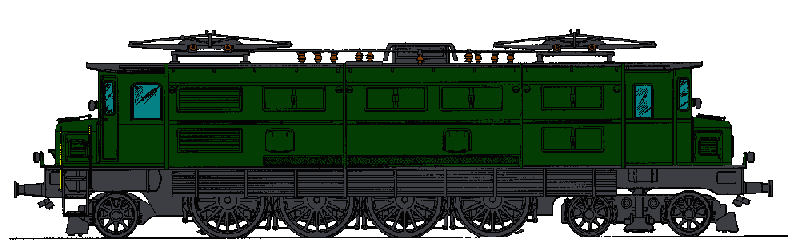 Um
Klarheit zu schaffen, müssen die beiden Wände auch begrifflich
unterschieden werden. Ich wähle dazu die Begriffe «Apparateseite» und
«Antriebs-seite». Eine Unterscheidung, die daher leicht mög-lich ist.
Um
Klarheit zu schaffen, müssen die beiden Wände auch begrifflich
unterschieden werden. Ich wähle dazu die Begriffe «Apparateseite» und
«Antriebs-seite». Eine Unterscheidung, die daher leicht mög-lich ist. Im
ersten Segment, das wir betrachten, hatte es eine Wartungstüre, die mit
einem Blech eingerahmt wurde. Diese Öffnung bestand aus zwei Flügeln, die
sich seitlich öffnen konnten.
Im
ersten Segment, das wir betrachten, hatte es eine Wartungstüre, die mit
einem Blech eingerahmt wurde. Diese Öffnung bestand aus zwei Flügeln, die
sich seitlich öffnen konnten. Bisher
waren die Maschinen identisch aufgebaut, jedoch fehlt uns noch ein
Segment. Dort wurden bei allen
Bisher
waren die Maschinen identisch aufgebaut, jedoch fehlt uns noch ein
Segment. Dort wurden bei allen
 Speziell
an diesen Fenstern war, dass sie geöffnet werden konnten. Dazu wurden sie
seitlich verschoben und konnten so auch nur teilweise, aber auch ganz
geöffnet werden.
Speziell
an diesen Fenstern war, dass sie geöffnet werden konnten. Dazu wurden sie
seitlich verschoben und konnten so auch nur teilweise, aber auch ganz
geöffnet werden. Die
Die
 Die
beiden Eckpartien waren nicht gleich ausgeführt worden, denn auf der
linken Seite erfolgte der Zugang zum
Die
beiden Eckpartien waren nicht gleich ausgeführt worden, denn auf der
linken Seite erfolgte der Zugang zum
 Da
der Kasten und die
Da
der Kasten und die