|
Laufwerk mit Antrieben |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Beim Aufbau des
Fahrwerkes
dieser Baureihe, wurden im Lauf der Produktion Anpassungen vorgenommen.
Diese sollten Verbesserungen bewirken. Warum das so ist, zeigt uns ein
Blick auf die grundsätzliche
Achsfolge.
Mit 2’Do1’ erkennen wir, dass die vier
Triebachsen
in einem Rahmen gelagert wurden. Gerade in engen Radien war das nicht von
Vorteil. Doch warum das so war, erfahren wir, wenn wir einen genaueren
Blick darauf werfen.
Aufgebaut wurde dieses
Laufdrehgestell
nach der
Bauart
Bissel und es besass einen aus Stahlblech aufgebauten Rah-men. Wie beim
Lokomotivrahmen,
wurden dieser
Drehge-stellrahmen
mit Nieten verbunden und so zu einem sta-bilen Bauteil. Die beiden Achsen des Drehgestells lagerten in den damals üblichen Gleitlagern und sie wurden in einem Abstand von 2 200 mm montiert.
Diese
Achsen
wurden mit Lagerschalen aus
Weissmetall
im Lagergehäuse eingebettet. Zur
Schmierung
des schnell drehenden
Lagers
wurde eine Sumpfschmierung verwendet. Das benötigte
Schmiermittel
wurde in einem Gefäss, das sich unmittelbar beim Lager befand mitgeführt.
Die
vertikalen Bewegungen des
Achslagers
wurden hingegen mit
Fett
geschmiert. Damit waren diese gegenüber den älteren Modellen der
Laufdrehgestelle
nach
Bauart
Bissel zum
Drehgestellrahmen
hin beweglich eingebaut worden. Die
Schmierung
mit Fett verhinderte in den offenen
Gleitlagern,
dass sich das
Schmiermittel
im Betrieb zu schnell auswaschen konnte. Ein Prinzip, das in solchen
Fällen immer wieder erfolgreich verwendet wurde.
Jede
Laufachse
im
Bisseldrehgestell wurde mit zwei
Rädern versehen. Dabei wurden zwei
Speichenräder mit
Bandage aufgezogen. Dabei diente die Bandage des Rades
als Verschleissteil. Diese Lösung war bei den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB schon bei älteren
Lokomotiven verwendet worden. Selbst der Durchmesser
dieser Räder wurde mit 950 mm so gewählt, dass hier
Achsen und Räder von
anderen Baureihen verwendet werden konnten.
Wegen den kleinen Rädern mussten die Federn hoch eingebaut werden und zusätzlich auf Federstützen abgestellt werden.
Diese Federstützen wurden zusätzlich noch mit
Schraubenfedern versehen.
Dadurch war eigentlich eine zweistufen
Federung eingebaut worden. Bei der Abstützung der Lokomotive auf dem Dreh-gestell gab es unterschiedliche Ausführungen. Dabei wurde bei allen Lokomotiven ein am Rahmen befestigter Kugelzapfen verwendet.
Dieser stützte sich im
Drehgestell auf ein
Gleitstück ab, das aus Bronze bestand und mit
Fett geschmiert werden
musste. Jedoch wurde die Abfederung in diesem Bereich unterschiedlich
ausgeführt. Damit kommen wir zu den ersten Abweichungen.
Die
Laufdrehgestelle bei den
Lokomotiven mit den Nummern 10 901 bis 10 903, 10 905
bis 10 907 und 10 909 bis 10 942 wurden mit normalen
Blattfedern und
dazwischen eingespannten
Schraubenfedern zentriert und damit gegenüber dem
Hauptrahmen abgefedert. Die restlichen Lokomotiven dieser Baureihe
erhielten zur Zentrierung und Abfederung des
Drehgestells an Stelle der
Schraubenfedern Kegelfedern, die von aussen gut zu erkennen waren.
Damit kommen
wir zu den vier
Triebachsen. Deren Einbau und
Lagerung wurde nicht bei
allen
Lokomotiven identisch gelöst. Wobei sich der Unterschied jedoch nur
bei der vierten Triebachse zeigte und so die ersten drei
Achsen
einheitlich im Rahmen eingebaut wurden. Daher betrachten wir zuerst diese
drei Triebachsen und sehen uns die vierte Achse später noch genauer an.
Dabei beginne ich auch wieder bei der vordersten Triebachse.
Bei der ersten
Triebachse wurden einfache
Gleitlager
verwendet. Diese liessen eine Bewegung der
Achse lediglich in der
vertikalen Richtung zu. Daher sprach man in diesem Bereich von einer
festgelagerten Achse. Die
Lager der zweiten und dritten Triebachse
besassen jedoch ein seitliches Spiel. Dieses wurde mit 2 x 6 mm für die
Achse zwei und mit 2 x 10 mm für die dritte Triebachse angegeben. Damit
waren diese Achsen nicht fest gelagert.
Diese
Lager besassen für den drehenden Teil
Lagerschalen aus
Weissmetall und entsprachen so den
Laufachsen. Es wurde
eine Sumpfschmierung verwendet, die mit Öl geschmiert werden musste. Dank
dieser
Schmierung konnte das
Schmiermittel in einem Behälter im Kasten
mitgeführt werden. Die vertikalen Bewegungen erfolgten mit Gleitbahnen,
die mit
Fett geschmiert wurden. Durch die straffen Gleitbahnen konnten
sich die
Achsen nicht radial einstellen.
Mit einem Durchmesser
von stolzen 1 610 mm waren es die grössten in der Schweiz verwendeten
Räder. Es wurden auch hier
Speichenräder mit
Bandage verwen-det. Jedoch
wurden die Speichen beim Rad auf der Seite des
Antriebes nicht
ausgebrochen. Abgefedert wurden die Triebachsen mit üblichen tiefliegend montierten Blattfedern. Diese Federung war für Geschwindigkeiten bis 100 km/h ideal und sie hatte eine lange Schwingungsdauer. Damit konnte auf den Einbau von Dämpfern verzichtet werden.
Im Gegensatz zu den
Laufachsen im
Laufdrehgestell konnte hier
jedoch auf die gefederten Federstützen verzichtet werden. Daher war der
Aufbau sehr einfach möglich.
Wenn wir zu der vierten
Triebachse kommen, kann
erwähnt werden, dass der Aufbau der
Achse und
Triebräder identisch war. Jedoch
wurde der Abstand zur dritten Triebachse auf einen Wert von 1 960 mm
gestreckt. Wobei dieser Wert nun aber bei einigen
Lokomotiven nur im
geraden
Gleis richtig war. Der Grund lag bei dem bei diesen Maschinen
eingebauten kombinierten
Drehgestell. Damit gab es zwischen den Nummern
deutliche Unterschiede.
Die
Lokomotiven mit den Nummern 10 901, 10 913 bis 10
933 und 10 943 bis 11 027 hatten die vierte
Triebachse zusammen mit der
einzelnen
Laufachse in einem
Javadrehgestell gelagert. Durch diesen Aufbau
veränderte sich die
Achsfolge der Maschinen. Diese musste hier korrekt mi
2’Co(A1’) angegeben werden. Ein Umstand, der jedoch in den Handbüchern
nicht berücksichtigt wurde und daher für alle Maschinen 2’Do1’ verwendet
wurde.
Daher veränderte
sich jedoch der Abstand zur dritten
Triebachse je nach Radius, daher
vorher auch die Erwähn-ung, dass der Abstand hier nur im geraden
Gleis
genannt werden darf. Die Laufachse wurde hingegen im Javadrehgestell als Bissellaufachse ausgeführt. Damit konnte sie zusätzlich noch ausschwenken. Da diese Lösung jedoch nicht opti-mal funktionierte, wurde bei einigen Maschinen dieser Baureihe eine veränderte Lösung verwendet.
Dabei wurde
die
Laufachse nun als
Adamsachse ausgeführt und man sprach von einem
Java-Weiss-Drehgestell. Auf die
Triebachse hatte diese Änderung jedoch
keine Auswirk-ungen.
Dabei ermöglichte diese verbesserte Version des
Javadrehgestells einen besseren Kurvenlauf und eine Reduktion des engsten
befahrbaren Radius. Dieser wurde aber für die ganze Baureihe mit 105 Meter
angegeben. Die
Lokomotiven mit dem Java-Weiss-Drehgestell klemmten bei
diesem Radius weniger. Der feste Achsstand betrug bei den
Javadrehgestellen 3 900 mm, auch wenn eigentlich nur eine
Achse wirklich
fest im Rahmen lagerte.
Kommen wir nun zu den restlichen
Lokomotiven mit den
Nummern 10 902 bis 10 912 und 10 934 bis 10 942. Die vierte
Triebachse
dieser Maschinen wurde, wie die
Achsen zwei und drei im Rahmen seitlich
verschiebbar gelagert. Sie erhöhte daher den festen Radstand bei diesen
Lokomotiven auf stolze 5 860 mm. In den Radien führte das aber dazu, dass
die Maschine immer mehr klemmte. Daher bestimmten diese Modelle den
minimalen Kurvenradius.
Bei den
Lokomotiven ohne diese
Drehgestelle wurde jedoch eine normale
Bissellaufachse verwendet. Ich beschränke mich daher nun auf die
Vorstellung dieser
Laufachse, wobei die Angaben auch für entsprechende
Achse im
Javadrehgestell angewendet werden können.
Die
Bissellaufachse zentrierte sich durch Blatt- und
Schraubenfedern. Die
Achse selber lief in den üblichen
Gleitlagern mit
Lagerschalen aus
Weissmetall die
Schmierung erfolgte mit einer
Sumpfschmierung und das
Schmiermittel war
Öl. Die
Räder entsprachen dabei
dem
Laufdrehgestell und hatten ebenfalls 950 mm Durchmesser. Selbst die
Federung der Achse gegenüber dem Rahmen erfolgte mit der gleichen
Federung.
Zum Schutz
des
Laufwerks wurden am Rahmen des
Drehgestells und vor der einzelnen
Laufachse jeweils zwei
Schienenräumer montiert. Diese wurden mit einer
Stange verbunden und so zusätzlich stabilisiert. Bei der Ausführung
entsprachen diese Schienenräumer den üblichen Modellen, wie sie schon bei
anderen Baureihen verwendet wurden. Dadurch konnte auch hier die
Vorhaltung von Ersatzteilen reduziert werden.
Jede
Triebachse wurde von einem eigenen
Fahrmotor
angetrieben. Dieser war fest im Rahmen der
Lokomotive montiert worden und
reichte in den Rahmen hinein. Das
Drehmoment des Motors wurde
über
tangential gefederte Ritzel auf das grosse
Zahnrad übertragen. Das
Getriebe hatte eine
Übersetzung von
1 :
2.57 erhalten. Das grosse Zahnrad
lief zudem durch ein Ölbad, so dass die Zähne mit normalem
Öl geschmiert
wurden.
Zudem
griffen sie in die am
Triebrad montierten Mitnehmer. Durch die freie
Bewegung der Hebel und die beiden Zahnsegmente konnte sich der
Radsatz frei im
Antrieb bewegen. Das
Getriebe war davon jedoch nicht betroffen. Dieser Buchliantrieb wurde nicht für diese Baureihe entwickelt, sondern kam schon bei den Maschinen der Reihe Ae 3/6 I sehr erfolgreich zur Anwendung. Er wurde nach seinem Erfinder Buchli benannt und unter der Leitung von der Firma BBC eingebaut.
Daher wird der
Antrieb auch
BBC-Einzelachsantrieb genannt.
Der Vorteil bei diesem System nach
Bauart Buchli lag damals in der relativ
kleinen unge-federten Masse und der sauberen Entkopplung des
Getriebes. Eine Verschalung aus einfachem Blech schützte das Getriebe und den Antrieb vor Verschmutzungen aus dem Betrieb. Zudem verhinderte sie, dass Öl aus-treten konnte.
Jedoch war das Gewicht dieses
Antriebes zu hoch, damit diese
Verschalung diesen tragen konnte. Aus diesem Grund musste aussen ein am
Kasten aufgehängter Hilfsrahmen montiert werden. Aufgebaut wurde dieser
Hilfsrahmen aus Stahlguss und er umfasste alle vier Antriebe der
Lokomotive.
Für jeden
Antrieb war daher eine
eigene Pumpe benötigt worden. Als
Schmiermittel wurde auch in diesem
Bereich mit schnellen Bewegungen
Öl verwendet. Letztlich wurde das Drehmoment in den Triebrädern mit Hilfe der Haftreibung zwischen Lauffläche und Schiene in Zugkraft umgewandelt. Dieser wiederum wirkte über die Lagerung und den Rahmen auf den Zughaken.
Es war hier daher eine
klassische Kraftübertragung vorhanden. Da diese von der
Adhäsion abhängig
war, musste eine zusätzliche Einrichtung zur Verbesserung bei schlechtem
Zustand der
Schienen eingebaut werden. Um das Adhäsionsgewicht zu verbessern wurden daher Sandstreueinrichtungen eingebaut. Diese wirkten jeweils auf die erste und dritte Triebachse und streuten den Quarzsand mit Hilfe von Druckluft unmittelbar vor das jeweilige Rad.
Mitgeführt wurde dieser Sand in Behältern, die vom
Maschinenraum aus und
in der Mitte über eine Luke in der Wand der Antriebsseite befüllt werden
konnten. Auch hier setzte man auf die vorhandene Technik. Da der BBC-Einzelachsantrieb nur auf einer Seite der Lokomotive eingebaut wurde, bewirkte sein Gewicht unterschiedliche Belastungen auf den Triebrädern. Um dieses Gewicht auszugleichen, wurde die elektrische Ausrüstung im Maschinenraum auf die andere Seite verschoben.
Trotzdem gelang es nie so
richtig, die Radlasten innerhalb der
Achsen bei diesen
Lokomotiven in
Griff zu bekommen, die Maschinen der Reihe Ae 4/7 standen somit immer irgendwie schief
auf dem
Gleis. Das wirkte sich natürlich auch auf die Abstimmung der Achslasten aus. Die Maschinen der Baureihe Ae 4/7 zeichneten sich daher durch eine ausgeprägte asymmetrische Konstruktion aus.
Um die vorgegebenen Grenzwerte einhalten
zu können, musste der Aufbau genau ausgeführt werden. Daher konnten für
die
Triebachsen 19.3 Tonnen und für die
Laufachsen 13.6 Tonnen angegeben
werden. Die seitlichen Differenzen in den
Achsen waren jedoch sehr gering.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Beginnen
wir mit dem
Beginnen
wir mit dem  Da
die
Da
die
 Eingebaut wurden die
Eingebaut wurden die  Beim
Beim
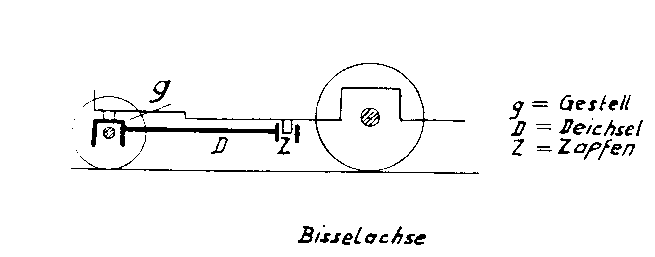 Kommen wir nun zu der einzelnen
Kommen wir nun zu der einzelnen
 Um die
Um die
