|
Entwicklung und Beschaffung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Die Entwicklung von grossen
Diesellokomotiven
für den
Streckendienst
war in der Schweiz eigentlich nie ein Thema. In erster Linie wurde mit
elektrischen Modellen gearbeitet. Jedoch kam gegen den Schluss des
Programms die Idee auf, dass man auf einigen
Nebenstrecken
auf die
Fahrleitung
verzichten könnte. Die
Dieselmotoren
machten diese Idee erst möglich, denn damit konnte leicht eine Strecke
ungestellt werden.
Mit der rigorosen Um-stellung auf den elektri-schen Betrieb auch
auf
Nebenstrecken
gingen selbst diese in niedere Dienste und konnten sich daher nicht
durchsetzen. Auch
Dieselöl
musste im-portiert werden. Trotzdem sollten wir diese rasch ansehen, denn
so verrückt es klingen mag, einige wenige Punkte können auch hier erkannt
werden.
Geführt wurden die
Lokomotiven
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB als
Am 4/4. Sie waren, wie die grosse
Versuchslokomotive
Am 4/6 mit
Gasturbine,
für den
Streckendienst
gebaut worden. Sie besassen daher zwei
Führerstände
an den beiden Enden des Fahrzeuges. Ein zentrales
Führerhaus
war nicht so gut. Auch wenn in den USA so gearbeitet wird, diese Maschinen
werden oft in einer Fahrrichtung verwendet und das wäre auch in Europa
eine Lösung gewesen.
Grosse Dampflokomotiven mit
Schlepptender
mussten nach jeder Fahrt in einem
Depot
eine
Drehscheibe
aufsuchen. Das bedeutete aber, dass die
Lokomotive
nicht gleich auf einen anderen Zug übergehen konnte. Zudem verschwanden
auch in Deutschland immer mehr Drehscheiben. Es war daher kam mehr
möglich, nach der Fahrt die Lokomotive abzudrehen. Ein Problem, das sogar
bis zur Lieferung neuer Maschinen gelöst werden musste.
Güterzüge
mussten damals einen Wagen mitführen, damit der bei diesen Zügen noch
mitreisende Begleiter einen Aufenthaltsraum hatte. Daher wurden bei der
Deutschen Bundesbahn DB, aber auch bei den Österreichischen Bundesbahnen
ÖBB Kabinen auf dem
Tender
aufgebaut. Mit neuen
Lokomotiven
würde bei zwei
Führerständen
der hintere dazu genutzt werden. Auch aus diesem Grund waren Modelle mit
nur einem Führerstand keine Lösung.
Erst die Einführung des
Zugfunks
sollte das Problem mit dem
Zugführer
lösen, denn dieser wurde abgezogen. Doch nun zu den neuen
Lokomotiven
für Deutschland. Bei Diesellokomotiven war es jedoch leicht, die Konstruktion so anzupassen, dass sich die Lösung mit zwei Führerständen ergab. Zudem mussten so ausgerüstete Modelle nicht nach einer Drehscheibe suchen.
Sie konnten also direkt auf den nächsten Zug übergehen. Neben der
besseren Auslastung, konnte auch die Anzahl Modelle verringert werden. Das
auch wenn eine
Diesellokomotive
regelmässig zur Tankstelle musste.
Auch wenn mit den Kabinen auf den
Tender
eine gewisse Verbesserung bei den
Güterzügen
erreicht wurde, auch in Deutschland waren die Dampflokomotiven nicht mehr
zeitgemäss. Die vom Feuer mit Rauch geschwängerte Luft war nicht überall
angesehen. Noch fand man diese Maschinen eine Zumutung. Zudem behinderten
die Aufenthalte um Wasser zu fassen den Betrieb. Es musste also ein Ersatz
her und da ergaben schlicht sich zwei Lösungen.
Eine Elektrifizierung ging nicht, weil dazu schlicht die
finanziellen Mittel fehlten. Daher kam nur der Ersatz mit neuen grossen
Diesellokomotiven
in Frage. Damit war der spätere Einsatz eigentlich klar definiert worden,
denn die Deutsche Bundesbahn DB suchte eine
Lokomotive
als direkter Ersatz für die Dampflokomotiven auf nicht elektrifizierten
Strecken. Es sollte also schlicht ein direkter Ersatz sein.
Diesel
her, Dampf weg und mehr war es nicht.
Daher ist soweit klar, dass es sich um eine
Lokomotive
handelte, die auf normalspurigen Strecken verkehren sollte. Genauer
genannt wurden dabei jedoch die
Haupt-strecken
und daher war eine maximale
Achslast
von 20 Tonnen zu erwarten. Nur schon die Achslast gab klar vor, dass die Loko-motive auf Hauptstrecken in den Einsatz kommen soll. In der Schweiz, aber auch in Deutschland, waren damals längst nicht alle Nebenstrecken für diese Belastung aus-gelegt worden.
Es war also klar zu sehen, dass nicht alle Strecken damit
befahrbar sein sollten. Ein Punkt, der zu oft vergessen geht, da allgemein
angenommen wird, dass die
Achs-lasten
im ganzen Netz identisch sind.
Es wurde eine vierachsige
Lokomotive
erwartet, die über eine
Höchstgeschwindigkeit
von 140 km/h verfüg-te. Obwohl auf vielen
Hauptstrecken
in Deutschland bereits 160 km/h üblich war, diese Werte sollten mit
thermischen Maschinen nicht erreicht werden. In Zukunft sollten die hohen
Geschwindigkeiten den elektrischen Modellen vorbehalten sei. Mehr zu
erkennen ist aber, dass das Tempo in Deutschland damals kaum höher war,
als in der Schweiz.
Eingesetzt werden sollte diese Maschine als
Universallokomotive.
Auch wenn man bei den Dampflokomotiven noch zwischen den
Schnellzugslokomotiven
und den schweren
Güterzugslokomotiven
unterschied. Nun sollte eine universelle Lösung auf den Strecken
eingesetzt werden. Dank dieser speziellen Massnahme konnte die Anzahl
Baureihen
gemildert werden. Auch in Deutschland war diese Lösung durchaus beliebt.
So gemütliche Fahrten waren nicht mehr zeit-gemäss, denn auch ohne
Fahrleitung
sollte die Post abgehen. Ob das klappen konnte, sollte sich mit den
Maschinen zeigen, denn noch waren
Dieselloko-motiven
selten. Gewünscht wurde auch eine einstellbare Leistung. Mit halber Kraft konnten sehr leichte Züge geführt werden. Zudem konnte mit zwei getrennten Strängen beim Antrieb auch die Zuverlässigkeit erhöht werden.
Auch wenn man damals den Begriff
Redundanz
noch nicht kannte, angewendet wurden diese Regelungen bereits und daher
sollten zwei Motoren verbaut werden. Auch wegen der verlangten
Leistung
war so eine Lösung zu erwarten.
Es wurde eine
Leistung
von 2 200 PS verlangt. Damals wurde noch mit diesen Werten gearbeitet,
daher sind diese auch immer besser gerundet, als die korrekten Angaben in
Kilowatt. Eine solche Leistung auf nur vier
Achsen
abgestellt war schon recht ansehnlich. Was heute schon bald bei
elektrischen
Lokomotiven
als
Hilfsdiesel
gilt, war damals schon eine grössere Herausforderung. Die wir nur mit
einem Vergleich verstehen können.
Den Blick in die Schweiz können wir vergessen. Weder die
Baureihe
Bm 4/4, noch die schwere
Bm 6/6 können mithalten. Wir sehen
daher die Nachbarländer an. Diesmal jedoch jene von Deutschland und dabei
kommt man damals sehr schnell zur NOHAB AA 16. Ein Modell nach
amerikanischem Muster mit einer leicht höheren
Leistung.
Jedoch wurde dort für diese das Gewicht so gross, dass man die
Lokomotive
auf sechs
Achsen
abstellte.
Bevor wir zu diesen kommen, müssen wir aber noch einen Punkt aus
dem
Pflichtenheft
ansehen, denn dieser war durchaus üblich und auch in der Schweiz geläufig,
denn man wollte die Ersatzteile so gering wie möglich halten.
Wichtige Bauteile des hydraulischen
Antriebes
sollten zur
Baureihe
VT 08 kompatibel sein. Dieser dreiteilige
Triebzug
mit
Dieselmotor
war in der Schweiz durchaus bekannt, erreichte dieser durchaus auch Ziele
in der Schweiz. Damit war dieses
Pflichtenheft
erstellt und es war keine leichte Aufgabe für die Hersteller. Eine
Diesellokomotive
mit 2 200 PS auf vier
Achsen
abgestellt, war um 1950 durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe.
In einem Punkt unterschieden sich die Beschaffungen der Deutschen
Bundesbahn DB nicht von jenen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Mit
anderen Worten, auch die DB war verpflichtet, die
Triebfahrzeuge
im eigenen Land bauen zu lassen. Das sollte später in der Schweiz durchaus
ein Problem sein, da die Ideen der Erbauer nicht so leicht nachvollziehbar
waren. Besonders dann nicht, wenn man über Jahre nur mit SLM und BBC
arbeitete.
Für den mechanischen Teil zeichnete sich die Firma Krauss-Maffai
AG in München verantwortlich. Wie bei der SLM hatte man sich hier auf den
Bau der mechanischen Teile beschränkt. Dabei kannten sich die beiden
Firmen recht gut, denn Maffai war, wie die SLM bei den letzten
Schnellzugslokomotiven
der
Gotthardbahngesellschaft
beteiligt gewesen. Mit den neuen Techniken wurden sowohl in München, als
auch Winterthur nur noch Teile gebaut.
Die
Dieselmotoren
stammten von Firmen, die im Verkehr auf der Strasse durchaus bekannt
waren. Wer von Motoren in Deutschland spricht, kommt nicht an der Firma
Daimler Benz vorbei. Sie war bekannt für Auto und LKW. Im Segment mit LKW machte sich auch die Ma-schinenfabrik Augsburg – Nürnberg einen Namen. Die Firma ist unter dem Kürzel MAN deutlich bekannter. Eher eine Überraschung war da schon der dritte Hersteller.
Maybach war damals durchaus bekannt für hoch-wertige Automobile.
Jedoch zeigte sich, dass man auch in dieser Firma in der Lage war, grosse
Dieselmotoren
zu bauen. Die Maschinen für die Schweiz hatten Motoren von Maybach. Die Endmontage und den Antrieb übernahm die Firma Maschinenbau Kiel AG. Dabei wurden die Getriebe von Voith bezogen.
Als Zulieferer für den geringen elektrischen Anteil war dann die
Firma BBC in Mannheim beauftragt worden. Immerhin dort war ein in der
Schweiz durchaus gut bekannter Hersteller gewählt worden. Wir haben hier
eine in Deutschland für Deutschland gebaute
Lokomotive
und daher andere Hersteller, es muss nicht immer Sulzer sein.
Vom eingereichten Vorschlag wurden von der Deutschen Bundesbahn DB
vorerst fünf Exemplare als
Prototypen
beschafft. Damals war es durchaus üblich, dass mit einer kleinen Serie die
Versuche unternommen wurden. Erst nach deren Eignung folgte dann die
Serie. Dabei waren oft vier bis fünf
Lokomotiven
die Regel, bei der Reihe Re 4/4
II waren es sogar sechs Maschinen. Sie sehen, hier gab es schlicht
keine grossen Unterschiede.
Die Auslieferung beschränkte sich auf den Zeitraum von 1953 bis
1959. Auch wenn der Bedarf damit noch nicht gedeckt war endete die
Lieferung, weil die Deutsche Bundesbahn DB auch die in der Zeit gemachten
Ent-wicklungen nutzen wollte.
So wurde das gelungene Muster leicht verbessert und mit mehr
Leistung
versehen. Zur Unterscheidung der beiden Leistungsklassen vergab die
Deutsche Bundesbahn DB diesen anfängliche die Bezeichnung V 200.1. Später
wurde daraus die
Baureihe
221 und somit war die nahe Verwandtschaft immer noch deutlich zu erkennen,
denn es war einfach eine etwas kräftigere Version der V 200, die durchaus
erfolgreich zu sein schien.
Bei der verbesserten Version konnte die
Leistung
auf 1 986 kW gesteigert werden. Das entsprach einen Wert von 2 700 PS.
Eine durchaus hohe Leistung, die sogar dafür sorgte, dass von diesen
Maschinen ein Exemplar bei der Lötschbergbahn für Versuche hergezogen
wurde. Zu einem Ankauf durch die
BLS-Gruppe
kam es jedoch nicht, da sich die Probleme mit der Versorgung der
Fahrleitung
lösen liessen und der Betrieb sicher war.
Von der Reihe V 200.1 konnten noch einmal 50 Stück beschafft
werden. Von diesen war bei den in die Schweiz verkauften Maschinen jedoch
keine vorhanden. Genauer wurden die Nummern 220 013 bis 017, 220 053 und
220 077 an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkauft. Bei der nun
folgenden Vorstellung werden wir diese Version ansehen, denn alle anderen
sind in Deutschland zu Hause und zu weit blicken wollen wir auch nicht.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
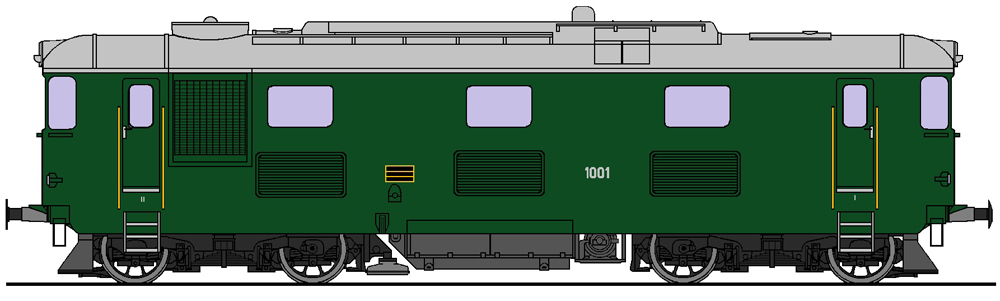 Es
gab daher Versuche mit zwei Modellen für den Einsatz im
Es
gab daher Versuche mit zwei Modellen für den Einsatz im
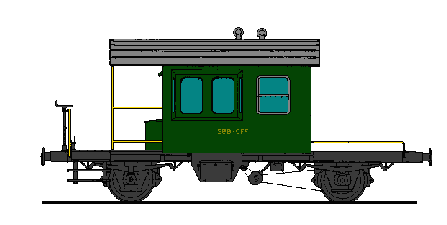 Das
war durchaus auch ein Problem, das die Schweiz kannte. Da dort aber der
Das
war durchaus auch ein Problem, das die Schweiz kannte. Da dort aber der  Es
lohnt sich, wenn wir in den Katalog mit den Anforderungen sehen. In diesem
auch hier erforder-lichen
Es
lohnt sich, wenn wir in den Katalog mit den Anforderungen sehen. In diesem
auch hier erforder-lichen  Wegen
dem universellen Einsatz wurde eine hohe
Wegen
dem universellen Einsatz wurde eine hohe  Die
NOHAB AA16 zeigt es deutlich, die als
Die
NOHAB AA16 zeigt es deutlich, die als
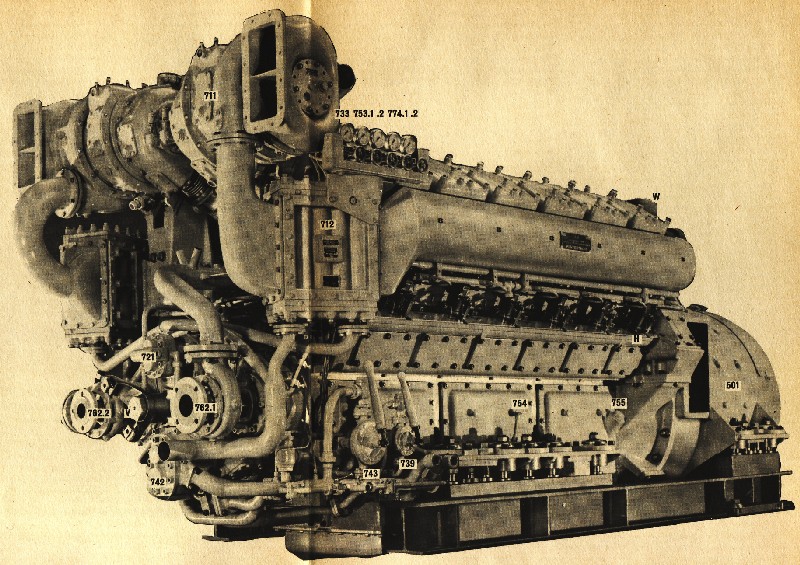 Die
Die
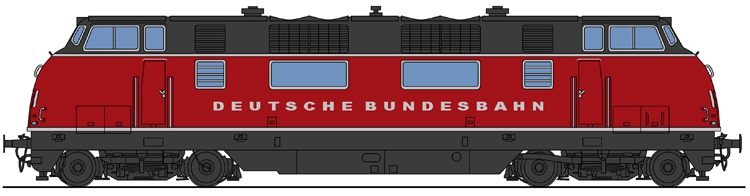 In
mehreren Teilserien wurden von diesen
In
mehreren Teilserien wurden von diesen