|
Der Kastenaufbau |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Eines unterscheidet sich beim Bau von
Lokomotiven
in den verschiedenen Firmen nicht. Es wird nach Möglichkeit mit einfachen
Stahlblechen gearbeitet. Beim damals modernen Bau kamen Stahlbleche zum
Einsatz, die unterschiedliche Stärken hatten. So kannte das Gewicht bei
gleicher Tragkraft vermindert werden. Ein Punkt, der auch bei dieser
Diesellokomotive
bestand, denn noch war die Technik nicht so leicht, wie das heute der Fall
ist.
Der grundsätzliche Aufbau unterschied sich jedoch von der damals
in der Schweiz eingeführten selbstragenden Ausführung. Es wurden zwei
Träger aufgebaut. Diese bezeichnete man als den oberen und den unteren
Rahmen. Für den Kasten wichtig war der untere Rahmen, denn es war das
tragende Element und wurde ähnlich aufgebaut wie die
Lokomotivbrücken
der Schweiz. Das hatte zur Folge, dass die Kräfte hier verliefen.
Der Unterrahmen wurde aus Stahlblechen aufgebaut. Diese wurden so
verbunden, dass ein rechteckiger Stahlrohrträger entstand. Dieser Rahmen
wurde innerhalb des Fahrzeuges und an den beiden Enden verbunden. Dabei
wurden die einzelnen Bleche mit der elektrischen
Schweisstechnik
verbunden. Eine Fertigung, die seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt
wurde und der die üblichen
Nietverbindungen
der alten Modelle ablöste.
Wenn wir diesen Rahmen im Detail ansehen, dann war in diesem von
aussen nicht sichtbar der
Treibstoffbehälter
eingebaut worden. Damit genug Platz vorhanden war, wurde er zwischen den
beiden
Drehgestellen
angeordnet. Auf Grund der grossen Länge konnte ein grosser Vorrat
mitgeführt werden. Wichtig war, dass dieser
Tank
nicht sichtbar war, weil seitlich von den nach unten geführte Schürzen
vorhanden waren. Das war damals durchaus üblich.
Den beidseitige Abschluss des Unterrahmens bildete der
Stossbalken.
Unter diesem wurde ebenfalls eine Schürze eingezogen. Diese Lösung
entsprach auch dem Zeitgeist und konnte auch in der Schweiz beobachtet
werden. Als Unterschied kann nur genommen werden, dass es unter dem
Stossbalken keinen
Bahnräumer
gab. Auf diese wurde bei der Deutschen Bundesbahn DB verzichtet, da es
Probleme mit dem
Flugschnee
gegeben hatte.
Ein weiterer Vorteil war, dass damit auch etwas Gewicht gespart
werden konnte, denn es war bereits beim Bau sicher, dass es kaum möglich
sein wird, die verlangten
Achslasten
einzuhalten und daher speckte man ab, wo es nur ging. Keine grosse Möglichkeit um Gewicht zu sparen gab es beim Stossbalken. Die damals in der Schweiz übliche Lösung mit leichten Kupplungen ging nicht, weil es sich hier um eine Universallokomotive handelte und diese musste auch schwere Güterzüge führen.
Damit können wird auch zur mechanischen Aus-rüstung der
Stossbalken
wechseln. Diese war durch die internationalen Normen der
UIC
festgelegt wor-den und war gleich, wie in der Schweiz. Mittig im Stossbalken wurde ein gefederter Zug-haken eingebaut. Dieser Haken war beweglich im Rahmen befestigt worden und der konnte seitlich mit der Hilfe von Führungen verschoben werden.
Um die
Zugkräfte
zu dämpfen, war der Haken in der Längsrichtung gefedert worden. Dabei
waren kräftige
Spiralfedern
verbaut worden, die den Haken gegen den
Stossbalken
zogen. Einen Unterschied zu anderen
Baureihen
gab es nicht.
Das galt auch für die
Schraubenkupplung
nach den Normen der
UIC.
Diese wurde am
Zughaken
montiert und sie konnte mit einer Spindel in der Länge verändert werden.
Dabei dienten die hier verbauten beiden Laschen als Sollbruchstelle. Wobei
durch die seitliche Verschiebbarkeit der Zughakens diese Gefahr nicht mehr
so gross war, wie bei älteren Modellen. Jedoch konnten weiterhin keine
Stosskräfte
aufgenommen werden.
Bei diesen befand sich die
Spiralfeder
zur Dämpfung in einer Hülse. Auch diese
Puffer
waren den internationalen Normen geschuldet und sie wurden mit runden
Puffertellern
versehen, was durchaus üblich war und auch zu Fragen führt. Um diese zu beantworten müssen wir zum Messband greifen. Die so aufge-baute Lokomotivbrücke hatte eine Breite von 3 082 mm erhalten und war recht hoch. Die über die Puffer gemessene Länge betrug 18 470 mm.
Bei einer vergleichbaren Länge hatte die
Baureihe
Ae 6/6 in der Schweiz rechteckige
Teller erhalten und daher ist die Frage berechtigt und dazu müssen wir
bereits zum
Laufwerk
dieser
Lokomotiven
wechseln. Der Anstand der Drehpunkte war der Grund. Bei der zum Vergleich erwähnten Reihe Ae 6/6 mit 8 700 mm war dieser Wert hier auf 11 500 mm gestreckt worden.
In der Folge verringerte sich der Abstand zwischen
Pufferteller
und Dreh-punkt, was die Lösung mit runden Tellern erlaubte. Sie sehen,
dass nicht nur die Länge für die Ausstattung verantwortlich war, sondern
der Abstand der Drehpunkte. Wir sollten nun aber den Kasten aufbauen.
Auf der
Lokomotivbrücke
wurden die Seitenwände aufgebaut. Zwischen diesen gab es keinen
Unterschied. Diese aus Stahlblech gefertigten und mit Streben versehenen
Wände standen jedoch nicht senkrecht über der
Brücke,
sondern wurden nach oben leicht nach innen gezogen. Damit war die
breiteste Stelle der Maschine wirklich bei der Lokomotivbrücke zu finden.
Mit dem Rahmen verbunden wurden diese Wände mit Hilfe der elektrischen
Schweisstechnik.
Das war notwendig, da hier ein grosser Vorrat mitgeführt wer-den
sollte. Zudem konnte der Stutzen mit einem einfachen Deckel verschlossen
werden. Grosse Unterschiede zu den LKW gab es dabei eigentlich nicht.
Einzig die Menge war grösser. Am oberen Rand unmittelbar unterhalb des Einzuges waren dann noch Fenster zur Ausleuchtung des Maschinenraumes verbaut worden. Dabei waren auf der äusseren Seite kleinere quad-ratische Exemplare vorhanden.
Diese wurden mit in Längsrichtung verlaufenden Stäben ver-sehen.
Spannend war, dass es die einzigen so aufgebauten Seitenfenster waren,
denn diese drei Stäbe werden in der Regel nur als Schutz vor Schäden
verbaut. Zwischen den beiden erwähnten Fenstern waren dann noch zwei grosse Seitenfenster eingebaut worden. Dies befanden sich auf gleicher Höhe und sie hatten die gleiche Höhe.
Jedoch waren diese Seitenfenster deutlich länger und nicht mit der
erwähnten Verstärkung versehen worden. Die hier verbauten Gläser waren die
bei den Bahnen verwendeten Lösungen aus
Sicherheitsglas.
Nötig waren diese speziellen Scheiben wegen den Vibrationen, die
übertragen wurden.
Der so entstandene
Maschinenraum
teilte sich in drei Bereiche auf. Das waren die beiden
Dieselmotoren
und der Heizkessel in der Mitte. Ermöglicht wurde der Zugang für das
Lokomotivpersonal
durch die beiden abschliessenden Rückwände der
Führerstände.
Ein Durchgang führte seitlich durch den Raum. Ungefähr in der Mitte der
Lokomotive
wurde die Seite gewechselt. Als Abschluss des Raumes waren noch Türen
verbaut worden.
Nach oben leicht abfallend, endete der
Vorbau
in einer starken Rundung vor den
Frontfenster
der
Führerstände.
Damit war die eigentlich
Front
ausgesprochen hoch aus-gefallen und das war ein Markenzeichen dieser
Loko-motiven. Seitlich waren Wartungsluken vorhanden, diese gab es auch an der Front in der Mitte. Sie ermöglichten den Unterhalt an den Getrieben, denn bedingt durch den langen Radstand befanden sich diese unter dem Boden des Führerstandes.
Das behinderte den Zug und sorgte dafür, dass die
Führerkabine
nach oben verschoben werden musste. Der Platz auf dem Fahrzeug war daher
ausgesprochen knapp bemessen worden. In der Front waren über den beiden unteren Lampen noch senkrecht angeordnete kleine Lüftungsgitter vorhanden. Durch diese konnte der Fahrtwind in den Bereich der Getriebe gelangen und diese so kühlen.
Wobei das nur vorne ging und wir später diese
Kühlung
noch ansehen werden. Vorerst sind es nur zwei
Lüftungsgitter
in der
Front
der
Lokomotive.
Wie damals üblich gab es auch hier
Filtermatten,
die für eine Reinigung sorgten.
Damit kommen wir nun zum Einzug, der wegen dem
Lichtraumprofil
erforderlich war. Die Kante zur Seitenwand war deutlich zu erkennen und
der Bereich hatte bei den Seitenwänden an der gleichen Stelle zu den
Fenstern gleich grosse
Lüftungsgitter
bekommen. Damit waren in diesem Bereich Modelle mit längs verlaufenden
Lamellen vorhanden. Lediglich bei den längeren Lüftungsgittern mussten
diese mit Stäben verstärkt werden.
Für
grosse war schlicht der Platz nicht mehr vorhanden. Das trug auch zum für
Schweizer Augen eher ungewohnten Erschein-ungsbild bei, denn hierzulande
war man sich grosse Fenster ge-wohnt. Wenn wir nun den Bereich mit den Fenstern ansehen, dann beginnen wir mit der Front. Hier waren zwei gleich grosse und mittig mit einer schmalen Säule getrennte Frontfenster verbaut worden.
Diese
Frontscheiben
bestanden aus
Sicherheitsglas
und sie folg-ten am oberen Rand in einem leichten Bogen dem Dach. Es wurde
daher der Platz optimal ausgenutzt. Trotzdem sollte die
Lokomotive
unübersichtlich sein und auf die
Puffer
sah man nicht.
Um die
Frontscheiben
zu reinigen waren
Scheibenwischer montiert worden. Diese befanden sich über den
Fenstern. Angetrieben wurden diese Wischer mit der Hilfe von
Druckluft,
was damals üblich war. Eine
Scheibenwaschanlage war jedoch nicht vorhanden, aber damals konnte man
solche Lösungen auch noch nicht und Luxus wurde auch hier nicht eingebaut.
Im Gegenteil, es war eine schon fast armselige Ausrüstung vorhanden.
Seitlich wurden dann zwei Fenster vorgesehen. Dabei konnte das
gegen die
Front
ausgerichtete Fenster geöffnet werden. Hier kamen die klassischen
Schiebefenster zur Anwendung. Andere Lösungen ging wegen dem Knick in der
Wand auch nicht. Das zweite quadratische Fenster war dahinter. Es wurde
fest eingebaut und befand sich über den
Einstiegstüren.
Damit können wir alle Fenster dieser Maschine abschliessen und den Zugang
suchen.
Auch wenn es sich angeboten hätte, einen Weg von und zur
Anhängelast
gab es jedoch nicht. Wir müssen uns auch nicht vier
Einstiegstüren
ansehen, denn eine davon reicht durchaus, denn sie wurden identisch
aufgebaut, was zu erwarten war. Die Türe war nach innen öffnend und sie besass schlicht keine Fenster. Wegen den nach innen ge-neigten Seitenwänden musste eine Seitenlinie im oberen Bereich etwas gestraft werden.
Daher war keine rechteckige Lösung vorhanden, was die besondere
Form des Aufbaus noch einmal deutlich aufzeigte. Es waren so massive Türen
ent-standen, die vom Personal auch geöffnet werden musste und ein Zugang
fehlt auch noch. Die Einstiegstüre konnte mit einer einfachen Türfalle mit Schloss geöffnet werden. Das Schloss sollte ver-hindern, dass unbefugte in das Fahrzeug gelangen konnten. Jedoch war die Bedienung mit dem spe-ziellen Schlüssel nicht einfach.
Der Grund ist, dass diese Türfalle und damit auch das Schloss von
Boden aus nicht zugänglich war. Man musste also zuerst aufsteigen, konnte
dann die Türe aufschliessen, öffnen und wieder absteigen um das Gepäck zu
holen.
Unterhalb der Türe wurde eine Leiter montiert. Diese besass vier
Stufen. Dabei war eine davon in der
Lokomotivbrücke
eingelassen worden. Grosse Unterschiede zu anderen
Baureihen
gab es nicht, denn diese Lösungen waren bei den Modellen mit zwei
Führerständen
durchaus üblich. Jedoch kann so eine Leiter nicht ohne einen Griff
erklommen werden, und in der Nische hatte auch nur die Fussspitze
ausreichend Platz.
Zwei neben der Türe in Nischen montierte
Griffstangen
sorgen für den notwendigen Griff. Speziell war, dass diese in Nischen
montiert wurden und nicht vorstehend waren. Eine in Deutschland durchaus
übliche Lösung. Eigentlich kannte man auch nur in der Schweiz die
abstehenden Griffstangen. Auch hier wurden aber die damals üblichen
verchromen Modelle verbaut. Damit war aber der Zugang zum
Führerstand
möglich.
Jedoch bot sich auch das Dach an, denn dazu wurden einfache Hauben
verwendet. Dank diesen konnte des Dach abgenommen werden. Dank dem Zugang
konnten schwere Teile mit einem
Kran
aus der Maschine gehoben werden.
Das Dach als solches war eigentlich nicht vorhanden und seitliche
Stege waren auch nicht erforderlich. So waren über den
Dieselmotoren
zwei runde Öffnungen vorhanden. Diese waren mit einem Gitter abgedeckt und
unter diesen sassen die
Ventilatoren.
Es war die
Kühlung
der Motoren, denn diese konnte grosse Wärme erzeugen und daher wurde die
Kühlluft
als Schutz der Reisenden über das Dach in die Umwelt entlassen.
Um das Dach und den Aufbau abzuschliessen, muss noch erwähnt
werden, dass hier auch die Auslässe für die
Abgase
der Verbrennung vorhanden waren. Diese wurden also wie bei den
Dampflokomotiven nach oben ausgestossen. Auch hier war die Temperatur der
Grund, denn die Abgase waren sehr heiss, da ein kurzer Weg vorhanden war.
Sie sehen, es wurde auch auf den Schutz geachtet und damit war das Dach
schon fertig.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||

 Zum
Schutz des
Zum
Schutz des 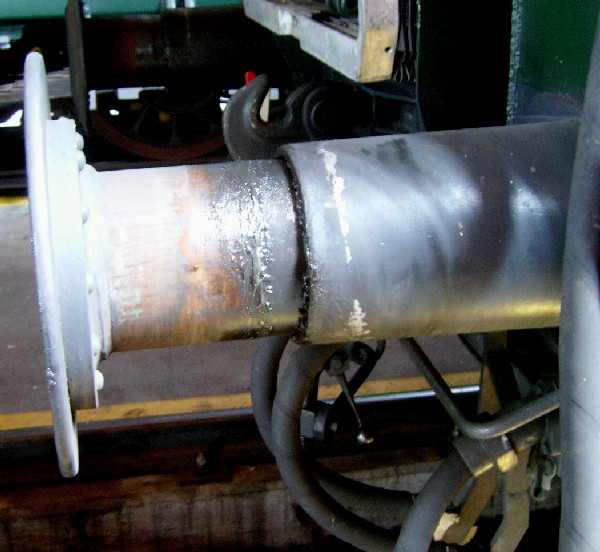 Um
die
Um
die
 In
der Seitenwand waren einige Öffnungen vorhanden. So befand sich im unteren
Teil der
In
der Seitenwand waren einige Öffnungen vorhanden. So befand sich im unteren
Teil der
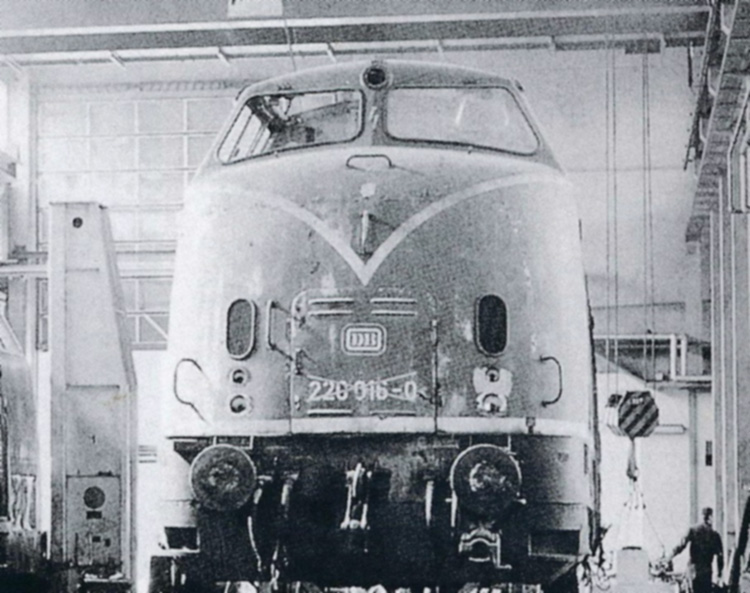 Bevor
wir zu den Bereichen mit dem Einzug kommen, sehen wir uns die
Bevor
wir zu den Bereichen mit dem Einzug kommen, sehen wir uns die  Somit
waren die Symmetrien vorhanden und ledig die sehr hohe
Somit
waren die Symmetrien vorhanden und ledig die sehr hohe  Jeder
Jeder
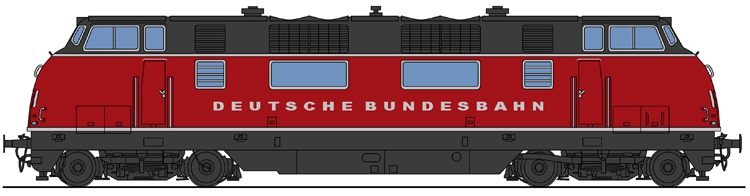 Nicht
so leicht waren die beiden
Nicht
so leicht waren die beiden