|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wir beginnen auch hier die Betrachtung der
Neben- und
Hilfsbetriebe
mit den
Nebenbetrieben.
Diese waren bei einem
Triebfahrzeug
für den
Regionalverkehr
sehr wichtig, da sie für die Versorgung der
Reisezugwagen
genutzt wurden. Hier kam noch hinzu, dass sie auch auf dem Fahrzeug
genutzt werden sollten. Doch beginnen wir auch hier ganz am Anfang und
dazu müssen wir wieder zum
Transformator
zurück kehren.
So wurde auch hier eine
Anzapfung
vorgesehen, die eine
Wechselspannung
von ungefähr 1 000
Volt
hatte. Diese konnte nun den Verbrauchern dieses
Stromkreises
zugeführt wer-den. Direkt an der Anzapfung war als Schaltelement ein Heizhüpfer verbaut worden. Dank die-sem konnte die Leitung geschaltet werden. Der Hüpfer war zudem auch dazu vorgesehen, die Leitung bei einem Kurzschluss zu öffnen.
Dazu war der in dieser Leitung fliessende
Strom
überwacht worden. Wie diese funktio-nierte, sehen wir bei der Steuerung
genauer an. Wichtig war hier, dass die
Leistung
be-schränkt wurde.
Diese
Zugsheizung
wurde den Verbrauchern auf dem Fahrzeug und den unter dem rechten
Puffer
montierten
Heizsteckdosen
zugeführt. An diesen Steckdosen konnten die Kabel der angehängten
Reisezugwagen
eingesteckt werden. Die
Triebwagen
besassen keine eigenen
Heizkabel
mehr und auch auf das Mitführen eines speziellen
Hilfsheizkabels
wurde verzichtet. Im Notfall fiel daher die
Heizung
aus und das auch auf dem Fahrzeug.
Weil die
Zugsheizung
auch auf dem Fahrzeug benötigt wurde, müssen wir uns auch diese noch
ansehen. Mit Ausnahme der
Heizungen
im
Führerstand
wurden die Teile an dieser
Zugsammelschiene
angeschlossen. Damit war es auch möglich die Abteile ab einer
Vorheizanlage
zu erwärmen. Dazu musste einfach ein Kabel angeschlossen werden. Bevor
jedoch so geheizt wurde, musste der
Heizhüpfer
geöffnet sein, da es sonst zum
Kurzschluss
kam.
Damit war hier eine neuartige Warmluftheizung
vorhanden, die verhindern sollte, dass es zu Beginn der Heizperiode zu den
stinkenden
Widerständen
kom-men sollte. Um die Wärme in den Abteilen einzustellen waren Thermostaten vorhanden. Diese konnten durch das Zugpersonal, aber auch durch die Reisenden verstellt werden.
Eine genaue Einstellung war jedoch nicht
möglich, da nur die
Leistung
verändert werden konnte. Trotzdem wirkte diese Lösung recht
fortschrittlich und war eine erste Verbesserung gegenüber den
Leichtstahlwagen,
die hier als Muster genommen wurden. Mit der Warmluftheizung waren diese Triebwagen fortschrittlich und so sollten die hier vorgestellten Triebwagen auch für die Entwicklung der Einheits-wagen wegweisend sein.
Wir jedoch müssen uns nun auch noch den
Hilfsbetrieben
zuwenden. Diese waren für die Versorgung der technischen Bereiche
vorgesehen und zu diesen gehörten auch die
Führerstände,
daher auch der Grund, warum die
Heizung
dort angeschlossen wurde.
Auch für die Betrachtung der
Hilfsbetriebe
müssen wir wieder zum
Transformator
zurück kehren. Dabei nutzen wir von diesem keine
Spule,
sondern das im Eisenkern erzeugte Magnetfeld. Mit diesem konnte in einer
zusätzlichen
Wicklung
wieder eine
Spannung
erzeugt werden. So gelang es eine genau definierte Spannung von 220
Volt
zu erhalten. Auch jetzt waren die Erbauer nicht frei, denn auch hier waren
Normen vorhanden.
Mit diesem konnte die
Wicklung
und die
Schmelz-sicherung
von den
Hilfsbetrieben
getrennt werden. Da es ein Umschalter war, wurden nun seitlich am Kasten
angebrachte Steckdosen zugeschaltet. Hier konnte der Depotstrom angeschlossen werden. Die-ser war auch der Grund, warum die Spannung der Hilfsbetriebe nicht frei gewählt werden konnte.
Wenn wir uns nun den Verbrauchern zuwenden,
dann gilt in jedem Fall, dass diese sowohl von der
Spule,
als auch von den Steckdosen versorgt werden konnten. Wie wichtig das sein
konnte, erkennen wir, wenn wir zum ersten Nutzer der hier vorhandenen
Spannung
kommen.
Mit einer eigenen
Sicherung
und einem
Schütz
als Schaltelement wurde der Motor des
Kompressors
angeschlossen. Dabei konnte der Schütz sowohl von der Steuerung, als auch
vom Lokführer geschaltet werden. Da nun der Anschluss der
Hilfsbetriebe
an den
Depotstrom
vorhanden war, konnte in dem Fall die
Druckluft
ohne die
Handluftpumpe
erzeugt werden. Gerade beim Unterhalt war das sehr wichtig.
Speziell war auch die hier angeschlossene
Anzeige der
Fahrleitungsspannung.
Löste die
Sicherung
der
Hilfsbetriebe
aus, war auch diese Anzeige nicht mehr vorhanden. Das war nicht so
schlimm, wäre nicht die Kontrolle der minimalen
Spannung
auch hier angeschlossen worden. So kam es dazu, dass die Sicherung der
Hilfsbetriebe dafür sorgte, dass der
Hauptschalter
des
Triebwagens
durch die Steuerung geöffnet wurde.
Dabei beginne ich mit dem
Transformator,
denn dieser hatte eine spezielle Lösung erhalten, die gar nicht von den
Hilfsbetrieben
abhängig war. Wir behandeln diesen Teil hier, damit wir die gleiche
Reihenfolge der anderen
Bau-reihen
haben. Transformatoren wurden in einem Gehäuse eingebaut. Dieses wurde hier für die Kühlung genutzt. Damit die Wärme der Wicklungen optimal abgeführt werden konnte, wurde das Gehäuse mit Transformatoröl gefüllt.
Dieses
Kühlmittel
hatte den Vorteil, dass es auch die
Isolation
verbesserte. Daher konnte hier Gewicht gespart werden und das Bauteil
wurde trotz dem
Öl
insgesamt deutlich leichter, was wichtig war. Das an den Leitungen erwärmte Kühlmittel wurde durch thermische Effekte verdrängt und kühleres Transfor-matoröl gelangte zu den Wicklungen.
Es war daher keine
Ölpumpe
vorhanden, sondern es wur-den natürliche Effekte genutzt. Am Gehäuse wurde
die Wärme ans Metall abgegeben. Da dieses vom Fahrwind umströmt wurde,
gelang die Wärme an die Luft und wurde so abgeführt, ohne dass ein
Kühler
vorhanden war.
Wir können uns nun der
Kühlung
der
Fahrmotoren
zuwenden und diese war nicht bei allen drei
Triebwagen
gleich gelöst worden. Bei allen setzte man auf eine zweistufige Lösung. So
wurde eine
Eigenventilation
der
Triebmotoren
mit einer durch die
Hilfsbetriebe
versorgten
Fremdventilation
ergänzt. Das führte dazu, dass das Gewicht für die
Ventilation
verringert werden konnte und das war beim Modell der GBS sehr wichtig.
Dabei waren nur ein-fache Ansaugöffnungen
vorhanden. Da die Luft im Bereich des Daches angezogen wurde, war sie
sauber und musste daher nicht weiter gereinigt werden. In den Innenraum
gelangte die
Kühlluft
durch den Unterdruck, der von einem normalen
Ventilator
erzeugt wurde. Dieser beschleunigte anschliessend die Luft.
Wenn wir nun kurz den
Triebwagen
der GBS ansehen, dann wurden nur die Öffnungen verändert. Hier wurden über
Plattformen
und den Einstiegen
Lüftungsgitter
mit darin eigelegten
Filtermatten
verwendet. Damit wurde die Luft gereinigt, was alleine zu einer
Verbesserung der
Kühlung
sorgte. Auch hier wurde die Luft wegen dem durch den
Ventilator
erzeugten Unterdruck in den Innenraum gezogen. Im weiteren Verlauf gab es
keine Unterschiede.
Von der im Dach montierten
Ventilation
wurde die Luft durch Kanäle und
Faltenbälge
zu den
Fahrmotoren
des benachbarten
Drehgestells
geführt. Dort wurde sie durch die
Wicklungen
gepresst und gelangte anschliessend wieder ins Freie. Bedingt durch die
Luftströmung wurde auch die
Eigenventilation
angeregt, so dass auch von dort
Kühlluft
in die Fahrmotoren gelangte und diese so kühlte, aber auch wirksam
reinigte.
Soweit die
Kühlung
der
Fahrmotoren,
jedoch mussten die
Ventilatoren
noch von den
Hilfsbetrieben
versorgt werden und dabei gab es die grössten Unterschiede zwischen den
Triebwagen.
Dabei beginne ich auch hier mit der Lösung bei den Modellen für die BN,
die eine einfachere Regelung für die
Ventilation
erhalten hatten. So wurden die Motoren entweder in Serie, oder parallel
angeschlossen und so die
Leistung
angepasst.
Die zuvor erwähnte Schaltung in Reihe, oder
parallel wurde jedoch bei-behalten und daher stellt sich die Frage nach
dem Grund für diese Lösung, die ja nicht so einfach zu erkennen ist, wie
wir erhofft haben.
Mit den hier verbauten
Wellenstrommotoren
konnte bei gleichem Gewicht eine höhere
Leistung
erreicht werden. Diese so verbesserte
Kühlung
erlaubte es etwas kleinere
Fahrmotoren
zu verbauen und das war wichtig, weil hier das Gewicht um vier Tonnen
verringert werden musste und das konnte nur noch bei der
Fahrmotorventilation
umgesetzt werden. Sie sehen, es musste genau gerechnet werden, um leichter
zu werden.
Weiter waren noch Steckdosen vorhanden. Diese
waren nach den in der Schweiz für die Landesversorgung gültigen Normen
aufgebaut worden. Die
Spannung
war ebenfalls gleich, es gab nur eine abweichende
Frequenz.
Daher konnten hier
Glühbirnen
angeschlossen werden. Diese gaben zwar etwas weniger Licht ab,
funktionierten aber trotzdem, da der Glühfaden einfach nur ein normaler
Widerstand
war.
An den
Hilfsbetrieben
war auch die
Umformergruppe
für die
elektrische
Bremse angeschlossen worden. Diese war so aufgebaut worden,
dass sie aktiviert wurde, wenn auf den elektrischen Bremsbetrieb
umgeschaltet wurde. Einen zusätzlichen Schalter, der eine Aktivierung
erlaubte, gab es jedoch nicht und selbst dieser fehlte beim letzten noch
nicht behandelten Verbraucher der Hilfsbetriebe und der war im Aufbau
ähnlich.
Noch können wir die
Hilfsbetriebe
nicht abschliessen. Es gab noch einen Verbraucher der so speziell war,
dass der gar nicht geschaltet werden konnte. Es war zwar eine
Sicherung
vorhanden, aber auch nicht mehr. Das galt zwar vorher schon für die
erwähnten Steckdosen, aber wir kommen nun auch zur Überleitung zur
Steuerung für diese war ein eigenes
Bordnetz
verbaut worden, das von hier gespiesen wurde.
Da diese
Bordnetze
grundsätzlich mit
Gleichstrom
aufgebaut wurden mussten, musste aus dem
Wechselstrom
eine passende
Spannung
erzeugt werden. Um dabei möglichst kleine Verluste zu haben, wurde dazu
eine
Umformergruppe
benötigt. Der an den Hilfsbetrieben angeschlossene Motor lief dauernd und
er trieb über die gemeinsame Welle einen
Generator
an, der die für das Bordnetz benötigte Spannung lieferte.
Wir sind nun aber bereits bei der Steuerung und
der
Beleuchtung
gelandet. Um die
Hilfsbetriebe
abschliessen zu können, muss noch erwähnt werden, dass diese den anderen
Baureihen
entsprach und es kaum Neuerungen gab. Bauteile, die hier verbaut wurden,
konnten zum Teil auch von anderen Serien übernommen werden und das galt
auch für die Beleuchtung und die Steuerung, die wir nun genauer ansehen
werden.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Abgenommen
wurde die
Abgenommen
wurde die  Die
Abteile wurden hier nicht mehr mit den unter den Sitzbänken montierten
Die
Abteile wurden hier nicht mehr mit den unter den Sitzbänken montierten  Direkt
an dieser
Direkt
an dieser  Wenn
wir uns nun die wichtigsten Verbraucher ansehen, dann waren das die
Wenn
wir uns nun die wichtigsten Verbraucher ansehen, dann waren das die
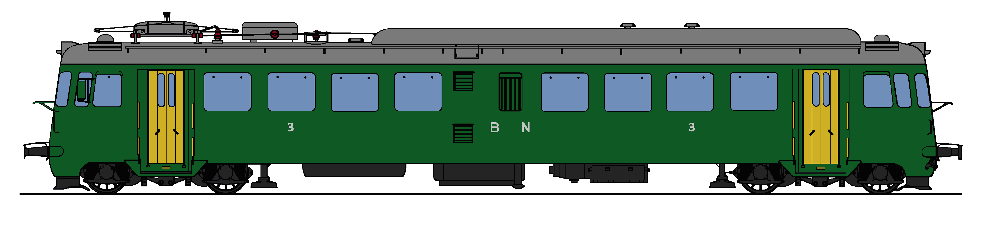 Die
für die
Die
für die
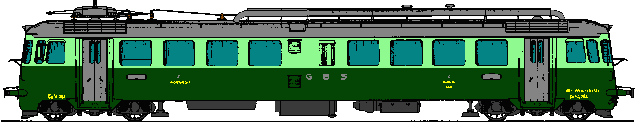 Beim
Modell für die GBS wurden die Motoren der
Beim
Modell für die GBS wurden die Motoren der
