|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Es mag überraschen, aber die beiden
Versuchslokomotiven
wurden mit Druckluft ausgerüstet. Natürlich wissen wir heute, dass viele
Funktionen auf einer
Lokomotive
damit gesteuert werden. Auf den beiden Maschinen war das zwar auch der
Fall, aber die Anwendungen waren wesentlich geringer, als das heute bei
den
Triebfahrzeugen
der Fall ist. Es lohnt sich daher, dass wir uns die
Druckluft
auf den Lokomotiven genau ansehen.
Diese konnte jetzt jedoch nicht mehr verwendet werden, so dass man
sich eine andere Lösung für die Erzeugung der
Druckluft
suchen musste. So einfach, wie wir das heute meinen, war die Lösung auch
wieder nicht, denn elektrisch erzeugte man drehende Bewegungen. Grundsätzlich drehte man eigentlich nur das Prinzip der Dampf-maschine um. Die drehende Bewegung erzeugt über ein Kreuz-gelenk eine lineare Bewegung und in den Zylindern wird Luft ver-dichtet und nicht Dampf entspannt.
Die daraus entstehende Maschine zur Erzeugung von
Druckluft,
nannte man
Kolbenkompressor.
Dieser
Kompressor
war jedoch nicht besonders leistungsstark, aber man konnte die benötigte
Druckluft erzeugen. Die so erzeugte Druckluft wurde in eine geschlossene Leitung entlassen. Diese endete in einer Vergrösserung des Luftvolumens. Diese Hauptluftbehälter sollten dafür sorgen, dass der Kompressor nicht dauernd arbeiten musste.
Eine Aufbereitung der Luft fand bis zum jetzigen Zeitpunkt auch
nicht statt. Das entstandene Kondenswasser musste daher regel-mässig aus
diesem
Kessel
entnommen werden. Noch spielte der Aufwand beim Unterhalt keine Rolle. Angeordnet wurden diese Luftbehälter entlang des Rahmens vom Kasten. Da der Platz in der Breite dafür nicht ausreichte, wurde eine lange Röhre verwendet.
Diese wurde als
Hauptluftbehälter
bezeichnet und ab diesem konn-te die
Druckluft
für die unterschiedlichen Verbraucher entnommen werden. Spezielle
Absperrhähne
zur Speicherung der Druckluft waren jedoch bei den beiden
Lokomotiven
schlicht nicht vorhanden.
Wenn wir bei den Verbrauchern der
Druckluft
sind, erkennen wir, dass lediglich ein paar Schaltungen der elektrischen
Ausrüstung mit Druckluft ausgeführt wurden. Im mechanischen Bereich wurden
jedoch die montierten
Sandstreueinrichtungen
mit Druckluft betrieben. Das war eine Neuerung, da bei den
Dampflokomotiven eine lange Leitung für ein ausreichendes Tempo des
Quarzsandes
sorgte. Hier waren die Leitungen dafür zu kurz.
Diese einfach aufgebaute Anlage funktionierte so gut, dass sie bei
Lokomotiven
und
Triebwagen
bis heute angewendet wird. Bei den Maschinen der MFO suchte man lediglich
nach einer Lösung für die fehlende Fallhöhe. Die jeweils auf die erste Achse in Fahrrichtung wirkenden Sander, wurden im Inneren der Lokomotive befüllt. Dabei standen die Führerstände und bei der Maschine MFO 1 auch der Maschinenraum zur Verfügung.
Im Vergleich zu den anderen damaligen
Lokomotiven
war das eine sehr einfache Aus-führung, jedoch besass die Strecke, für die
die beiden Maschinen gebauten wurden, keine grösseren Steigungen.
Speziell gelöst wurde jedoch die Ansteuerung der
Lokpfeife,
die den vorhandenen Modellen entsprach. Diese wurde bei den
Dampflokomotiven mit Dampf betrieben. Da es diesen hier nicht gab,
verwendeten die Konstrukteure einfach
Druckluft.
Da diese jedoch einen geringeren Druck hatte, als der Dampf aus dem
Kessel,
änderte sich der Klang der
Pfeife
leicht und das Signal war deutlich leiser. Eine Lösung, die auch später
noch angewendet wurde.
An der Druckluft angeschlossen wurden auch die pneumatischen
Bremsen
der
Lokomotive.
Zur Zeit der Auslieferung wurden zwei unterschiedliche Systeme angewendet.
Dabei handelte es sich um die von
Westinghouse
entwickelten Bremsen. Jedoch war es zu jener Zeit auch noch üblich, Züge
ohne pneumatische Bremsen zu führen. Die Ausrüstung dieser beiden
Maschinen konnte daher an die Bedürfnisse angepasst werden.
Vorteil dieser
Bremse
war ihr simpler Aufbau und die Tatsache, dass sie auch auf den Wagen
angewendet werden konnte. Dazu waren die pas-senden Leitungen an den
Stossbalken
vorhanden. Auf den Einbau der indirekten West-inghousebremse, die mit einer Haupt-leitung und Steuerventil arbeitete, wurde hingegen verzichtet.
Das war kein so grosses Problem, wie man meinen könnte, denn auf
Nebenlinien,
war es damals durchaus noch üblich, dass Züge ohne pneumatische
Bremsen
geführt wurden. Gerade die
Güterwagen
waren damals oft mit
Bremsern
besetzt. So konnten diese im Notfall mit Hilfe der mechanischen Bremse
anhalten.
Wir können durchaus auf die Vorstellung der
Bremsgewichte
verzichten. Diese wurden für die
Bremsrechnung
benötigt und waren nur für die
automatische Bremse
erforderlich. So überrascht es eigentlich nicht, dass keinerlei Angaben zu
den
Bremsen
angeschrieben wurden. Es gab schlicht keine
Bremseinrichtung,
die den Zug pneumatisch nach einer Trennung gebremst hätte. Die Züge
galten daher als mit der Hand gebremst.
Am
Bremszylinder
angeschlossen wurde das
Bremsgestänge,
das lediglich manuell an die Abnützung der
Bremsbeläge
angepasst werden konnte. Das Gestänge war so aufgebaut worden, dass der
Bremszylinder auf alle
Achsen
wirkte. Die Bewegungen der
Drehgestellel
wurden mit speziellen
Gelenken
im Bremsgestänge ausgeglichen. Eine damals bei Drehgestellen durchaus
übliche Lösung und die von den
Reisezugwagen
der neusten Generation übernommen wurde.
Das
Bremsgestänge
konnte auch mit der
Handbremse
der
Lokomotive
beeinflusst werden. Dabei gab es zwischen den beiden Lokomotiven durchaus
einen Unterschied. So wurde die Kurbel der Handbremse hinter der
Frontwand
über dem
Stossbalken
montiert. In der Folge mussten daher die Ausbuchtungen für die Kurbel in
der Wand geschaffen werden. Weil nun die Lokomotive MFO 2, zwei
Führerräume
hatte, besass diese Maschine zwei Handbremsen.
Die Bremswirkung wurde mit je einem
Bremsklotz,
der auf die
Lauffläche
des
Rades
wirkte, erzeugt. Damit besassen die beiden Maschinen eine ganz normale,
der Regel entsprechende
Klotzbremse.
Damals war so eine Ausrüstung durchaus üblich und es konnten bei den
beiden Maschinen die Bremsklötze der Baureihe
E 3/3 verwendet werden. Durchaus eine
Erleichterung bei der Beschaffung der Bremsklötze, die einem grossen
Verschleiss unterworfen waren.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
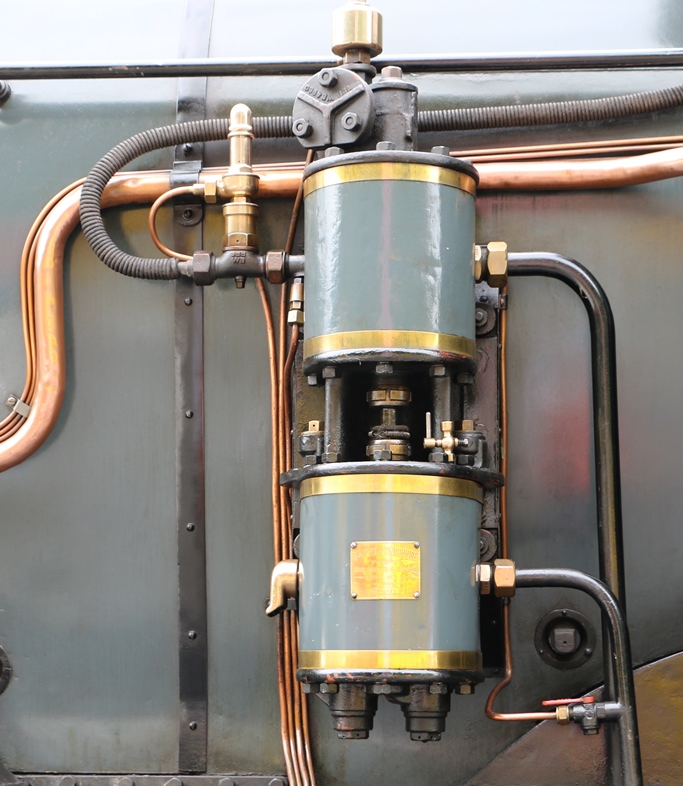 Schon
länger wurde bei den Bahnen in der Schweiz
Schon
länger wurde bei den Bahnen in der Schweiz
 Der
in einem Behälter mitgeführte
Der
in einem Behälter mitgeführte
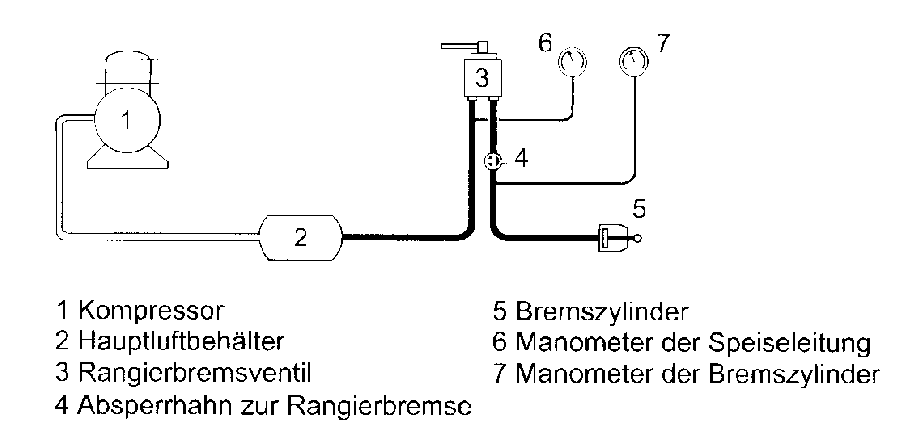 So
kam lediglich die direkt wirkende
So
kam lediglich die direkt wirkende