|
Elektrische Ausrüstung MFO 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im elektrischen Bereich waren die beiden
Lokomotiven
der MFO grundsätzlich anders aufgebaut worden. Daher müssen wir diese
getrennt ansehen. Da die Nummer eins etwas älter ist, beginnen wir mit
dieser Maschine. Hier gab es beim Aufbau ein Problem, das zuerst gelöst
werden musste.
Dieses bestand darin, dass schlicht noch kein Motor
vorhanden war, der als
Triebmotor
verwendet werden konnte. So musste eine andere Lösung begonnen werden.
Dabei beginnen die Besonderheiten bereits am Anfang, denn für
Fahrten mit einphasigem
Wechselstrom
musste eine neue
Fahrleitung
entwickelt werden und da war anfänglich nur die MFO. Beginnen wir die Betrachtung der elektrischen Ausrüstung auf dem Dach, denn bereits hier gab es deutliche Unterschiede. Die Lokomotive wurde für eine Spannung von 15 000 Volt Wechselstrom aus-gelegt.
Die massgebende
Frequenz
wurde mit 50 Hertz angegeben. Das mag überraschen, denn allgemein könnte
vermutet werden, dass bei der MFO gleich mit der geringeren
Frequenz
begonnen wurde. Der Grund für diese Differenz werden wir gleich erfahren. Die Spannung aus der Fahrleitung wurde mit zwei identischen Stromabnehmern auf das Dach der Lokomotive übertragen. Diese neuartigen Stromabnehmer wurden als bewegliche Ruten ausgeführt und bestanden aus Kupfer.
Sie wurden neben dem Aufbau auf einem der beiden seitlichen Stegen
montiert. Damit jedoch die notwendige Höhe erreicht wurde, waren diese
Ruten auf einem zusätzlichen Bock montiert worden.
Dieser Rutenbock war seitlich beweglich ausgeführt worden. So
konnten sich die Ruten je nach Lage der
Fahrleitung
bis über die Mitte der
Lokomotive
verschieben. Die dazu erforderliche Steuerung der Ruten, als auch des
Bockes, wurde von der Fahrleitung übernommen und konnte während der Fahrt
erfolgen. Da diese sowohl seitlich, als auch über dem Fahrzeug montiert
wurde, bedeutete das ein sehr grosser Spielraum für den
Stromabnehmer.
Mit Hilfe der Kraft einer
Feder
wurde die Rute an den
Fahrdraht
gedrückt und so ein sicherer Kontakt ermöglicht. Damit die
Lokomotive
auch von der
Fahrleitung
getrennt werden konnte, waren sowohl der Bock, als auch die beiden Ruten
manuell steuerbar. So konnte die Ruten einfach vom Fahrdraht abgezogen
werden, was auch bei dieser Fahrleitung als gesenkt bezeichnet wurde. Es
war jedoch nun kein Kontakt mehr vorhanden.
Nicht eingestellt werden konnte die Kraft mit der die Rute gegen
den
Fahrdraht
drückte. Da der Kontakt wegen dem einfach aufgehängten Fahrdraht und der
Trägheit der Ruten immer wieder kurzzeitig verloren ging, störte diese
Fahrleitung
zusammen mit der
Lokomotive
die
Telegrafen.
Es muss dabei erwähnt werden, dass diese damals entlang der
Bahnlinien
verliefen und so sehr nahe bei der Fahrleitung montiert wurden.
Damit diese Störungen eliminiert werden konnten, wurde die
Frequenz
kurze Zeit nach dem Beginn der
Versuchsfahrten
verringert. Diese Änderung bei der Frequenz erforderten jedoch einen
ersten Umbau der
Lokomotive. Hier liegt daher die spätere Frequenz von 16 2/3
Hertz
begründet. Eine Massnahme, die zumindest anfänglich erfolgversprechend
war. Mehr dazu werden wir später in den entsprechenden Kapiteln erfahren. Mit Hilfe einer isolierten Leitung wurde die Fahrleitungsspannung von den Stromabnehmern in den Inneren Bereich des Vorbaus geleitet. Das erfolgte beim Aufbau und ohne einen speziellen Schalter, der die Spannung abgeschaltet hätte. Es war somit nur möglich mit den Stromabnehmern die Lokomotive von der Fahrleitung zu trennen. Ein Umstand, der aber nur der hier verwendeten Technik geschuldet werden muss, denn hier war das möglich.
Es war somit bei der
Lokomotive
eine sehr einfache Dachausrüstung vorhanden und auch die Schutzmassnahmen,
wie eine
Dachsicherung
verwendete man zu Beginn der Versuche noch nicht. Das mag bei der hohen
verwendeten
Spannung
jedoch überraschen. Erklärt sich aber durch die Tatsache, dass es sich
schlicht um die einzige Maschine handelte, die an dieser
Fahrleitung
angeschlossen wurde. Daher konnte man diese
Sicherung
auch im Werk vorsehen.
Somit wurde die Lokomotive MFO 1 zur ersten Umfor-mermaschine der Welt, die für einphasigen Wechsel-strom von 15 000 Volt gebaut wurde.
Nötig war das, weil man zur damaligen Zeit schlicht noch keinen
brauchbaren
Triebmotor
für den direkten
Antrieb
hatte. Eingebaut wurde die zehn Tonnen schwere Umformer-gruppe in Längsrichtung zwischen den beiden Drehge-stellen.
An der
Fahrleitung
angeschlossen war ein
Asynchron-motor
für einphasigen
Wechselstrom
mit 50
Hertz
und einem
Rotor,
der als
Kurzschlussläufer
bezeichnet wurde. Dieser war schlicht von den
Drehstrommotoren
abgeleitet worden. Anders ausgedrückt handelte es sich um einen
Asynchronmotor, der mit Wechselstrom betrieben wurde.
Wegen seiner Konstruktion für
Drehstrom
konnte der Motor sich jedoch nicht automatisch in Bewegung setzen. Dazu
fehlte ihm schlicht die dritte Phase, die ein
Drehfeld
erzeugt hätte. Jedoch liefen
Asynchronmotoren
damals auch, wenn eine Phase während dem Betrieb ausgefallen war. Das war
eine Notwendigkeit wegen der aufwendigen
Fahrleitung.
Hier machte man sich diesen Effekt jedoch zu Nutze, so dass man mit
Wechselstrom
fahren konnte.
Die
Wicklungen
des Motors wurden entweder direkt ab der
Fahrleitung,
also mit der vollen
Spannung
von 15 000
Volt,
als auch über zwei luftgekühlte
Transformatoren
mit 700 Volt erregt. Je nach Quelle wurde mit der ersten oder der zweiten
Lösung gearbeitet. Dabei erwähnte Behn-Eschenburg am 20. August 1904, dass
es zu keinen Störungen an den Wicklungen der Hochspannung gekommen wäre.
Sie wird jedoch in späteren Berichten zu den
Versuchsfahrten
nicht mehr erwähnt.
Damit war rein theoretisch ein Betrieb der
Lokomotive
unter zwei
Spannungen
an der
Fahrleitung
möglich. Davon Gebrauch gemacht wurde jedoch nicht, so dass es keine
Zweisystemlokomotive
war. Wobei die Idee nicht so abwegig war. Es gab damals durchaus Bedenken, dass die hohe Spannung in der Fahrleitung für die Leute in den Städten gefährlich sein könnte.
Aus diesem Grund war bei einer späteren Umsetzung des Systems
vorgesehen, dass in
Bahnhöfen
durchaus mit einer reduzierten
Spannung
von 700
Volt
ge-fahren werden sollte. Umgesetzt wurde diese Idee jedoch nie, da man die
Sicher-heit mit der hohen Spannung erfolgreich erhöhte. An der Welle war ein Generator für Gleichstrom angeschlossen worden. Seine abgegebene Spannung konnte zwischen null und 600 Volt reguliert werden. Damit hatte man die für die Triebmotoren benötigte Spannung erhalten.
Grundsätzlich konnte dieser also stufenlos geregelt werden, was
der
Lokomotive
ein sehr elegantes Fahrverhalten verleiht haben dürfte, denn Fahrzeuge
ohne
Fahrstufen
waren bis zur Einführung der
Umrichter
selten.
Lediglich bei Dampflokomotiven gab es damals einen entsprechenden
Effekt. Wobei hier jedoch die Zwillingsmaschinen bei gewissen
Geschwindigkeiten zu einem ruckartigen Verhalten neigten. Mehrlinge liefen
in diesem Punkt bei einem gut abgestimmten
Fahrwerk
sehr ruhig. Die neuartigen elektrischen
Lokomotiven, sollten sich in diesem Punkt zumindest, bei der
hier vorgestellten Maschine MFO 1, nicht davon unterscheiden.
Jedoch war die
Umformergruppe
der
Lokomotive
noch nicht betriebsbereit, denn damit die
Spannung
für die
Fahrmotoren
generiert werden konnte, musste der
Umformer
der Lokomotive zuerst «gestartet» werden. Dazu erfolgte dieser
Startvorgang von der Seite mit
Gleichstrom
aus. Damit sich der
Generator
jedoch selbständig drehe, war ein zweiter Umformer nötig, den wir zur
Unterscheidung als «Erregergruppe» bezeichnen.
Dem aufmerksamen Leser ist sicherlich aufgefallen, dass in diesem
Schritt der Motor für
Gleichstrom
einfach nur an
Wechselstrom
angeschlossen wurde. Dabei kam durchaus das Prinzip des
Seriemotors
zur Anwendung. Jedoch lief dieser damals nur langsam an. Das heisst, er
erhöhte die Drehzahl immer mehr. So ein Motor, war jedoch für den direkten
Antrieb
einer
Lokomotive
schlicht nicht geeignet. Er musste jedoch nur noch leicht angepasst
werden.
Nach Erreichen dieser synchronen Geschwindigkeit wurde der
Asynchronmotor
der Erregergruppe an eine andere
Anzapfung
desselben
Transformators
angeschlossen. Damit begann sich nun dieser zu drehen und der
Generator
der Erregergruppe konnte nun eine
Gleichspannung
abgeben. Noch war die
Lokomotive
nicht betriebsbereit, denn nun konnte mit dieser
Spannung
die
Umformergruppe
über den Generator angelassen werden.
Da nun die
Umformergruppe
der
Lokomotive betriebsbereit war, wurde die Erregergruppe
umgeschaltet und diente nun der Erregung des Hauptgenerators und der
eingebauten
Fahrmotoren.
Sie sehen, dass der Start durchaus eine langwierige Angelegenheit war und
so kein schneller Einschaltvorgang möglich war. Jedoch haben wir nun die
Spannung
für die
Triebmotoren
und können uns diese nun ansehen, denn diese waren in den
Drehgestellen
eingebaut worden.
Die
Fahrmotoren
der
Lokomotive waren normale Gleichstrom-Nebenschlussmotoren
mit separater Erregung und einer
Leistung
von je 150 kW. Diese Motoren waren damals bereits erprobt und kamen bei
vielen Bahnen mit
Gleichstrom
in der
Fahrleitung
zur Anwendung. Vom Aufbau her unterschieden sich diese Motoren jedoch nur
durch die Beschaltung der Anschlüsse, von den später erfundenen
Seriemotoren
für
Wechselstrom.
Zum Vergleich der
Leistung
sei hier erwähnt, dass moderne
Lokomotiven mit
Umrichtertechnik
etwa die gleiche Leistung von 300 kW für die Versorgung der
Hilfsbetriebe
benötigen. Bei der Maschine ging es jedoch nicht um die Leistung, sondern
darum, das System zu testen. Für die vertraglich vereinbarten Fahrten mit
regelmässigen Zügen reichte diese Leistung jedoch aus, da die
Nebenlinie
keine schweren Züge kannte und so auch für die Versuche ideal war.
Die Fahrrichtung der
Lokomotive wurde geändert, indem man einfach die
Erregung der
Triebmotoren
umpolte. Diese drehten in der Folge in die andere Richtung, was
automatisch eine Änderung der Fahrrichtung zu Folge hatte. Für die
Umpolung verwendete man einen einfachen Umschalter, der nicht mit später
verwendeten
Wendeschaltern
verwechselt werden darf. Diese Lösung stammte ebenfalls von den mit
Gleichstrom
betriebenen Bahnen.
Zum Zeitpunkt des Baubeschlusses für diese
Lokomotive war das Hauptanliegen, die
Betriebstüchtigkeit von einphasigem
Wechselstrom
hoher
Spannung
in einer
Fahrleitung
nachzuweisen. Die eigentliche Lokomotive für den Betrieb sollte erst
entwickelt werden, wenn ein funktionierender Motor für einphasigen
Wechselstrom bereitstand. Man wusste 1904 bei der MFO schlicht noch nicht,
dass eigentlich nur eine andere Schaltung der
Fahrmotoren
nötig gewesen wäre.
Jedoch hatte die
Lokomotive auch einen besonderen Vorteil, der nicht
unerwähnt bleiben darf und der wirklich eine kleine Sensation war. Mit der
richtigen Schaltung wurden die beiden
Fahrmotoren
zu
Generatoren,
die dann den Hauptgenerator mit
Gleichstrom
versorgten. Über die Welle wurde im
Umformer
eine
Wechselspannung
erzeugt, die über die
Stromabnehmer
in die
Fahrleitung
abgegeben werden konnte.
Da wegen dem
Widerstand
die
Lokomotive verzögert wurde, war das Prinzip mit einer
heute bekannten
Nutzstrombremse
zur vergleichen. Der errechnete Wirkungsgrad dieser
elektrischen
Bremse wurde mit 50% angegeben. Dieser Wert sollte bei
Wechselstrom
über 80 Jahre nur von einer Lokomotive übertroffen werden. Erst die
modernen
Umrichter
mit
Drehstrommotoren
erreichen heute höhere Werte bei der
Nutzbremsung.
Es bleiben eigentlich nur noch die
Hilfsbetriebe
der
Lokomotive. Diese gab es eigentlich gar nicht. Einzig
zur Erzeugung der
Druckluft
war ein
Kompressor
vorhanden. Dieser Lufterzeuger wurde am Erregergenerator angeschlossen und
mit einem einfachen
Gleichstrommotor
angetrieben. Eine Schaltung verhinderte, dass zu viel Druck in der Leitung
erzeugt werden konnte. In diesem Fall wurde die Luft ins Freie abgegeben.
Die anderen heute bekannten Bereiche der
Hilfsbetriebe,
wie
Heizungen,
Ventilatoren
oder die Ladung der
Batterien
gab schlicht nicht. Somit hatte die
Lokomotive eine sehr einfache elektrische Ausrüstung
erhalten, die damals aber bereits eine sehr grosse Sensation darstellte,
denn es war die erste funktionierende Lokomotive für einphasigen
Wechselstrom
mit 15 000
Volt
und das weltweit, da braucht es keinen Schnickschnack mehr.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
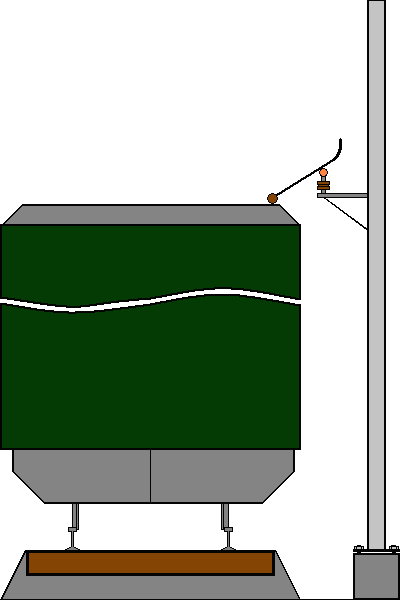
 Im
Inneren der
Im
Inneren der 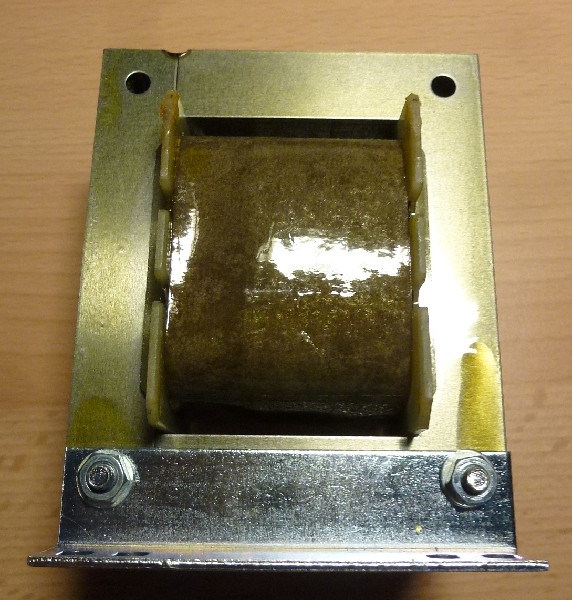 Daher
müssen auch die beiden mit Luft gekühlten
Daher
müssen auch die beiden mit Luft gekühlten  Das
Anlassen der
Das
Anlassen der 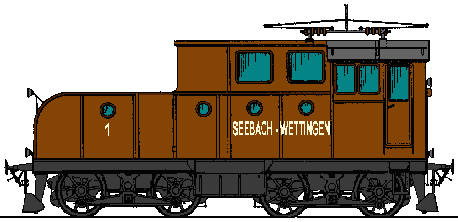 Die
Die