|
Elektrische Ausrüstung MFO 2 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Obwohl die
Lokomotive
MFO 2 nur gerade ein Jahr später in Betrieb kann, war sie mit der ersten
Maschine elektrisch schlicht nicht vergleichbar. Während der Zeit, als die
beiden Maschinen entwickelt wurden, gab es eine entscheidende Wende. Es
wurde endlich ein funktionierender Motor für einphasigen
Wechselstrom
entwickelt. Bei der ersten Maschine konnte dieser jedoch nicht mehr
eingebaut werden, da diese zu weit gebaut war.
Bevor wir zur elektrischen Ausrüstung der zweiten
Lokomotive
kommen, müssen wir ein paar Worte zum Motor verlieren. Eigentlich hatte
bereits die Lokomotive MFO 1 die passenden Motoren erhalten. Jedoch
erfolgte dort die Schaltung so, dass der Erreger unabhängig vom
Rotor
versorgt wurde. Wollte man diesen Motor jedoch unter
Wechselstrom
einsetzen, musste der
Stator
lediglich in Reihe zum Rotor geschaltet werden.
Jedoch war es erst die Nummer 2, die dann dem einphasigen Wechselstrom hoher Spannung den Durchbruch brachte, wie wir ihn heute kennen.
Daher waren alle in der Schweiz danach gebauten
Lokomotive
Nachkommen dieser Lokomotive. Mittlerweile hatte sich aber bei der Fahrleitung eine entscheidende Veränderung ergeben.
Die
Lokomotive
MFO 1 verursachte bei der Fahrt Störungen in den Leitungen der
Telegrafen.
Diese konnten in einem ersten Schritt nur durch die Reduktion der
Frequenz
eliminiert werden. Daher wurde die
Fahrleitung
bei der der zweiten Maschine mit einphasigem
Wechselstrom
von 15 000
Volt
und einer
Frequenz
von 15
Hertz
versorgt.
Selbst der Bock war vorhanden, weil nur er den Wechsel der Ruten
über das Dach erlaubte. Ein Punkt, der hier jedoch nicht so gut zu
erkennen war, da der geänderte Kasten diese Einrichtung verdeckte. Mit Hilfe der Kraft einer Feder wurde die Rute an den Fahrdraht gedrückt und so ein sicherer Kontakt ermöglicht. Damit die Lokomotive auch von der Fahrleitung getrennt werden konnte, waren sowohl der Bock, als auch die beiden Ruten manuell steuerbar.
So konnte die Ruten einfach vom
Fahrdraht
abgezogen werden, was auch bei dieser
Fahrleitung
als gesenkt bezeichnet wurde. Es war jedoch nun kein Kontakt mehr
vorhanden.
Nicht eingestellt werden konnte die Kraft mit der die Rute gegen
den
Fahrdraht
drückte. Da der Kontakt wegen dem einfach aufgehängten Fahrdraht und der
Trägheit der Ruten immer wieder kurzzeitig verloren ging, störte diese
Fahrleitung
zusammen mit der
Lokomotive
die
Telegrafen.
Es muss dabei erwähnt werden, dass diese damals entlang der
Bahnlinien
verliefen und so sehr nahe bei der Fahrleitung montiert wurden.
Sie haben richtig gelesen, das Problem sollte auch hier auftreten.
Die Reduktion der
Frequenz
wurde durch die neuen
Wechselstrommotoren
und die etwas höhere Geschwindigkeit vernichtet. In der Folge gab es
Störungen, die jedoch nur behoben werden konnten, weil ein findiger Kopf
auf die Idee kam, die Leitungen der
Telegrafen
zu kreuzen. Damit war der Weg für diese
Lokomotive
frei, denn schliesslich verkörperte sie die Konstruktion für nahezu 80
Jahre.
Die so auf das Dach der
Lokomotive
übertragene
Spannung
der
Fahrleitung
wurde durch eine Induktionsspule und an einem Blitzableiter vorbei zur
Dachdurchführung
geleitet. Damit gab es schon eine Schutzeinrichtung, denn Blitzschläge
konnten den Lokomotiven gefährlich werden. Jedoch war auch hier keine
Einrichtung vorhanden, die es ermöglicht hätte, die Lokomotive
auszuschalten und so sicher vom Netz zu trennen.
Über die
Dachdurchführung
gelangte die
Spannung
aus der
Fahrleitung
erstmals in den Kasten. Damit wurde sie auch erstmals für das Personal
gefährlich. Damit die Leitung nicht zu lange wurde, schloss man diese ohne
grössere Vorkehrungen an den
Primärwicklungen
der beiden
Transformatoren
an. Spezielle Schutzgitter, wie man sie heute bei vergleichbaren
Lokomotiven
kennt, gab es jedoch nicht, so dass der Aufenthalt im
Maschinenraum
nicht ungefährlich war.
Diese Schaltung war notwendig, da die
Elektrizität
nicht über die
Lager
geleitet werden durfte. Die entsprechenden Erfahrungen waren mit der
ersten
Loko-motive
gemacht worden und wurden hier mit diesen Einrichtungen verbessert, auch
wenn sie nicht perfekt aufgebaut wurden. Wenn wir nun zur sekundären Seite der beiden Transformatoren kommen, erkennen wir deren Spule, die über nicht weniger als 20 Anzapfungen verfügte. Die dabei abgegriffene Spannung bewegte sich im Bereich zwischen null und 700 Volt.
Damit entsprachen diese
Transformatoren
mit Ausnahme der vorhandenen
An-zapfungen
den Modellen, wie sie schon bei der ersten
Lokomotive
verwendet wurden. Man wollte einfach keine Neuentwicklung. Somit war der Transformator sehr einfach aufgebaut und entsprach jenen Mo-dellen, die wir auch heute noch bei einfachen Verhältnissen verwenden. Es muss aber erwähnt werden, dass sich daran grundsätzlich bis in die heutige Zeit nur die Art der Kühlung veränderte.
Das damalige Prinzip der
Transformatoren
wurde bis zum heutigen Tag nicht in Frage gestellt, denn es war und blieb
die einfachste Art, eine
Wechselspannung
zu verändern.
Die
Spannungen
der
Anzapfungen
konnten jedoch nicht direkt den
Triebmotoren
zugeführt werden. Diese drehten sich unterschiedlich und waren daher von
der Spannung abhängig. Jedoch sollte diese Energie nach Möglichkeit ohne
Unterbruch und möglichst ohne merkbare Stufen den
Fahrmotoren
zugeführt werden. So einfach das klingt, war die Lösung jedoch nicht.
Daher wurden hier zwei unterschiedliche Lösungen für das Problem
verwendet.
Man wollte dadurch auch Erfahrungen mit der Regulierbarkeit von
Wechselstrom
sammeln. Bisher war diese gar noch nicht erprobt worden, denn die
Lokomotive
MFO 1 arbeitete mit einem
Umformer
und die
Fahrmotoren
wurden dort mit
Gleichstrom
versorgt. Dabei kamen jedoch weder
Hüpfer
noch die später bei Lokomotiven verwendeten
Stufenschalter
zum Einbau. Es lohnt sich daher, diese beiden Systeme etwas genauer zu
betrachten.
Das erste System, das wir uns anschauen wollen, ist der
Zellenschalter. Diese Einrichtung wurde von einem der beiden
Führerstände
beeinflusst. Dazu war dort eine einfache Kurbel vorhanden. Damit konnten
diese 20
Fahrstufen
jedoch ohne grösseren Zusammenbruch bei der
Zugkraft
geschaltet werden. Dabei entstanden jedoch Funken, die je nach
geschalteter
Spannung
durchaus zu ernsten Problemen führen konnten.
Wurde eine Schaltung ausgeführt, schaltete sich die neue Stufe zu
und anschliessend wurde die bisherige
Fahrstufe
ausgeschaltet. Dadurch entstanden bei der Schaltung zwar ein
Kurzschluss
und ein
Lichtbogen.
Beide wurden jedoch durch die eingebaute Funkenlöschung unschädlich
gemacht. Ein Prinzip, das als Grundstein der späteren
Stufenschalter
mit nachgeschalteten
Lastschaltern
angesehen werden konnte und das für diese
Leistung ausreichte.
Dabei stand der
Stufenschalter
sicherlich in der ersten Rei-he, auch wenn auf der hier vorgestellten
Lokomotive
MFO 2 eine weitere Lösung für das Problem mit den unterschied-lichen
Spannungen
gesucht wurde. Das zweite eingebaute System arbeite anfänglich mit einem Induktionsregler, der sich jedoch nicht bewährte und somit so schnell umgebaut wurde, dass wir hier mit der Umbau-variante arbeiten müssen.
Die Lösung wurde zwar in Dokumenten erwähnt, es fanden sich jedoch
keine Hinweise, dass die ursprüngliche Lösung auch nur im Ansatz
funktioniert hätte. Aus diesem Grund können wir uns gleich der umgebauten
Lösung zuwenden.
Es wurde bei der
Lokomotive
für die zweite Lösung in den beiden
Führerständen
einfach ein
Steuerkontroller
montiert. Die an diesem Kontroller angebrachte Kontaktwalze regelte die
Spannung
der
Fahrmotoren
direkt, indem die Leitungen darüber geführt wurden. Ein zusätzlicher
Hilfstransformator verhinderte, dass zwischen den geschalteten
Anzapfungen
ein
Kurzschluss
entstehen konnte. Schaltelemente gab es jedoch nicht.
Diese direkte Regelung der
Fahrstufen
war nur dank der geringen
Leistung der
Lokomotive
möglich geworden. Sie konnte daher später nicht mehr beim Bau vom
Triebfahrzeugen
verwendet werden. Jedoch wurden später solche Kontaktwalzen zur
Ansteuerung der
Hüpfer
verwendet. Jedoch kamen dabei nur noch die
Spannungen
der Steuerung zur Anwendung und nicht mehr der Traktionsstrom, der hier
bis zu 700
Volt
betragen konnte.
Nach den beiden unabhängigen Regelungen für die
Fahrstufen
folgte dann ein pneumatisch betriebener Aus- und Umschalter. Neben den
Einstellungen für die Änderung der Fahrrichtung, wurde durch diesen
Umschalter auch die beiden Regelungen geschaltet und gegeneinander
verriegelt. Daher konnte immer nur mit einer vorhandenen Regelung gefahren
werden. Heute sind diese Umschalter auch als
Wendeschalter
bekannt.
Eine elektrische
Nutzstrombremse,
wie es sie auf der
Lokomotive
Nummer 1 gab, war hier jedoch nicht mehr vorhanden. Die dafür notwendigen
Schaltungen wurden erst später durch Herrn Behn-Eschenburg entwickelt und
waren damals gar nicht vorgesehen, da auch bei den Dampflokomotiven keine
vergleichbaren
Bremsen
vorhanden waren. Erst ein schwerer Unfall sollte diese Bremsen bringen,
aber das war nicht diese Lokomotive.
Jedoch kannte man diese Lösung auch schon länger. Vielmehr waren
die an diesem Umschalter angeschlos-senen Bauteile die grosse Neuheit,
denn diese
Fahrmo-toren
wurden erstmals mit
Wechselstrom
und nicht mit
Gleichstrom
betrieben. Es wurden zwei für Wechselstrom gebaute Fahrmotoren eingebaut. Diese Motoren wurden aus den Modellen für Gleichstrom weiterentwickelt. Dabei wurde die Spule der Erregung einfach in Reihe zum Rotor geschaltet.
Jedoch konnte der Motor so noch nicht betrieben werden, denn es
musste die Drehrichtung bestimmt werden und das war letztlich der
entscheidende Punkt bei der Entwicklung dieser
Seriemotoren,
die auch als
Reihenschlussmotoren
bezeichnet wurde. Die Drehrichtung des Motors wurde mit einem phasen-verschobenen Wendefeld festgelegt. Dieser Wendepol erzeugte ein Magnetfeld, das den Rotor in eine bestimmte Richtung zwang.
Dadurch konnte die Drehrichtung definiert werden. Um diese, wie es
bei
Lokomotiven
wichtig ist, zu ändern, wurde einfach der Wendepol umgekehrt
angeschlossen. Damit begann sich der Motor in die andere Richtung zu
drehen.
Die
Reihenschlussmotoren
bildeten die Grundlage für die weiteren
Lokomotiven,
so dass die Maschine mit der Nummer 2 zur ersten Lokomotiven für
einphasigen
Wechselstrom
hoher
Spannung
mit Direktmotoren wurde. Die Motoren waren so gut, dass diese später in
sehr vielen Lokomotiven verwendet wurden. Jedoch durften sie nicht leer
drehen, was bei einem
Triebfahrzeug
aufgrund des Aufbaus schlicht nicht möglich war.
Wer nun bei dieser
Lokomotive
Hilfsbetriebe
erwartet, wurde im Gegensatz zu den Nebenbetrieben belohnt. Zwar
entsprachen diese Hilfsbetriebe in keiner Weise den bekannten Systemen und
auch der Umfang konnte als sehr bescheiden angesehen werden. Es wurde
lediglich der
Kompressor
angeschlossen und somit die Erzeugung der
Druckluft.
Dieser wurde über den Druck in der Leitung geregelt und konnte auch
manuell beeinflusst werden.
Angeschlossen wurde der
Kompressor
an einer eigenen
Anzapfung. Diese hatte eine
Spannung
von 140
Volt.
Spannend ist hier jedoch, dass auch in diesem Bereich die neuen
Reihenschlussmotoren
verwendet wurden. Hier hätte sich durchaus die Lösung mit
Umformer
und
Gleichstrom
angeboten. Jedoch waren die neuen Motoren so gut, dass sie auch hier
verwendet wurden. Letztlich waren sie es, die dem
Wechselstrom
zum Erfolg verhalfen.
Mehr war jedoch nicht mehr vorhanden. So wurden auch hier die
Bauteile auf natürliche Weise gekühlt und keine künstliche
Ventilation
benötigt. Auch die in der Regel dringend benötigten
Umformer
für die Ladung der
Batterien
war bei dieser Maschine nicht vorhanden. Der Grund für diesen Verzicht war
sehr einfach, denn es wurden schlicht keine Batterien eingebaut und somit
war keine Steuerung vorhanden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
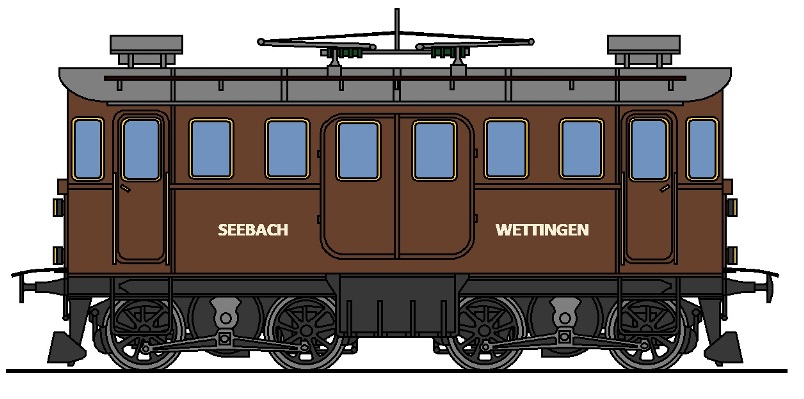 Die
Die
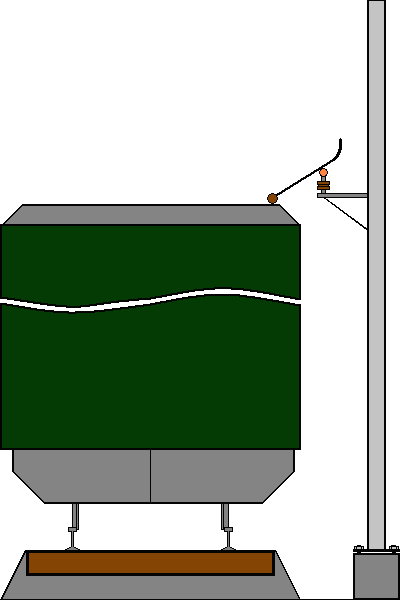
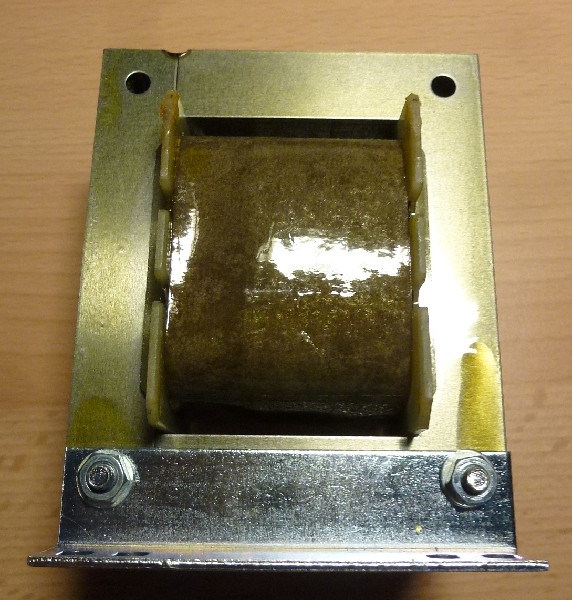 Die
beiden
Die
beiden 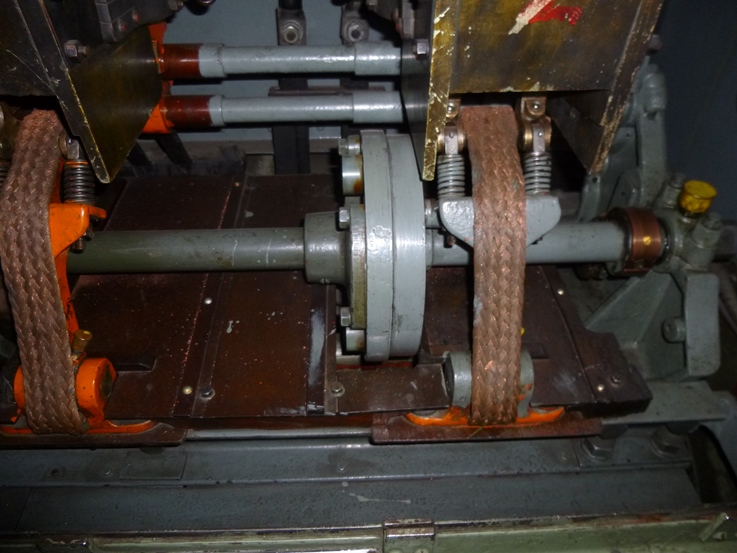 So
primitiv diese Lösung mit dem heutigen Wissen auch sein mag, sie
funktionierte und das war der Sinn der Ein-richtung. Bei der zweiten
So
primitiv diese Lösung mit dem heutigen Wissen auch sein mag, sie
funktionierte und das war der Sinn der Ein-richtung. Bei der zweiten
 Bis
jetzt war die
Bis
jetzt war die