|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Das
Fahrwerk
der
Lokomotive bestand aus zwei unter dem Kasten eingebauten
Drehgestellen. Mit wenigen Ausnahmen waren diese
identisch ausgeführt worden. So können wir uns auf ein Exemplar
beschränken und so die Betrachtung etwas vereinfachen. Wo Unterschiede
vorhanden waren, werden diese natürlich erwähnt. Ich kann Ihnen jedoch
versichern, viel wird sich nicht finden lassen, denn unnötig schwer machte
man es sich nicht.
So entstanden die beiden gekröpften
Längsträger, die mit dem kräftigen Mittelträger und den beiden
abschliessenden Querträgern verbunden wurden. Es war ein bei
Triebwagen
übliches
Drehgestell.
Die abschliessenden Querträger wurden zur
Stabili-sierung der Schenkel benötigt. Zudem waren hier auch einige
Supporte für die Empfänger der
Zug-sicherungen
vorhanden. Diese werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ansehen, hier
reicht es, dass je nach der Konfiguration die Endträger anders ausgeführt
wurden. Weitere Anbauten gab es hier jedoch nicht mehr, denn die Kräfte
wurden in der Mitte übertragen.
Je nach der Konfiguration und der
Ausstattung fanden an diesem Querträger nicht alle Bauteile einen Platz.
Aus diesem Grund waren auch zwischen den beiden
Achsen
am
Drehgestellrahmen
noch Supporte für die
Zugsicherungen
vorhanden. Bei diesen war speziell, dass sie sich genau unter dem Sitz des
Lokführers befanden und so der Zeitpunkt für die Ansprechung von der
Geschwindigkeit unabhängig erfolgen konnte.
Um den Bereich mit den hier verbauten Supporten
abschliessen zu können, muss ich noch die nach unten geführten Bauteile
erwähnen. Diese waren für die auf der
Lokomotive verbaute
Sandstreueinrichtung benötigt worden. Näher auf diese Einrichtung werden
wir später eingehen, es reicht, wenn wir die kräftigen Supporte dafür
kennen gelernt haben. Da diese auch für die
Bremsen benötigt wurden,
mussten sie erwähnt werden.
Aus diesem Grund wurden sie auch
kräftiger aufgebaut, als das alleine durch die
Sander zu erwarten war. Sie
sehen, es wurde sehr viel Wert auf den Schutz des
Drehgestells und so dem
Fahrzeug gelegt. In jedem Drehgestellrahmen wurden zwei identische Achsen eingebaut. Für einen Radsatz verwendete man eine geschmiedete Achswelle, die mit den erforderlichen Sitzen versehen worden war.
Auf der
Welle wurden die beiden
Räder und die
Achslager aufgezogen. Bevor wir
jedoch zu den
Lagern kommen, bauen wir den
Radsatz noch fertig auf und
dabei fehlen uns nur noch die beiden identischen Räder einer
Achse.
Aufgezogen wurden
Monoblocräder. Die bei solchen
Radsätzen übliche Lösung mit kompletten Aufbauten konnte wegen den
Bauteilen des
Antriebes nicht verwendet werden. Daher wurden die
Scheibenräder aufgezogen und dabei hatten sie im Neuzustand einen
Durchmesser von 1 250 mm erhalten. Eine
Verschleissrille gab den minimalen
Wert vor und dieser lag bei 1 170 mm. In dem Fall musste das ganze
Rad
gewechselt werden.
Es wird nun Zeit, dass wir den
Radsatz einbauen.
Dabei wurde hier eine aussen liegende
Lagerung vorgesehen. Für die
Achslager wurden die seit Jahren üblichen doppelreihigen
Rollenlager
verwendet. Die Rollen dieser
Lager waren fassförmig aufgebaut worden und
so konnten die Probleme mit dem Einbau umgangen werden. Es war daher eine
gute Lagerung vorhanden, die in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut
wurde.
Es war so
eine Dauerschmierung vorhanden, die kaum eine Wartung erforderlich machte.
Bei einem Wechsel des
Radsatzes wurden auch gleich die
Lager ersetzt. Wir
haben damit den üblichen Standard bei Bahnen erhalten. Die Achse wurde gegenüber dem Drehgestellrahmen abgefedert. Dazu waren am Gehäuse des Achslagers seitliche Schenkel vorhanden. Zwischen diesen und dem Rahmen wurden dann die beiden Schrauben-federn eingebaut.
Auch wenn sie so bezeichnet wurden, die
Federn
waren als
Flexicoilfedern ausgeführt worden. Bei den Bahnen kamen die
nicht auf Torsion belastbaren
Schraubenfedern kaum mehr zur Anwendung. Schraubenfedern verfügen über eine kurze Schwing-ungsdauer. Daher konnten sie sich ohne Gegenmass-nahme aufschaukeln, was zu einem unruhigen Lauf-verhalten führte. Daher wurde eine Dämpfung einge-baut.
Es wurden aussen am Rahmen auf beiden Seiten hy-draulische
Stossdämpfer verbaut. Diese
Dämpfer funktionierten gut und wurden auch an anderen
Orten verwendet, so dass sie günstig bezogen wer-den konnten.
Da wir nun die beiden
Radsätze im
Drehgestell
posi-tioniert haben, können wir wieder zum Messband greifen. Bei dieser
Maschine wurde dabei ein Wert von 2 900 mm ermittelt, was recht hoch war.
Trotzdem sollten mit der
Lokomotive Radien bis zu einem Radius von 80
Meter befahren werden können. Mit dem Aufbau war jedoch ohne eine aktive
radiale Einstellung der
Achsen die in der Schweiz verlangte
Zulassung
zur
Zugreihe R nicht mehr möglich.
Diese
Spurkranzschmierung war in der
Schweiz üblich und es gelang so die Kräfte im
Gleis trotz der hohen
Achslast so zu ver-mindern, dass eine
Zulassung zur
Zugreihe R möglich
wurde. Damit konnte die
Höchstgeschwindigkeit auch ausgefahren wer-den. Trotzdem war wegen dem Fahrwerk und der hier vorhandenen sehr hohen Achslast ein freizügiger Einsatz von den Behörden nicht zu erwarten.
Gerade in der Schweiz wurde daher verfügt, dass die
Lokomo-tiven auch bei Fahrten nach der
Zugreihe R nur Strecken be-fahren
durften, die für die
Streckenklasse D ausgelegt wurden. Da davon nur noch
wenige
Nebenstrecken betroffen waren, war das keine so grosse
Beschränkung. Mit dem Aufbau haben wir den Radsatz eingebaut, jedoch war dieser noch nicht in der Lage stabil. Dazu wurden zwischen dem Achslager und dem Drehgestellrahmen seitliche Radsatzlenker verbaut.
Diese
waren jedoch so flexibel ausgeführt worden, dass sich die
Achse passiv
radial einstellen konnte. Ein Punkt, der die
Zulass-ung
zur
Zugreihe R
erleichterte. Damit haben wir aber das
Drehgestell aufgebaut, jedoch nur
ein
Laufdrehgestell.
Um aus dem
Drehgestell ein
Triebdrehgestell zu
machen, mussten noch
Antriebe eingebaut werden. Dazu war für jede
Achse
ein im Drehgestell eingebauter
Fahrmotor vorhanden. Das von diesem Motor
erzeugte
Drehmoment konnte jedoch nicht direkt auf die
Triebachse übertragen
werden, da die Drehzahlen schlicht zu hoch waren. Daher wurde am Motor in
einem Gehäuse ein
Getriebe zur Anpassung des Drehmoments vorgesehen.
Zur
Schmierung der empfindlichen
Zahnräder wurde am unteren Ende des
Gehäuses eine
Ölwanne eingebaut. So wurde das
Öl als
Schmiermittel durch
Anhaftung auf das gesamte
Getriebe übertragen und dieses so optimal
ge-schmiert. Abgestützt wurden der Fahrmotor und das Getriebe über die Achse und die Lager im Drehgestellrahmen. Wir haben damit einen klassischen Tatzlagerantrieb erhalten.
Dank den sehr flexiblen
Lagern
konnte sich der Motor so ver-schieben, dass die passive radiale Einstellung
der
Triebachse nicht behindert wurde. Jedoch blieb die hohe ungefederte
Masse erhalten. Diese konnte jedoch dank der neuen Moto-ren verringert
werden.
Trotzdem konnten die Probleme dieses
Tatzlagerantriebes nicht
vollständig eliminiert werden. Besonders bei hohen Geschwindigkeiten
ergaben sich daher Probleme mit dem Laufverhalten des
Drehgestells. Aus
diesem Grund musste zu Wahrung der Sicherheit die
Höchstgeschwindigkeit
der
Lokomotive auf einen Wert von 140 km/h begrenzt werden. Abgesehen
davon konnte mit diesem
Laufwerk auch schneller gefahren werden.
Bevor wir uns die Kraftübertragung ansehen, müssen
wir die beiden
Drehgestelle unter dem Kasten einbauen. Diese waren
gegenüber dem Kasten gefedert worden. Wie schon bei der
Primärfederung
kamen bei der
Sekundärfederung die guten
Flexicoilfedern zum Einbau. Hier
waren diese besonders wichtig, das sie grossen Torsionskräften ausgesetzt
wurden. Der Platz war dank dem gekröpften Rahmen vorhanden.
So wurden trotz der direkten
Abstützung die Vibra-tionen des
Drehgestells nicht auf den Kasten
übertragen. Jedoch haben wir auch jetzt noch keine Führung er-halten und
das
Laufwerk musste noch in seiner Position gehalten werden. Dabei kam es
zu einer klassischen Lösung.
An der
Lokomotivbrücke waren zur Führung des
Dreh-gestells normale rechteckige
Drehzapfen angebaut wor-den. Diese griffen
in den mittigen Querträger des Rah-mens und führten so das
Laufwerk. Jedoch
ergab sich durch diesen Aufbau ein Problem, denn bei einer Befestigung war
es dem
Fahrwerk nicht mehr möglich, sich unter dem Kasten zu bewegen.
Daher musste mit Gummipaketen eine flexible Lösung verbaut werden.
Da die
Lokomotive nun auf dem
Fahrwerk steht, können
wir wieder zum Messband greifen. Diese wurde mit 4 245 mm angegeben und
sie berücksichtigte dabei die Wirkung der
Federung durch das Gewicht.
Zudem wurde der höchste Punkt durch die gesenkten
Stromabnehmer erreicht.
Wir müssen nun das
Drehmoment der
Fahrmotoren auf das Fahrzeug übertragen und
dabei treffen wir auf bereits bekannte Bauteile.
Wie wir schon erfahren haben, wurde das
Drehmoment
der
Fahrmotoren im
Getriebe verändert und so auf die
Achse und in die
Räder übertragen. In den Rädern wurde das Drehmoment schliesslich mit
Hilfe der
Haftreibung zwischen
Lauffläche und
Schiene in
Zugkraft
umgewandelt. Die hier gelten physikalischen Gesetze waren vom Zustand der
Schienen direkt abhängig und konnten zu nicht optimalen Werten führen.
So konnte die
Haftreibung verbessert werden und das war wegen den glatten Oberflächen
wichtig. Aus diesem Grund wurde die Anlage so ausgelegt, dass auch ein
dauerhafter Betrieb der
Sander möglich war. Die nun vorhandene Zugkraft wurde wieder in die Räder und die Achse übertragen. Über die Achslager und die am Gehäuse montierten Lenkstangen gelangte die Kraft in den Drehgestellrahmen und wurde dort mit jener der zweiten Achse übertragen.
Der erwähnte
Drehzapfen
besorgte dann die Übertragung in die
Lokomotivbrücke und die
Zugvorrichtungen. Vom Fahrzeug und der
Anhängelast nicht benötigte
Zugkraft, ergab dann die Beschleunigung. Lösungen mit Drehzapfen führten sehr oft dazu, dass das Drehgestell kippen konnte. Dadurch verringerte sich die Achslast auf der vorlaufenden Achse.
Um das zu verhindern, war der Rahmen gekröpft
ausge-führt worden und die Kraft setzte unterhalb der
Achse an. Damit
wirkte dieser Punkt dem
Drehmoment entgegen und die Lasten waren wieder
ausgeglichen. So konnte man leicht auf den Einbau von
Zugstangen
verzichten.
Sollten Sie nun befürchtet haben, einen wichtigen
Unterschied zwischen den beiden
Drehgestellen verpasst zu haben, kann ich
Sie beruhigen. Es gab diesen auch nicht, denn es wurden identische
Lösungen vorgesehen. Wegen dem weiteren Aufbau war es auch nicht mehr
möglich eine
Querkupplung zu verbauen. Diese Aufgabe übernahmen nun die
hydraulischen Schlinger- und
Querdämpfer zwischen dem Kasten und dem Drehgesell.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Bei
einem
Bei
einem
 Die Träger für die
Die Träger für die
 Auch
Auch
 Um diese Bedingungen zu erfüllen, wurde der Lauf des
Um diese Bedingungen zu erfüllen, wurde der Lauf des
 Das im
Das im
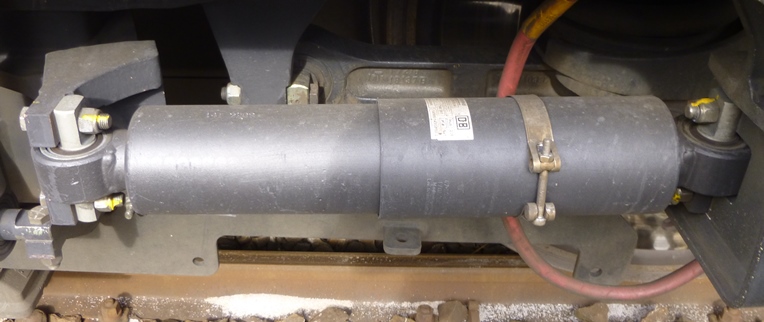 Um die kurze Schwingungsdauer
dieser
Um die kurze Schwingungsdauer
dieser
 Um die
Um die