|
Der Kasten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Da hier
Drehgestelle verwendet wurde, fehlte der stabile Rahmen für
den Kasten. Daher musste dieser als eigene Baugruppe aufgebaut werden.
Dazu wurde ein als Boden ausgebildeter Rahmen aufgebaut. Dieser konnte
jedoch nur den Kasten und die darin verbauten Baugruppen tragen.
Zugkräfte
wurden nicht übertragen. Man nannte diese Bauweise
Lokomotivbrücke
und sie wurde bis anhin bei den meisten Baureihen verwendet.
Beginnen wir den
Aufbau des Kastens mit den beiden Sei-tenwänden. Diese waren in sich
gespiegelt, so dass eine harmonisch wirkende Seite entstehen sollte.
Trotzdem gab es Unterschiede, die wir uns ansehen müssen. Stellen wir uns eine Seitenwand als senkrecht aufragendes Blech vor. Dieses war mit der Lokomotivbrücke verbunden und die Wand stützte sich auf Portalen ab.
Diese befanden sich
gleichmässig auf die Seitenwand verteilt sowohl in der Mitte, als auch in
den Viertelspunkten. Zu erkennen waren diese drei
Portale
an den aussen angebrachten senkrecht verlaufenden Nietenbändern. Wobei es
hier einen wichtigen Unterschied gab.
Bei den älteren
Lokomotiven mit den Nummern 201 bis 204 beschränkten
sich diese Nietenbänder auf die obere Hälfte der Seitenwand. Dort verlief
ein längs verbauten Nietenband, das jedoch nicht als solches genutzt
wurde. Man stellte die obere Hälfte der Seitenwand einfach in diesen als U
ausgeführten Bereich ab. Die Fixierung erfolgte mit den drei Nietenbändern
und den Rückwänden zu den
Führerständen,
die wir später ansehen werden.
Bei den höheren
Nummern wurden die beiden Nietenbänder in den Viertelspunkten jedoch ganz
nach unten gezogen. Sie konnten daher auch anhand dieses Details leicht
unterschieden werden. Jedoch bieten und diese Nietenbänder auch gleich
eine Unterteilung. Damit kann sich anhand der so entstandenen Segmente
eine einfachere Beschreibung anstellen. Sie müssen dabei einfach wissen,
dass im unteren Teil der Nummern 205 bis 208 ein Nietenband vorhanden war.
Die beiden Seitenwände der
Lokomotive unterschieden sich jedoch nur in Details voneinander. Beginnen
wir mit der unteren Hälfte, die durchaus einfach aufgebaut worden war. Bei
den älteren Maschinen war es eine geschlossene Wand, bei den neueren gab
es die beiden seitlichen Segmente. Letztere waren wegen dem oberen Teil
nicht gleichmässig verteilt worden. Daher können wir mit deren Hilfe aber
die Öffnungen in der unteren Hälfte betrachten.
Sie sehen,
es gab wirklich kaum Unterschiede, das galt natürlich auch für den Aufbau
mit längs verlaufenden Lamellen. Diese ver-hinderten dabei eigentlich nur,
dass Wasser in den Innenraum ge-langen konnte. Es gab keine Filtermatten, welche die Luft, die durch die Gitter strömte, gereinigt hätten. Es war daher nur eine einfache Öff-nung, die mit den Lamellen vor Nässe geschützt wurde.
Eine damals durchaus gängige Lösung für die Zufuhr von Frisch-luft
in den Innenraum. Gerade die Baureihe
Be 5/7 zeigte, dass diesem Punkt
eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden musste, denn die Temperatur
in diesem Bereich war sehr hoch.
In diesen beiden Segmenten
waren auch die
Anhebepunkte für den Kasten platziert worden. Diese
Supporte standen dabei vom Kasten ab, so dass Ketten frei geführt werden
konnten. Es war dank diesen Supporten in der Werkstatt möglich, den Kasten
als ein Bauteil von der
Lokomotive zu heben. Um die ganze Lokomotive
abzuheben, war jedoch die
Lokomotivbrücke
zu schwach ausgeführt worden und
man musste Querträger unter den
Drehgestellen verwenden.
Um die untere Hälfte der
Seitenwand abzuschliessen, erwähne ich noch den Teil in der Mitte. Wobei
dieser bei den Nummern 201 bis 204 die gesamte Länge umfasste. Hier gab es
schlicht keine weiteren Öffnungen. Wichtig wird dieser Bereich erst, wenn
wir uns den Anschriften zuwenden. Bisher ist es aber bloss eine einfache
und geschlossene Wand, wie es sie bei
Lokomotiven immer wieder gab, da sie
sehr leicht waren.
So gesehen, hatten die
Lokomotiven im unteren Bereich einfache Seitenwände erhalten, die auf
beiden Seiten identisch ausgeführt wurden. Der Eleganz der Maschine kamen
diese einfachen Seitenwände hingegen zu gute. Es entstand so eine
harmonisch aufgebaute Lokomotive. Doch sehen wir und die vier Segmente im
oberen Bereich noch an, denn diese änderten an der erwähnten Tatsache
nicht sehr viel, denn sie waren identisch.
Auf die Position, der nachfolgend
erwähnten Fenster hatte das jedoch schlicht keine Auswirkungen. Wir sehen
uns die Wand der unteren Nummern an, das sie etwas leichter zu erklären
ist. Sie werden gleich erfahren warum. In jedem der vier Segmente war in der Mitte ein grosses Fenster eingebaut worden. Dieses war in der Höhe fast so hoch, wie das gesamte Segment. Dieses Fenster konnte in Längsrichtung hin verschoben und so geöffnet werden.
Dies erlaubte
zusätzlich frische Luft in den
Maschinenraum zu lassen. Zudem waren die
Fenster gross genug, dass sie auch als Fluchtweg genutzt werden konnten,
denn der Maschinenraum bot dem Personal einen guten Schutz. Bei den oberen Nummern befanden sich die vier Fenster an der gleichen Stelle. Da hier jedoch das mittlere Nietenband fehlte, fiel dieser Aspekt nicht so schnell auf.
Es
kann daher für alle
Lokomotiven gesagt werden, dass die Seitenfenster
gleichmässig auf die Länge verteilt wurden. Das erlaubte bei Tag eine sehr
gute Ausleuchtung des
Maschinen-raumes. Ein Punkt, der insbesondere genutzt
wurde, wenn der Führerstand gewechselt wurde.
Abgeschlossen wurden die
beiden Seitenwände der
Lokomotive mit den beiden Rückwänden zu den
Führerständen. Diese hatten zwei wichtige Aufgaben. So mussten mit diesen
Querwänden die beiden Seitenwände abgestützt werden. Hingegen bildete die
Wand den Abschluss des
Maschinenraumes von den
Führerräumen. Der so
entstandene Raum diente den Bauteilen der elektrischen Ausrüstung und
diese musste vor Nässe geschützt werden.
Abgedeckt wurde der Kasten im
Bereich des
Maschinenraumes mit einem Dach aus Stahlblech. Das Dach war
leicht gewölbt worden, so dass das Regenwasser seitlich abfliessen konnte.
Durch die seitlich stark gerundeten Abschlüsse gelangte das Wasser zu den
zur Seitenwand hin angeordneten Dachrinnen. In diesen sammelte sich das
Wasser und es wurde schliesslich in Fallrohren unter dem Kasten zum Boden
hin entlassen.
Das Dach selber hatte keine Stege, es konnte jedoch
vom Personal begangen werden. Wobei dort natürlich die zahl-reichen
Aufbauten eher hinderlich wirkten. Abgesehen von der elektrischen Ausrüstung, diese werden wir später noch genauer ansehen, war In der Mitte der Lokomotive ein Aufbau auf dem Dach vorhanden.
Dieser war
nur sehr flach, nahm jedoch gut die halbe Länge des
Maschinenraumes in
Anspruch. Durch die seit-lichen Schlitze an diesem Aufbau konnte hier die
warme Luft aus dem Innenraum entweichen. Eine Verbesserung bei der
Kühlung, die schon bei der Baureihe
Be 5/7 verwendet wurde.
Speziell war, dass dieser
Aufbau im zentralen Bereich zu niedrig war. Hier wurde der
Transformator
im
Maschinenraum aufgestellt. Durch seine Grösse war die Distanz zum Dach
zu gering. Daher musste in diesem Bereich auf dem Aufbau ein zweiter
flacher Aufbau erstellt werden. Bis hier waren die beiden Serien mit den
erwähnten Ausnahmen identisch aufgebaut worden. Bei den jüngeren Maschinen
waren die Aufbauten jedoch schlechter zu erkennen.
Bei den beiden
Führerräumen
gab es den grössten Unterschied. Daher kommen wir nicht darum herum, diese
getrennt anzusehen. Wir beginnen dabei mit der Auslieferung, denn diese
war für die Veränderungen bei der zweiten Hälfte der
Lokomotiven
verantwortlich. Doch nun zu den Kabinen bei den Lokomotiven 201 bis 204,
die um 1930 herum ausgeliefert wurden und daher einen zu dieser Zeit
passenden
Führerstand bekamen. |
|||
|
Führerkabine Be
6/8 Nr. 201 bis 204 |
|||
|
Wir beginnen die Betrachtung
mit dem
Führerstand auf der Lokomotivseite eins. Wobei das hier kaum zu
unterscheiden sein wird und nur einem unscheinbaren Detail zu verdanken
ist. Doch wo ist diese Seite und wie konnte sie erkannt werden? Bei den
ersten vier Maschinen war das eigentlich nur an den Anschriften zu
erkennen. Uns soll daher dieser Aspekt noch nicht so genau interessieren,
denn es geht zuerst um die
Führerkabine.
Die beiden Frontfenster bestanden aus speziellem gehärtetem Glas. Dieses war damals üblich und es konnte mit einer Fensterheizung erwärmt werden. Damit wurde verhindert, dass die Scheiben beschlagen konnten.
Eine Massnahme, die üblich war und
hier für beide Scheiben verwendet wurde. Eine kleine Massnahme, die auch
dem Beimann eine etwas bessere Sicht auf die Strecke bieten konnte. Eine
leichte Besserung gegenüber den älteren Modellen.
Um die Scheiben bei Nässe zu
reinigen, waren
Scheibenwischer montiert worden. Dabei wurde das Modell
auf der Seite des Lokführers mit einem pneumatischen
Antrieb versehen. Der
Beimann musste von Hand dafür sorgen, dass die Scheiben gereinigt wurden.
Eine
Waschanlage, wie sie heute üblich ist, kannte man damals schlicht
noch nicht und daher fehlte sie. Es waren daher die üblichen Fenster
verbaut worden. Zum Schutz vor den Auswirkungen der Sonne, waren die Fenster mit Sonnendächern versehen worden. Diese aus Blech geformten Sonnendächer standen recht weit vor und waren eben mit seitlichen Stabilisationen. Sie waren eine Folge der vom Personal bemängelten älteren Modelle, die diese Sonnendächer nicht bekommen hatten. Speziell war dabei eigentlich nur, dass diese vier Lokomotiven die einzigen damit versehen Modelle der BLS sein sollten.
Um die
Frontwand
abzuschliessen, sehen wir uns den unteren Bereich an. Die Wand, wurde hier
durch einen kleinen Vorbau verdeckt. Dieser
Vorbau wirkte wie eine Kiste,
die vor den
Führerstand hingestellt wurde. Sie war aber Teil des
Führerstandes und somit fest mit der
Lokomotivbrücke
verbunden. Einen
weiteren Nutzen gab es jedoch nicht, da darin keine Bauteile platziert
wurden. Man achte daher auch etwas auf die Optik der
Lokomotive.
Die beiden Eckbereiche waren
nach hinten gezogen worden. Dabei verwendete man einen relativ starken
Winkel nach hinten. Die beiden Seiten waren unterschiedlich. Auf der
rechten Seite wurde nur eine weitere Wand mit einem Fenster im oberen
Bereich verbaut. Die Glasscheibe war identisch zu den
Frontfenstern
aufgebaut worden. Jedoch fehlten hier das
Sonnendach und der
Scheibenwischer. Daher war das Eckfenster sehr gut zu erkennen.
Auf der linken Seite war eine
Einstiegstüre in dieser Eckpartie eingebaut worden. Dabei nahm diese Türe
den ganzen Platz der Eckpartie ein, so dass diese kaum zu erkennen war. In
ihr gab es ein verhältnismässig grosses Fenster ohne
Sonnendach und
Scheibenwischer, das jenem der anderen Seite entsprach. Geöffnet wurde
diese Türe gegen den
Führerraum. Ein Schloss bei der Türfalle erlaubte es
von aussen die Eingangstüre auch abzuschliessen.
Die geöffnete Türe gab den
Weg aus dem
Führerstand frei. So gelangte das Personal auf die vor dem
Führerstand vorhandene
Plattform. Speziell bei dieser Plattform war, dass
sie nur teilweise auf der
Lokomotivbrücke
vorhanden war. Der grösste Teil
davon war jedoch auf dem
Drehgestell, das wir in einem anderen Kapitel
ansehen werden. Ein einfaches auf dem
Drehgestellrahmen montiertes
Geländer diente dem Personal als Absturzsicherung.
Sie waren daher vom Boden aus für klein
gewachsenes Personal nur sehr schwer zu erreichen. Der Aufstieg sollte
daher selten genutzt werden, da es eine Alternative gab. Wenn wir wieder auf die rechte Seite des Führerstandes kommen, treffen wir nun beim Übergang auf die anschliessende Seitenwand auf den einzigen Unterschied der beiden Führerkabinen.
Auf der Seite eins der
Lokomotive wurde in diesem Bereich
eine
Dachleiter eingebaut. Diese konnte vom Personal ausgeklappt werden
und gab so den Weg auf das Dach der Lokomotive frei. Eine
Pfeife warnte
dabei vor einem allenfalls noch gehobenen
Stromabnehmer. Wurde die Leiter ausgeklappt, sorgte das Ventil bei der Pfeife jedoch auch dafür, dass die Stromabnehmer automatisch gesenkt wurden. Die Dachleiter verletzte im ausgeklappten Zustand die Umgrenzung des Fahrzeuges.
Daher durfte sie nur im Stillstand
geöffnet werden. Der Zugang zu dieser Leiter war von der Seitenwand her
möglich. Damit das möglich wurde, war die Seitenwand auf dieser Seite als
Türe ausgeführt worden. Die Seitenwand des Führerstandes war immer noch nicht in der Flucht des Kastens. Es war daher immer noch ein leichter Einzug vorhanden. Erforder-lich war dieser wegen der Länge der fertigen Lokomotive.
So konnte verhindert werden, dass
in engen
Kurven das
Lichtraumprofil von der
Lokomotivbrücke
verletzt
wurde. Doch kommen wir nun zu diesem Ein-stieg, der sonst den anderen
damals eingesetzten Baureihen entsprach.
Auch diese Türe öffnete sich
gegen den
Führerraum hin. Sie hatte ein
Senkfenster erhalten. Diese hatte
einen senkrecht verlaufenden Strich als Kennzeichnung erhalten. Auch hier
wurde der Zugang vom Boden aus über eine Leiter mit zwei seitlichen
Griffstangen ermöglicht. Speziell war, dass diese Leiter nicht senkrecht
ausgerichtet werden konnte. Sie musste unten leicht nach aussen gezogen
werden. So konnte dem
Drehgestell der erforderliche Platz geschaffen
werden.
Wer nun erwartet, dass hier
die beiden
Griffstangen weiter nach unten gezogen wurden, irrt sich. Die
Lokomotive war daher für klein gewachsenes Personal nur schwer zugänglich.
Wer die Griffstange nicht erreichte, hatte auf der Maschine nichts
verloren. Da auch die Leiter nicht so weit nach unten reichte, blieb der
Einstieg eine richtige Kletterpartie. Das
Lokomotivpersonal der BLS musste sich
daher den Zugang zum Arbeitsplatz erkämpfen.
Bleibt uns nur noch die linke
Seite. Hier wurde eine einfache Wand aufgestellt. Im Winkel entsprach sie
der Partie mit der Türe. Auch das hier verbaute Fenster war als
Senkfenster ausgeführt worden. Selbst der in der Schweiz übliche weisse
Strich war hier vorhanden. Sie sehen, dass hier sehr darauf geachtet
wurde, dass die bereits vorhandenen Regeln in Bezug auf die Ausführung der
Seitenfenster bei
Lokomotiven eingehalten wurden.
Die beiden
Führerstände
wurden ebenfalls mit einem Dach abgedeckt. Dieses war zum Dach des
Maschinenraumes identisch gewölbt worden und wurde bei der
Front
leicht
darüber hinaus verlängert. Da das Dach auch seitlich leicht abstehend war,
konnte auf Dachrinnen verzichtet werden, da das Wasser zu Boden tropfte
und nicht der Wand entlanglief. Im Bereich der Rundungen wurden diese
übernommen und im Bereich der Seite zum Dach hin abgezogen.
Wir haben damit aber die
Führerkabinen der Nummern 201 bis 204 kennen gelernt. Sie fielen dabei
durch ihre abgewinkelten Flächen deutlich auf, und genau diese müssen wir
nun aufnehmen. Ob Sie es glauben oder nicht, diese können bei den jüngeren
Modellen als Orientierung genutzt werden. Dabei waren weniger die Flächen
zu beachten. Die Kanten waren jedoch an der gleichen Stelle, nur dass sie
bei den Nummern 205 bis 208 nicht zu erkennen waren.
|
|||
|
Führerkabine Ae
6/8 Nr. 205 bis 208 |
|||
|
Die später als Reihe Ae 6/8
abgelieferten
Lokomotiven mit den Nummern 205 bis 208, hatten einen
komplett anderen
Führerstand erhalten. Dieser führte dazu, dass die
Maschinen komplett anders aussahen. Das war jedoch lediglich eine Folge
des Zeitgeistes, denn mittlerweile waren eher gerundete, als kantige
Formen im Trend. So konnten die beiden Teilserien deutlich unterschieden
werden. Wir müssen nun aber auch diese Kabine ansehen.
Es war nun eine
gerundete Kabine vorhanden. Wenn wir uns die alte Kabine vorstellen, wurde
das ge-bogene Blech jeweils an den Kanten abgelegt. So verschwanden diese
jedoch als Orientierung. Wegen der gerundeten Bauweise wurde der Führer-stand optisch deutlich länger. Sie bildete zudem auf der ganzen Länge auch den Abschluss der Loko-motivbrücke. Die bei den älteren Maschinen noch vorhandene Kiste wurde nun in die Verschalung eingebunden.
Da wir uns in diesem Bereich befinden, beginnen wir die Betrachtung dort.
Wir sehen uns danach, wie bei den älteren Maschinen die beiden Seiten von
der Mitte an. Im Bereich der ursprünglichen Frontwand waren zwei Fenster vorhanden. Diese wurden in der Mitte der Lokomotive durch eine schmale Säule getrennt.
Es kamen hier die neu
erhältlichen
Sicherheitsgläser zur Anwendung. Damit deren Festigkeit
optimiert werden konnte, war eine
Scheibenheizung eingebaut worden. So
wurde auch hier dem Personal der optimale Schutz gewährleistet, was wegen
dem höheren Tempo wichtig war.
Die
Sonnendächer der ersten
Lokomotiven fehlten und beim linken Fenster montierte man einen
Scheibenwischer der oberhalb der Scheibe montiert wurde. Dieser bot dem
Heizer, der als Beimann noch vorhanden war, bei schlechtem Wetter eine
etwas verbesserte Sicht nach vorne und so auf die Strecke. Ein
pneumatischer
Antrieb bewegte das Teil, weil sich bei der manuellen Lösung
der Heizer weit nach vorne beugen musste.
Wenn wir uns zuerst der
linken Seite zuwenden, erkennen wir, dass hier eigentlich gar keine Wand
vorhanden war. Die bei den ersten
Lokomotiven in diesem Bereich eingebaute
Türe war auch hier vorhanden. Da jedoch die Stufe darunter fehlte, trat
das Personal direkt auf dem
Drehgestell der Lokomotive ab. Beim
eigentlichen Aufbau der Türe gab es keinen Unterschied und auch sie wurde
nach innen geöffnet. Jedoch wurde der Aufstieg verändert.
Diese war von beiden Seiten der Lokomotive zugänglich, so dass nun diese Einstiegstüre wirklich von allen Seiten her erreichbar war.
Eine Anpassung, die auf den weiteren Aufbau der
Führer-kabine Auswirkungen haben soll-te. Auch hier gab es zwischen den beiden Führerständen einen kleinen Unterschied.
Die
Dachleiter war auch
hier nur beim
Führerstand eins montiert worden und sie befand sich neben
der Türe. Vom Aufbau her entsprach diese Leiter jedoch den anderen
Modellen, so dass auch hier das
Ventil und die
Pfeife vorhanden war. Neu
war nur, dass nun das
Lichtraumprofil nicht verletzt wurde. Da jedoch die
Stromabnehmer gesenkt wurden, konnte auch jetzt nicht gefahren werden.
Bei der rechten Ecke, die
hier natürlich nicht zu erkennen war, kam ein grosses Fenster mit
Scheibenwischer zum Einbau. Dadurch hatte der Lokführer, auch dank der
schmalen Säule zur
Front
hin, eine bessere Sicht auf die Strecke. Dabei
folgte die Scheibe dem Radius der Frontpartie, so dass hier eine leicht
gebogene Scheibe eingebaut werden musste. Sie bestand ebenfalls aus
Sicherheitsglas, das beheizt werden konnte.
Die beiden seitlichen
Bereiche des
Führerstandes waren nun identisch. Somit gab es hier keinen
Einstieg mehr und die
Führerkabine verfügte nur über eine Türe. Die
Seitenwände hatten breite und somit überraschend grosse Fenster erhalten.
Sie waren ebenfalls als
Senkfenster ausgeführt worden und konnten daher
geöffnet werden. Jedoch verzichtete man hier auf das anbringen des weissen
Striches zur Kennzeichnung.
Bei den Modellen der Reihe Ae
6/8 verwendete man eine gerade Dachkante und zog die Dachrinne und das
Dach des
Maschinenraumes auch im Bereich der
Führerstände weiter. Optisch
hatte das bei der
Front
zur Folge, dass man nicht so leicht erkennen konnte, dass das
Dach des Maschinenraumes zur Reihe Be 6/8 identisch war. Sie sehen, wie
stark die
Führerkabine die optische Wahrnehmung verändern kann. Die hier
vorgestellte
Lokomotive war dafür ein gutes Beispiel.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
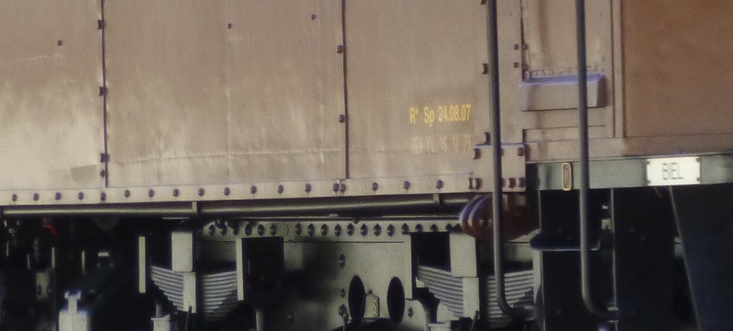 Der
auf dieser
Der
auf dieser
 Die beiden unteren seitlichen
Segmente bei den Nummern 205 bis 208 hatten in ihrer Mitte ein längliches
Die beiden unteren seitlichen
Segmente bei den Nummern 205 bis 208 hatten in ihrer Mitte ein längliches
 Diese vier Segmente
verteilten sich bei den Nummern 201 bis 204 jedoch gleichmässig auf die
ganze Länge der Seitenwand. Bei den Nummern 205 bis 208 wurde jedoch auf
das mittlere Nietenband verzichtet.
Diese vier Segmente
verteilten sich bei den Nummern 201 bis 204 jedoch gleichmässig auf die
ganze Länge der Seitenwand. Bei den Nummern 205 bis 208 wurde jedoch auf
das mittlere Nietenband verzichtet.
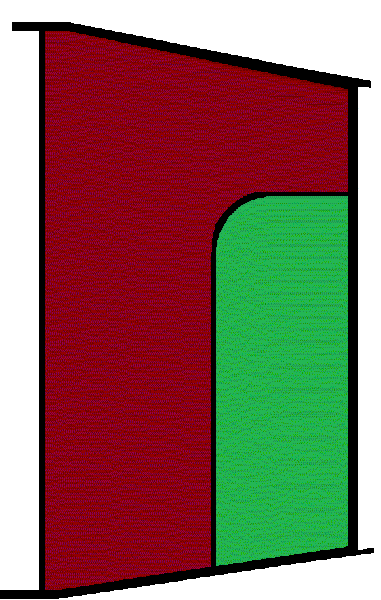 Der
Der
 An der linken Seite der
An der linken Seite der
 Die gesamte
Die gesamte  Dieser war hier nicht mehr an
der
Dieser war hier nicht mehr an
der