|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Das
Fahrwerk
der
Lokomotive bestand aus zwei
Drehgestellen. Diese waren identisch aufgebaut
worden und sie wurden Rücken an Rücken zueinander eingebaut. Wir können
uns daher auf ein Drehgestell konzentrieren, denn auch so gab es innerhalb
dieser Serie grosse Unterschiede. Doch beginnen wir vorerst mit dem Aufbau
eines Drehgestells. Die Abweichungen werden dann dort erwähnt, wo sie auch
vorhanden waren.
Um die einzelnen Teile miteinander zu verbinden, wurden Nieten
verwendet. Obwohl beim Bau der zweiten Serie erste erfolgreiche
Anwendungen der SSchweisstechnik
vorhanden waren, wurden auch deren Rahmen mit Nieten verbunden. Dieser Plattenrahmen war wegen dem eingebauten Ant-rieb als aussenliegender Rahmen ausgeführt worden. Grundsätzlich erlaubten aussenliegende Rahmen einen seitlich stabileren Stand der Lokomotive, da die Lager weiter voneinander entfernt waren.
Das wirkte sich positiv auf die Wankneigung der Maschine und die
Wartung der
Lager
aus. Hätte man hier jedoch einen
Stangenantrieb
verbaut, wäre diese Lösung schlicht nicht möglich gewesen.
Gegen die Aussenseite der
Lokomotive hin verjüngte sich der
Drehgestellrahmen
um damit der darunter befindlichen
Laufachse
den notwendigen Platz zu schaffen. Am Ende dieses
Drehgestells
wurde dann der eigentliche
Stossbalken
der Lokomotive montiert. Dabei stand das Drehgestell mit dem Stossbalken
deutlich über den Kasten hinaus. Das ermöglichte es daher, auf dem
Drehgestell eine kleine
Plattform
für das Personal einzurichten.
Bei der
Plattform
gab es zwischen den Maschinen Unterschiede. So wurde bei den Nummern 201
bis 204 ein Geländer um diese Fläche aufgebaut. Dieses Geländer war jedoch
im Bereich des
Stossbalkens
geöffnet worden. Die oberen Holme wurden jedoch nach vorne abgebogen und
bildeten so zwei Handgriffe. Diese waren als Ergänzung für das hier am
Rahmen des
Drehgestells
montierte
Übergangsblech
gedacht.
Das führte dazu, dass man den Bereich bei den später abgelieferten
Nummern 205 bis 208 änderte. Hier wurde nur noch das
Übergangsblech
montiert. Auf ein Geländer und Handgriffe verzichtete man jedoch. Hier waren nur die seitlichen Aufstiege zur Lokomotive mit den beiden Griffstangen vorhanden. Da diese nun aber auf beiden Seiten montiert wurden, konnte die Plattform beidseitig vom Boden her erreicht werden.
Da die
Griffstangen
nun auch deutlich weiter nach unten verlängert wurden, war es für kleiner
gewachsene Leute beim
Lokomotivpersonal
leichter möglich, die
Plattform
zu erreichen. Das erlaubte letztlich den Verzicht auf den seitlichen
Einstieg. Da kein Geländer als Absturzsicherung vorhanden war und weil der Führerstand weiter nach vorne reichte, war es auf der schmalen Plattform nicht so leicht durchzugehen.
Damit man sich trotzdem zur Sicherheit festhalten konnte, wurde an
der
Front
eine waagerecht montierte
Griffstange
montiert. Eine Begehung während der Fahrt war jedoch nicht mehr vorgesehen
worden. So war das
Übergangsblech
eigentlich nutzlos.
Mittig im
Stossbalken
wurde der
Zughaken
eingebaut. Dieser war so im Rahmen eingebaut worden, dass er sich gegen
die Kraft einer
Feder
nach vorne bewegen konnte. Gegenüber den älteren Modellen wurde hier
jedoch ein neuartiger Stahl verwendet. Dieser neigte nicht mehr so leicht
zu Brüchen. Daher konnte bei diesen Maschinen die erlaubte
Zughakenlast
auf die neuen Werte von 510 Tonnen gesteigert werden.
Dabei ist der Begriff etwas verwirrend, denn die am
Zughaken
montierte
Kupplung
war für die Beschränkung der Lasten massgebend. Diese wurde nach den
Normen der
UIC
aufgebaut. Dabei war jedoch nur noch die
Schraubenkupplung
vorhanden. Die bisher noch verwendete
Notkupplung
wurde nicht mehr vorgesehen, da deren Nutzen nicht mehr gegeben war, denn
im Notfall wurde einfach die Kupplung des anderen Fahrzeuges benutzt.
Bei den Modellen gab es jedoch gegenüber den bei der BLS
vorhandenen Baureihen eine Änderung. Anstelle der bisher verwendeten
Stangenpuffer
kamen die kräftigeren und daher besser geeigneten
Hülsenpuffer
zur An-wendung. Diese Stossvorrichtungen wurden mit runden Puffertellern versehen. Diese waren jedoch unterschiedlich ausgeführt worden. Beim rechten Puffer wurde eine gewölbte Lösung verwendet. Auf der anderen Seite kamen jedoch, wie bei allen anderen Fahrzeugen, flache Pufferteller zur Montage.
Eine erwartete Vereinfachung der Vorhaltung von Ersatzpuffern
wurde daher nicht umgesetzt. Noch traf daher immer ein gewölbtes auf ein
flaches Modell. Während wir bei den Nummern 201 bis 204 den Stossbalken abschliessen können, ist das bei den höheren Nummern nicht mehr möglich. Die Loko-motiven der Baureihe Ae 6/8 hatten unter dem Stossbalken einen Bahnräumer erhalten.
Diesen hatte die BLS gefordert, weil man so weniger Probleme mit
dem Schnee erhoffte. Daher müssen wir uns diesen
Bahnräumer
nun ansehen. Die Lösung der älteren Modelle lernen wir später kennen.
Mit den neuen
Bahnräumern
sollte verhindert werden, dass sich Schnee im
Fahrwerk
ablagern konnte. Damit dieser auch besser zur Seite hin abgelenkt werden
konnte, wurde eine sehr spitz ausgeführte Lösung verwendet. Zudem war das
Blech so geformt worden, dass der Schnee leichter abfliessen konnte. Zudem
war dank dem massiven Blech das Fahrwerk auch bei diesen
Lokomotiven ausgesprochen gut geschützt worden.
Aus diesem Grund wurden die beiden
Drehgestellrahmen
mit einer
Kurzkupplung
als
Zugvorricht-ung
miteinander verbunden. Diese
Kupplung
war so ausgelegt worden, dass sie die Zug- und
Stosskräfte
übertragen konnte. Die Kurzkupplung bestand aus zwei gefederten Pufferplatten, die für die Übertragung der Stoss-kräfte verwendet wurden. Die Zugkräfte wurden jedoch mit einer einfachen Zugstange über-tragen.
Diese Konstruktion erlaubte es, die nicht lösbare
Kupplung
spielfrei auszuführen. Trotzdem war diese
Kurzkupplung
aber in allen Bewegungen frei und erlaubte es den beiden
Drehgestellen, sich in alle Richtungen unabhängig zu
bewegen.
Mit den nun verbundenen
Drehgestellen können wir die Länge der
Lokomotive bestimmen. Diese wurde bei allen acht
Lokomotiven mit 20 260 mm angegeben. Im Vergleich mit der Baureihe
Ce 6/8 II,
die eine Länge von knapp 20 Meter hatte, war das Modell der BLS ein wenig
länger geworden. Somit wurde diese Baureihe zur längsten einteiligen
Lokomotive der Schweiz. Lediglich die Doppellokomotiven der Reihe Ae 8/14
waren damals noch länger. Direkt im Drehgestellrahmen wurden die Triebachsen eingebaut. Dabei gab es bei der Verteilung der drei Achsen leichte Unterschiede. Zwischen der ersten und der zweiten Triebachse betrug der Abstand 2 200 mm.
Zur dritten
Achse
hin wurde dieser Wert um 300 mm gekürzt und betrug daher noch 1 900 mm.
Eine Massnahme, die nicht durch den
Antrieb
bedingt war, sondern ausgeglichene
Achslasten
erlaubten sollte.
Bei den
Triebachsen
wurde eine
Achslast
von 19 Tonnen angegeben. Hochgerechnet auf die sechs Triebachsen ergab das
ein
Adhäsionsgewicht
von 115 Tonnen. Das war ein Reibungsgewicht, das in der Schweiz bis heute
nur noch von den gigantischen Doppellokomotiven übertroffen werden sollte.
So kann bereits jetzt erkannt werden, wie gross diese Baureihe effektiv
geworden war. Das Gesamtgicht wurde daher mit stolzen 142 Tonnen
angegeben.
Die eigentliche
Achse
bestand aus geschmiedetem Stahl. Die Welle wurde mit den Auflagen für die
beiden
Räder
und die Bauteile des
Antriebes
versehen. Bei den
Lagern
gab es hier jedoch grosse Unterschiede. Die waren so gross, dass wir nicht
einmal die Reihen Be 6/8 und Ae 6/8 unterscheiden können. Wir müssen
wirklich nahezu jede Nummer einzeln ansehen. Dabei war der grundlegende
Aufbau des
Achslagers
noch verhältnismässig einfach.
Es kamen bei den älteren Maschinen mit den Nummern 201 bis 204 die
damals üblichen
Gleitlager
zur Anwendung. Die Achswelle lief dabei in
Lagerschalen
aus
Weissmetall.
Um diese zu kühlen und um die Reibung zu verringern, wurde eine
Schmierung
mit
Öl
vorgesehen. Um das
Schmiermittel
korrekt auf die Achswelle zu übertragen, wurde ein Polsterschmierung
verwendet. Diese war damals bei solchen
Achslagern
durchaus üblich.
Spannend wird es bei diesen vier
Lokomotiven, wenn wir zu den Abdeckungen der
Achslager
kommen. Diese Deckel wurden bisher in der Schweiz mit einem roten Kreuz
versehen. Bei den
Privatbahnen
kamen jedoch in den meisten Fällen einfache Deckel ohne Muster zur
Anwendung. Die grosse Ausnahme sollte die Reihe Be 6/8 darstellen. Daher
müssen wir, ob es uns nun gefällt, diese Deckel etwas genauer ansehen,
denn es lohnt sich.
Auf den Deckeln dieser beiden
Lokomotiven wurde mittig der Schriftzug BLS angebracht.
Dieser verlief in Längsrichtung und war daher gut lesbar, auch wenn er
farblich nicht abgegrenzt wurde. Die Lagerdeckel wurden bereits bei den Lokomotiven mit den Nummern 203 und 204 verändert. Auch sie wurden, wie ihre Vorgänger, senkrecht montiert und mit acht im Kreis angeordneten Schrauben befestigt.
Auf dem Deckel kam mittig ein Kreuz, das für die Schweiz stehen
sollte, zur Anwendung. Im
Kreis
um das Kreuz herum wurde dann noch der Schriftzug BERN LOETSCHBERG SIMPLON
angebracht. Die Schrift und das Kreuz wurden nun farblich abgegrenzt
gestaltet worden.
Bei den
Lokomotiven der Baureihe Ae 6/8 kamen neu entwickelte
Gleitlager
der Marke Friedmann zur Anwendung. Auch sie wurden mit
Öl
geschmiert, besassen aber eine Umlaufschmierung. Damit konnte die Wartung
der Gleitlager gegenüber der Polsterschmierung etwas vereinfacht werden.
Die Interwalle der Kontrollen mussten nicht mehr so oft erfolgen. Damit
konnten diese
Lokomotiven etwas längere Strecken ohne Halt
zurücklegen.
Diese
Gleitlager
hatten schräg montierte und leicht gewölbte Lagerdeckel erhalten. Montiert
wurden diese Achslagerdeckel mit nur noch vier Schrauben. Neben dem
Schriftzug BLS war auch hier das Kreuz für die Schweiz vorhanden. Jedoch
war das Kreuz viel kleiner geworden. Es entsprach in der Grösse ungefähr
dem Schriftzug. Man könnte fast vermuten, dass diese Lösung für vier
Maschinen ein Kompromiss der vorherigen Achslagerdeckel war.
Die mit
Fett
geschmierten seitlichen Führungen der
Achslager
fixierten dieses nur in Längsrichtung und bestimmten so die Position der
Triebachse.
Um den Kurvenlauf zu verbessern wurde die mittlere
Achse
mit einem seitlichen Spiel versehen. Somit bestimmten die beiden anderen
Triebachsen den festen Radstand der
Lokomotive. Dieser wurde mit 4 100 mm angegeben. Zum
Vergleich lag dieser bei der Reihe
Ce 6/8 III bei
4 700 mm.
Interessant, ist aber die
Verbindung
mit dem einge-bauten
Antrieb.
Obwohl die hier verwendete Lösung nahezu jener der Baureihe
Be 4/7
der
Staatsbahnen
entsprach, waren die
Räder
deutlich kleiner. Gefedert wurden die Triebachsen mit längs und hoch montierten Blattfedern. Diese waren wegen dem Aus-senrahmen des Drehgestells gut zu erkennen. Die Feder war am Drehgestellrahmen montiert worden.
Die Abstützung gegenüber dem
Drehgestell
erfolgte von den Federenden auf unterhalb montierte Halte-blöcke. Somit
wurde der Rahmen grundsätzlich an den
Achslagern
aufgehängt. Es entstand so eine ruhi-ge
Federung.
Diese Form der
Federung
war wegen der trägen Schwingungsdauer und der grossen Eigendämpfung der
Blattfedern
sehr oft verwendet worden. Damit die
Achslasten
auch beim Befahren von
Kuppen
oder
Senken eingehalten wurden, mussten die
Federn
mit Ausgleichshebeln verbunden werden. Diese Balanciers waren jedoch nur
schlecht zu erkennen, da sie verdeckt wurden. Die Hebel bewirkten, dass
die erste
Achse,
die entlastet wurde, die zweite Achse in ihrer Feder anhob.
Um die Laufruhe der
Drehgestelle
und somit der
Lokomotive zu verbessern, wurde eine
Laufachse
vorgesehen. Diese wurde als führende
Achse
vorgesehen und daher gegen die äussere Seite der Lokomotive montiert.
Dabei wurde die Laufachse mit einer Deichsel bei der ersten
Triebachse
am
Drehgestellrahmen
befestigt. Dieser Aufbau einer Laufachse ist als
Bissellaufachse
weitherum bekannt und er wurde schon bei der Baureihe
Be 5/7 verwendet.
So wurde deren Laufruhe auch bei höheren Geschwindigkeiten
ermög-licht. Die
Lokomotive erhielt dadurch einen sehr ruhigen Lauf über
den gesamten Bereich der Geschwindigkeit. Die fertige Lokomotive hatte
somit die
Achsfolge
(1’Co) (Co’1) erhalten.
Die
Laufachse
selber lagerte in
Gleitlagern.
Wie bei solchen
Achsen
üblich, kamen innen liegende
Lager
zur Anwendung. Bei allen
Loko-motiven kamen die normalen
Lagerschalen
aus
Weissmetall
zum Einbau. Sie wurden mit einer Polsterschmierung versehen. Dabei wurde
der Vorrat des
Öls
bei den Lagern mitgeführt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass das
Schmiermittel
bei den Laufachsen nicht so oft nachgefüllt werden musste.
Bei den
Rädern
der
Laufachse,
war man nicht auf bestimmende Bauteile angewiesen. Daher verwendete man
auch bei dieser
Achse
die gleichen Räder, wie es sie schon bei der Baureihe
Be 5/7 gab. Das bedeutete, dass der Durchmesser
der
Speichenräder
bei 960 mm lag. Belastet wurde jede Laufachse mit 13.5 Tonnen. Üblich
waren hier Werte von 13 Tonnen, so dass die Lokomotive auf den Laufachsen
einen etwas zu hohen
Achsdruck
hatte.
Zum Schutz des
Fahrwerkes
wurden bei den älteren Maschinen nach der Baureihe Be 6/8 an der Deichsel
Schienenräumer
montiert. Diese bestanden aus dem üblichen vor der
Laufachse
angeordneten Blech mit der verbindenden Querstange. Die Aufgabe war klar,
denn der Schienenräumer sollte Gegenstände auf den
Schienen
abweisen und so die Laufachse davor schützen. Eine Lösung, die sich schon
seit Jahren bei
Lokomotiven bewährt hatte.
Wir haben damit das
Laufwerk
fertig aufgebaut. Es wird Zeit, dass wir dieses unter dem Kasten
platzieren. Da die
Lokomotivbrücke
keine
Zugkräfte
übertragen konnte, musste eine spezielle Lösung verwendet werden. Weil die
Kurzkupplung
kein Spiel hatte, musste dieses bei der Abstützung des Kastens vorgesehen
werden. Daher lohnt sich ein genauer Blick darauf. So stützte sich der
Kasten über geschmierte Gleitplatten auf den beiden
Drehgestellen
ab.
Um den Kasten zu positionieren, wurden einfache
Drehzapfen
verwendet. Dieser wurde zwischen der ersten und zweiten
Triebachse
eingebaut. Der dazu benötigte Platz führte dazu, dass die Triebachsen
nicht einheitlich verteilt werden konnten. Dabei wurde das
Lager
des zweiten
Drehgestells
mit einem Längsspiel von +/- 10 mm versehen. So war gesichert, dass die
Zugkräfte
über die
Kurzkupplung
und nicht über den Kasten übertragen wurden.
Dieser war jedoch keine komplette Neuentwicklung, sondern es
handelte sich um eine verbesserte Version des bei den Reihen
Be 4/7, Ae 3/5
und Ae 3/6 III der Schweizerischen Bundebahnen SBB verwendeten
Westinghouseantriebes.
Es sollten so Verbesserungen erreicht werden. Dabei konnte der komplizierte Aufbau des Westinghouseantriebs etwas ver-einfacht werden. Geblieben war bei der neuen Version jedoch, dass jede Triebachse von zwei Fahrmotoren angetrieben wurde.
Deren
Drehmoment
wurde von den Ritzeln auf ein gemeinsames
Zahnrad
über-tragen. Dabei war dieses
Getriebe,
wie die Motoren fest im
Drehgestell-rahmen
eingebaut worden. Das hatte Auswirkungen auf den benötigten
Ge-triebekasten. Wir können den Getriebekasten als ein Gehäuse um das Getriebe sehen. Dieses besass an der tiefsten Stelle eine Ölwanne. In dieser lagerte das Schmiermittel. Da das Zahnrad durch dieses lief, nahmen die Zähne das Öl auf und verteilten es so auf die Ritzel.
Die Fliehkraft sorgte dafür, dass sich das
Schmiermittel
im gesamten Gehäuse verteilte. So wurden sämtliche in diesem
Getriebekasten verbauten Bauteile optimal mit
Öl
geschmiert.
Das
Getriebe
der Reihe Be 6/8 hatte eine
Übersetzung
von
1 :
5.866 erhalten und war mit schräg verzahnten
Zahnrädern
versehen. bei der Baureihe Ae 6/8 änderte man diese Übersetzung auf
1:5.312. Damit konnten diese
Lokomo-tiven
etwas schneller fahren, als die älteren Modelle. Bei der
Zugkraft
war jedoch ein kleiner Verlust vorhanden, der aber durch die grössere
Leistung
der hier verbauten
Fahrmotoren
ausgeglichen werden konnte.
Wie beim
Westinghouseantrieb
lagerte das
Zahnrad
auf einer Hohlwelle, die um die
Triebachse
herum eingebaut wurde. Es war bis hier bei der Lösung der SAAS kein
erkennbarer Unterschied zum Muster nach
Westinghouse
vorhanden. Die Verbesserungen wurden an der Stelle vorgenommen, wo das
Drehmoment
vom
Antrieb
auf die
Achse
übertragen werden musste. Dabei war jedoch auch hier ein Mitnehmerstern
vorhanden, der zwischen die Speichen der
Räder
griff.
Der Vorteil bei der Lösung von Sécheron lag darin, dass hier wesentlich weniger Federtöpfe verbaut werden mussten.
Dadurch konnten diese kräftiger ausgeführt werden, was dazu führen
sollte, dass es seltener zu Brüchen der
Federn
kommen sollte. Die erwähnte Verbes-serung war daher hier zu finden. Das so auf die Triebachse übertragene Drehmoment wurde mit Hilfe der Haftreibung zwischen Lauffläche und Schiene in Zugkraft umgewandelt. Diese Zugkraft wurde über die Lagerführungen auf die Drehgestelle übertragen.
Von dort gelangten die
Zugkräfte
schliesslich auf die
Zugvorrichtungen.
Es waren daher in diesem Punkt dieselben physikalischen Grundsätze
vorhanden und das konnte bei der Erhöhung der Zugkraft zu Pro-blemen
führen. Um die Übertragung der erzeugten Zugkraft auch bei schlechtem Schienenzustand zu verbessern, wurden bei der Lokomotive Sandstreueinrichtungen einge-baut. Dabei wurde bei der Baureihe Be 6/8 vor jedes Triebrad der in einem Behälter am Drehgestell mit-geführte Quarzsand gestreut.
Der Behälter sorgte dafür, dass die Ausgleichshebel der
Federung
bei diesen vier
Lokomotiven nicht mehr zu erkennen waren.
Bei den Reihe Ae 6/8 wurde die Anzahl dieser
Sandstreueinrichtungen
massiv reduziert. Hier war nur noch die erste vorlaufende
Triebachse
mit einem
Sander
versehen worden. Diese Vereinfachung konnte erfolgen, weil man bei den
ersten Maschinen bemerkt hatte, dass ein gutes
Adhäsionsverhalten
vorhanden war. Durch die Reduktion verschlechterte sich die Ausnützung der
Zugkraft
nur unwesentlich, reduzierte jedoch den Verbrauch von Sand massiv.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Für
den
Für
den  Daher
war es bei der Baureihe Be 6/8 möglich, von einem
Daher
war es bei der Baureihe Be 6/8 möglich, von einem
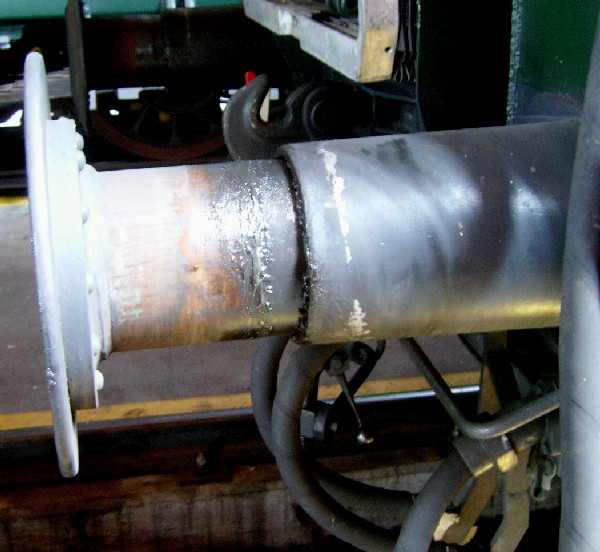 Weil
die
Weil
die
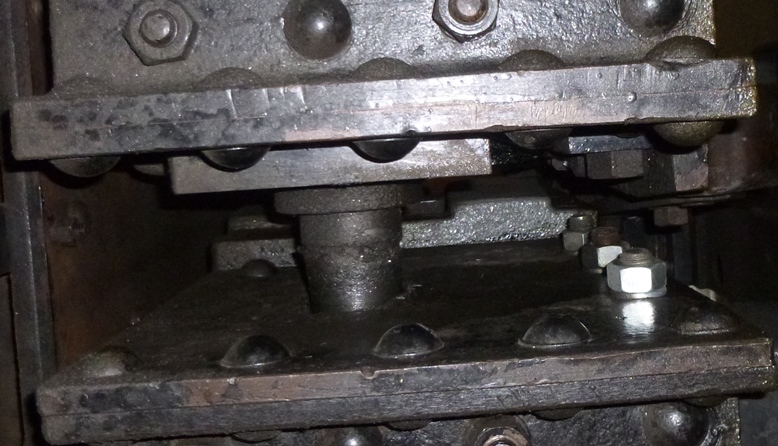 Bevor
wir zum Einbau der
Bevor
wir zum Einbau der 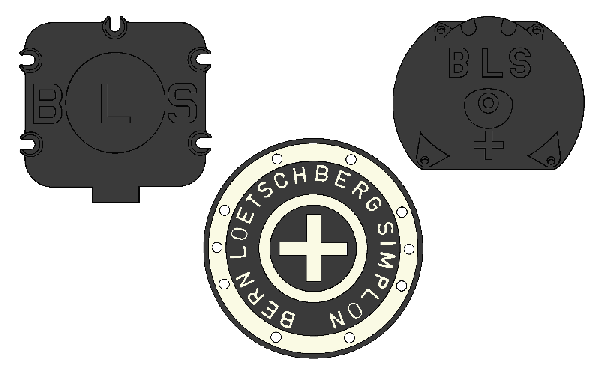 Bei
den
Bei
den  Auf
den
Auf
den 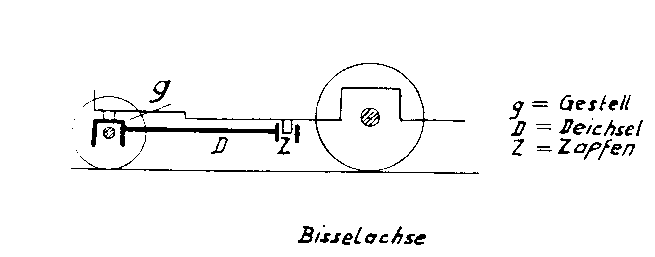 Die
Deichsel wurde mit
Die
Deichsel wurde mit
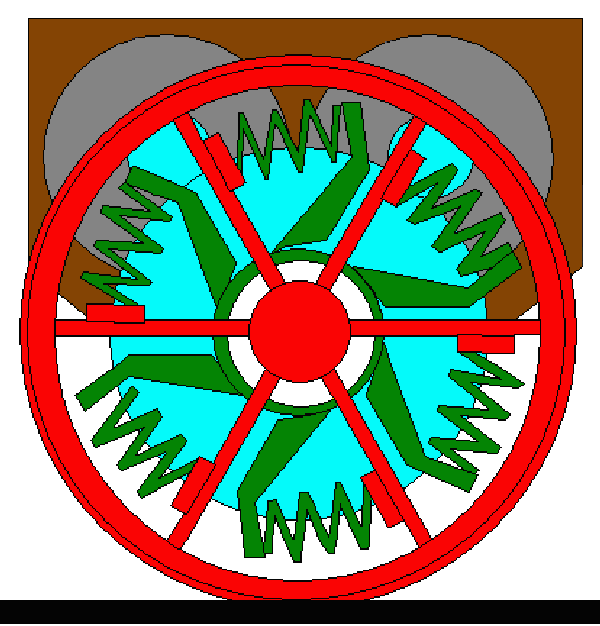 Um
diese
Um
diese  Der
Mitnehmerstern war gegenüber den Speichen des
Der
Mitnehmerstern war gegenüber den Speichen des