|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Auf der
Lokomotive
wurde für die
Bremsen und weitere pneumatisch betriebene
Apparate
Druckluft
benötigt. Für diese Druckluft wurde im
Maschinenraum
ein mit einem elektrischen Motor angetriebenen
Kompressor
montiert. Es kam dabei ein zweistufiger Rotationskompressor des Typs KLL
18 zur Anwendung. Dieser verfügte über eine maximale Förderleistung von
2 700 Litern pro Minute und war daher sehr leistungsfähig.
Auch jetzt folgten wieder ein
Wasserabscheider
und ein
Kühler.
Damit konnte vom
Kompressor
verhältnismässig trockene
Druckluft
erzeugt werden. Ein Ölabscheider verhinderte zudem, dass allenfalls in der
Luft enthaltenes
Öl
in den Leitungen verteilt wurde. Ein unmittelbar nach dem Kompressor eingebautes Über-druckventil beschränkte den Druck in der Leitung auf einen Wert von maximal 8.5 bar. Damit war gesichert, dass das Ventil nur geöffnet wurde, wenn der Druck in der Leitung jenen des Kompressors überstieg.
Ein zusätzliches Rückschlagventil verhinderte, dass zu ho-her
Druck im System zum
Kompressor
und zum Über-druckventil gelangen konnte. Es wurde so verhindert, dass ein
Defekt am Kompressor das System entleerte. Die so erzeugte Druckluft gelangte schliesslich zu den Hauptluftbehältern. Diese speicherten den Vorrat. Dadurch musste der Kompressor nicht dauernd arbeiten und es stand immer genug Druckluft bereit.
Dank den in den Leitungen vorhandenen
Absperrhähne
war es möglich die
Druckluft
in den Behältern einzusperren und so für längere Zeit zu speichern. Der
Grund dafür fand sich in der Tatsache, dass die
Lokomotive
ohne Druckluft nicht eingeschaltet werden konnte.
Von den
Hauptluftbehältern
gelangte die
Druckluft
in eine Leitung, die
Speiseleitung
genannt wurde. Diese Leitung wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt und stand dort jeweils in zwei
Luftschläuchen
mit
Absperrhahn
und weissen
Kupplungen
zur Verfügung. Es war daher möglich, die fehlende Druckluft der
Lokomotive
über diese Leitung einzuspeisen, was eine Inbetriebnahme ohne Druckluft
deutlich einfacher gestaltete.
Benötigt wurde die
Speiseleitung
wegen der eingebauten
Vielfachsteuerung
auch ausserhalb der
Lokomotive.
Bei der Ablieferung war die Baureihe Ae 4/6 die einzige Lokomotive im
Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die eine solche Leitung
besass und diese an den beiden
Stossbalken
zur Verfügung stellte. Die Leitung wurde auch später nur so ausgeführt,
wenn das Fahrzeug über eine Vielfachsteuerung verfügte.
Da der Druck in der
Speiseleitung
von jenem in den
Hauptluftbehältern
abhängig war, veränderte sich der Wert zwischen 6.5 und 8
bar.
Sie stand vielen Verbrauchern der
Lokomotive
zur Verfügung und war daher eine wichtige Leitung. Neben den
Bremsen
waren diese Verbraucher bei den
Sandern
und bei der mit
Druckluft
betriebenen
Pfeife
zu finden. Es wurde hier eine
Lokpfeife
mit den üblichen Klängen eingebaut.
Jedoch benötigten einige Funktionen der elektrischen Ausrüstung
einen stabilen Druck. Daher wurde über ein Reduzierventil die
Apparateleitung
mit einem Druck von sechs
bar
und eigenem Vorratsbehälter ange-schlossen. Auch diese Leitung war
eigentlich nicht neu und es wurden mit einer Ausnahme die üblichen
Verbraucher angeschlossen. Die Ausnahme bildete der bei den Maschinen mit
den Nummern 10 807 bis 10 812 eingebaute
Adhäsionsvermehrer.
Soweit entsprach das System der
Druckluft
mit Ausnahme der Leitungen an den
Stossbalken
den Maschinen der Baureihe
Ae 8/14. Man konnte daher
auf diese Ersatzteile zurückgreifen, was die Vorhaltung von speziellen
Bauteilen verringerte. Gerade die grossen und schweren
Kompressoren
der
Lokomotiven
waren dabei sehr wichtig, da sie viel Platz wegnahmen. Für einen Wechsel
des Kompressors musste jedoch das Dach abgehoben werden.
Damit kommen wir zum wichtigsten Verbraucher der
Druckluft.
Die pneumatischen
Bremsen
der
Lokomotive
wurden direkt an der
Speiseleitung
angeschlossen und so mit genügend Druckluft versorgt. Es wurden dabei auf
der Maschine drei unabhängig voneinander arbeitende
Druckluftbremsen
eingebaut. Diese mussten jedoch wegen der hohen
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h teilweise neu ausgelegt und verbessert werden.
Verändert werden konnte dieser Druck jedoch nicht. Der Vorteil
dieser
Schleuderbremse
war jedoch, dass sie ausgesprochen schnell wirkte und so der ge-wünschte
Effekt schnell eintrat. Damit konnte zwar nur eine leichte Bremswirkung aufgebaut werden, jedoch reichte diese aus um eine durchdrehende Triebachse abzufangen. Speziell war, dass diese Bremse auch auf der ferngesteuerten Maschine funktionierte.
Durch die Steuerung wurde diese
Schleuderbremse
jedoch so blockiert, dass diese bei einer Bremsung mit der
elektrischen
Bremse nicht angewendet wer-den konnte. So war gesichert,
das nicht zu stark ge-bremst wurde. Etwas komplizierter aufgebaut war die direkt wirk-ende Regulierbremse. Diese wurde mit dem ent-sprechenden Regulierbremsventil von Westinghouse beeinflusst.
Durch das
Ventil
wurde in die
Regulierleitung
mehr oder weniger
Druckluft
eingelassen und so eine Bremsung erzeugt. Dabei konnte ein maximaler Druck
von 3.9
bar
in den
Bremszylindern
erzeugt werden. Dabei galt das sowohl für die Trieb- als auch für die
beiden
Laufachsen.
Gebremste
Laufachsen
waren damals in der Schweiz noch nicht üblich, denn man sah den Nutzen
einer
Bremse
an diesen
Achsen
nicht als gegeben. Jedoch wurden schon die drei grossen
Ae 8/14 mit gebremsten
Laufachsen in den
Java-Drehgestellen versehen. Daher verwunderte es nicht, dass auch
bei der Baureihe Ae 4/6 auf diese Bremse gesetzt wurde. Damit konnte die
Regulierbremse
jedoch erstmals alle Achsen der
Lokomotive
bremsen.
So konnte man bei dieser Leitung auf
Absperrhähne
verzichten. Zur Kennzeichnung wurde der Kopf der
Kupplung
mit roter Farbe gekennzeichnet. Eine An-passung an die restlichen
Fahrzeuge der damaligen Zeit. Benötigt wurde die Regulierbremse bei entsprechend ausgerüsteten Zügen auf langen Talfahrten und im Rangierdienst. Jedoch gab es bei der Baureihe Ae 4/6 noch die Lokomotive in Vielfachsteuerung, die grund-sätzlich immer an der Regulierbremse angeschlossen wurde.
Jedoch konnte sich die
Kupplung
der
Regulierleitung
lösen und dann war das angehängte Fahrzeug, bezieh-ungsweise der Zug,
nicht mehr von der Spitze aus regulierbar. Daher musste noch eine
Sicherheitsbremse eingebaut werden. Da die Lokomotive für eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h gebaut wurde, war der Ausgestaltung der dritten pneumatischen Bremse besondere Sorgfalt ver-langt.
Diese indirekt wirkende
Bremse
wurde als
automa-tischen Bremse
bezeichnet und sie galt wegen dem Aufbau mit einer
Hauptleitung
als Sicherheitsbremse. Daher musste sie die
Lokomotive
auch aus 125 km/h ausreichend abbremsen können. Das war mit den bisherigen
Lösungen schlicht nicht möglich.
An der
Hauptleitung,
die mit fünf
bar
gefüllt wurde, konnte man nichts verändern. Auch sie wurde zu den
Stossbalken
geführt und stand in jeweils zwei
Luftschläuchen
mit
Absperrhahn
zu Verfügung. Dabei wurden die Schläuche der
Hauptleitung
zwischen der Steuer- und der
Regulierleitung
angeordnet und rot eingefärbt. Wir haben damit nicht weniger als sechs
Druckluftleitungen. Bei einer
Doppeltraktion
mussten davon die drei Stück einer Seite gekuppelt werden.
Das Ventil von Typ Lst 1 war dabei mehrlösig ausgeführt worden und ver-fügte über eine neuartige als R-Bremse bezeichnete Stufe.
Es handelte sich daher um eine Hoch-leistungsbremse, die etwas
genauer betrachtet werden muss. Im normalen Betrieb arbeitete das Steuerventil Lst 1 mit der normalen P-Bremse.
Damit konnte in den
Bremszylindern
ein maximaler Druck von 3.9
bar
er-zeugt werden. Die
automatische Bremse
hatte in dieser Stellung die gleiche
Bremskraft
zur Folge, wie das bei der
Regulierbremse
der Fall war. Ein Punkt, der später bei der Berechnung der
Bremsen
noch wichtig werden wird, denn bisher gab es keinen Unterschied zu anderen
Baureihen.
Fuhr die
Lokomotive
jedoch schneller als 60 km/h wurde die
R-Bremse
zugeschaltet. Damit wurde der Druck in den
Bremszylindern
zusätzlich erhöht und erreichte in den
Laufachsen
einen Druck von maximal sechs
bar.
Bei den
Triebachsen
wurden hingegen bis zu 6.8 bar erzeugt. Der Unterschied beim Druck, war
der geringeren
Achslast
der Laufachsen geschuldet, denn bei vergleichbarem Druck hätten diese
blockiert.
Da in der
Hauptleitung
jedoch nur ein Druck von maximal fünf
bar
vorhanden war, wurde der höherer Druck über einen Anschluss der
Speiseleitung
zur Verfügung gestellt. Daher musste dieses
Steuerventil
nicht nur an der Hauptleitung, sondern auch an der Speiseleitung
angeschlossen werden. Das erfolgte mit einer Einrichtung, die den höheren
Druck anhand der Absenkung in der Leitung der
automatischen Bremse
regelte.
Es war daher weiterhin möglich, bei der
Lokomotive
ausschliesslich die bewährte
Personenzugsbremse
zu verwenden. Wann die
R-Bremse
angewendet werden durfte, war in den Vorschriften geregelt. Damit war diese Erhöhung der Bremskraft bei An-wendung der ebenfalls vorhandenen G-Bremse nicht mehr aktiv. Was kein Problem war, da Güterzüge nicht so schnell unterwegs waren, dass die R-Bremse benötigt worden wäre.
Zudem wurde bei Anwendung der
Güterzugsbremse
auch der Druck in den
Bremszylindern
der
Laufachsen
reduziert. Dadurch hatte die
Lokomotive
in dieser Ein-stellung eine etwas geringere
Bremskraft. Mit Ausnahme der Schleuderbremse, die nur auf die Triebachsen wirkte, wurden mit den Bremsen die glei-chen Bremszylinder mit Druckluft versehen. Ein spezielles Ventil sorgte dafür, dass immer die höchste Bremskraft wirkte.
Damit kommen wir aber zu den mechanischen
Bremsen
der
Lokomotive,
die ebenfalls der höheren gefahrenen Geschwindigkeit der Maschine
angepasst werden musste und so deutlich bessere
Bremskräfte
ermöglichte. Jede Achse der Lokomotive hatte einen eigenen Bremszylinder erhalten, was eine Neuerung darstellte. Damit waren nicht weniger als sechs Bremszylinder eingebaut worden.
Da die
Bremskräfte
bei den
Triebachsen
höher sein durften, wurden hier etwas grössere
Bremszylinder
verwendet. So besassen die
Zylinder
der
Laufachsen
einen Durchmesser von zehn Zoll, jene der angetriebenen
Achsen
hatten jedoch einen Durchmesser von zwölf Zoll erhalten.
An jedem
Bremszylinder
war ein
Bremsgestänge
mit einem automatischen
Gestängesteller
der Marke Stopex angeschlossen worden. Dieser regelte den maximalen
Kolbenhub der Bremszylinder anhand der Abnützung der eingebauten
Klotzbremse.
Durch die Lösung mit diesem
Bremsgestängesteller
konnten auch der Unterhalt verringert werden. Jedoch war die
gleichbleibende
Bremskraft
bei der Baureihe Ae 4/6 viel wichtiger.
Das
Bremsgestänge
wiederum wirkte mit jeweils zwei
Bremsklötzen
pro
Rad
auf die
Laufflächen
der zugehörigen
Achse.
Wobei diese das Rad von beiden Seiten abbremsten und so wie eine Zange
zusammengezogen wurden. Damit waren bei der
Lokomotive
der Baureihe Ae 4/6 total 24 Bremsklötze vorhanden. Im Vergleich dazu
hatten vergleichbare Maschinen, wie zum Beispiel die Reihe
Ae 4/7 deutlich weniger Bremsklötze
erhalten.
Der von der
Druckluft
ausgestossene
Bremszylinder
veränderte das
Bremsgestänge
so, dass es die
Bremsklötze
der
Klotzbremse
gegen die
Laufflächen
der jeweiligen
Achse
presste. Dadurch wurde die Reibung erhöht und die Achse an der freien
Drehung gehindert. Es setzte auf der
Lokomotive
eine Verzögerung ein. Durch die Reibung wurde die kinetische Energie in
den Bremsklötzen in Wärme umgewandelt. Diese wurde wiederum über die
Bremsklötze aus Grauguss abgeleitet.
In jedem Führerstand war dazu eine Spindelbremse mit Arretierung vorhan-den, die wegen den Drehgestellen je-doch nicht auf die erste Triebachse wirkte.
Vielmehr wurde jeweils die nähere
Triebachse
im Rahmen der
Lokomo-tive
damit abgebremst. Aus dem
Führerstand
eins war das somit die zweite Triebachse und auf der an-deren Seite die
dritte Triebachse. Es wird nun Zeit, dass wir mit den Bremsen rechnen. Damit wir das kön-nen, benötigen wir jedoch zuerst das Gewicht der Lokomotive. Offiziell wurde dieses bei der Baureihe Ae 4/6 mit 105 Tonnen angegeben. Mit den beiden Handbremsen konnten je-weils 16 Tonnen Bremskraft erzeugt werden.
Damit reichten die
Handbremsen
der
Lokomotive
aus um diese auf dem gesamten Netz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
ausreichend zu sichern.
Spannender werden jedoch die
Bremsrechnung
mit den pneumatischen
Bremseinrichtungen.
Beginnen wir hier mit der
Regulierbremse
und bei der
automatischen Bremse
mit der normalen Stellung für die
P-Bremse.
Jetzt konnte ein
Bremsgewicht
von 67 Tonnen erzeugt werden. Das
Bremsverhältnis
betrug damit bei Anwendung dieser
Bremsen
63%. Im Vergleich zu anderen
Lokomotiven
der damaligen Zeit, war das schon ein guter Wert.
Da die
G-Bremse
eine etwas andere Bremswirkung zur Folge hatte, musste hier das
Bremsgewicht
auf 63 Tonnen reduziert werden. Trotzdem verfügte die
Lokomotive
auch jetzt noch über sehr gut wirkende
Bremsen,
denn das Verhältnis sank nur unwesentlich und betrug jetzt 60%, was immer
noch ein hoher Wert gegenüber den älteren Modellen bedeutete. Wir sehen,
dass nur schon jetzt gute Bremsen vorhanden waren.
Mit Anwendung der
R-Bremse
konnte ein
Bremsgewicht
von 89 Tonnen gerechnet werden. Das Gewicht der
Lokomotive
änderte sich natürlich nicht, so dass auch jetzt mit 105 Tonnen gerechnet
werden konnte. Damit ergab sich ein
Bremsverhältnis
von 85%, was im Vergleich zu den damaligen
Triebfahrzeugen
nicht einmal von allen
Triebwagen
erreicht wurde. Die
Bremsen
waren damit für eine Geschwindigkeit von 125 km/h ausgelegt worden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
im
Die
im
 Um
die
Um
die
 Mit
der eingebauten
Mit
der eingebauten
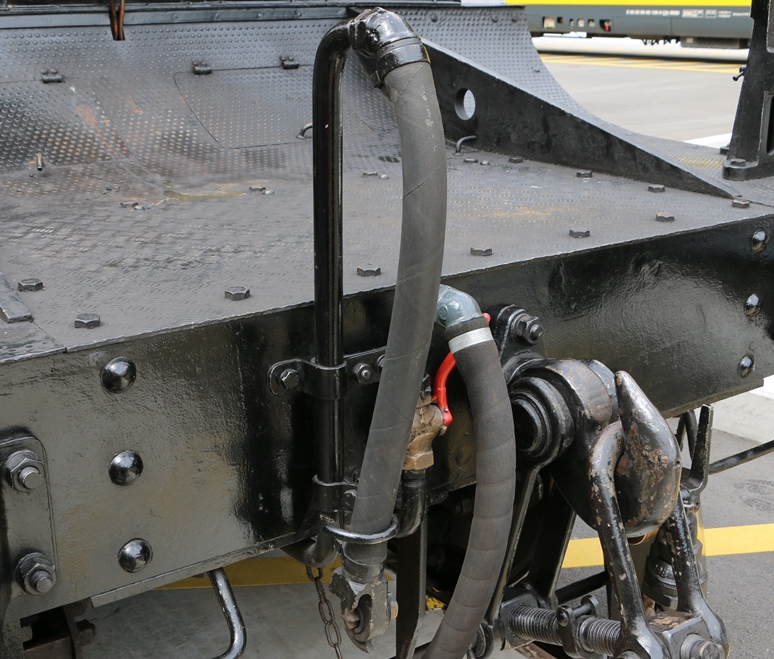 Die
Die
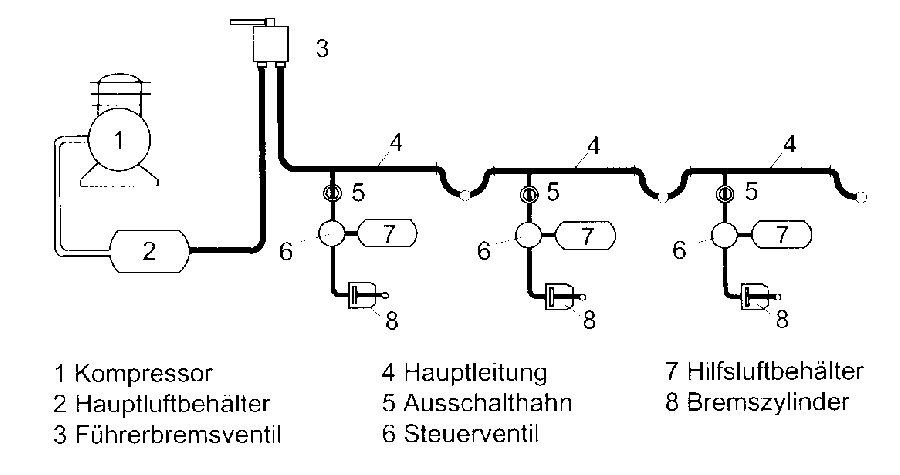 Angepasst
wurde jedoch das bei der
Angepasst
wurde jedoch das bei der
 Sank
die Geschwindigkeit unter 50 km/h wurde die
Sank
die Geschwindigkeit unter 50 km/h wurde die
 Direkt
auf das
Direkt
auf das