|
Druckluft und Bremsen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wenn wir nun zur
Druckluft und den
Bremsen kommen, dann kann eigentlich
erwähnt werden, dass diese dem gleichen Zweck diente, wie bei anderen
Baureihen. So wurden mit der komprimierten Luft neben den Bremsen noch
zahlreiche weitere Nutzer versorgt. Wenn sie schon da ist, dann nutzt man
sie auch. In diesem Punkt gab es zwischen den Ländern keinen Unterschied,
denn die Lösung war einfach und zudem noch leicht.
Der
Verschleiss sollte möglich gleichmässig erfolgen. So-mit kann es jedoch
passieren, dass je nach Konstellation die Produktion der
Druckluft nicht
mehr funktioniert. Um das Problem zu lösen, griff man zu einer einfachen
Lö-sung.
Jeder
Dieselmotor hatte seinen eigenen
Kompressor. So lange einer der
Motoren lief, wurde
Druckluft erzeugt. Die nun aber reduzierte
Leistung
spielte keine Rolle, denn mit nur einem Motor gefahren werden konnte nur
bei leichten Zügen. Diese sind oft auch kurz und daher wird nicht so viel
Druckluft benötigt. Die Leistung reichte aus und bei grossem Bedarf hat
man ja noch den zweiten Dieselmotor. Denn dieser konnte in der Regel
gestartet werden.
Direkt vom
Dieselmotor über
Kardanwellen wurde ein
Kompressor angetrieben.
Welchen der beiden vorhandenen Geräte wir uns ansehen spielt keine Rolle,
denn die beiden waren identisch aufgebaut worden und auch sonst gab es zu
den Modellen der Schweiz keinen so grossen Unterschied. Einzig, dass die
Teile von der Firma Knorr geliefert wurden. Das war aber wirklich keine so
grosse Sache, denn komplett anders aufgebaute Modelle sind selten.
Der von der Firma Knorr
Bremsen gelieferte
Kompressor war von der
Bauart
VV10/100 und er konnte mit einer ansehnlichen
Schöpfleistung aufwarten.
Diese wurde mit einem Wert von 96 m3/h angegeben. Dabei wurde
die
Druckluft mit Hilfe von
Kolben in eine Leitung gepumpt. Das Prinzip
kennen wir als
Kolbenkompressor. Diese sind ja von den
Luftpumpen der
Dampflokomotiven abgeleitet worden und damals sehr gute Modelle.
Luft die komprimiert wird, scheidet
Feuchtigkeit aus, wenn der Druck wieder sinkt. Was am Himmel zu Wolken
führt, kann in einem System für
Druckluft sehr gefährlich sein. Besonders
bei der kalten Jahreszeit kann diese gefrieren und Leitungen verstopfen. Ein einfacher Wasserabscheider übernahm diese Aufgabe. Das der Luft entnommene Wasser wurde in einem Gefäss gesammelt und musste in regelmässigen Abständen ent-nommen werden.
Da durch die Lösung auch an
anderen Orten Wasser ent-weichen kann, sind in der weiteren Leitung
ebenfalls noch Ablasshähne vorhanden. Mit diesem konnte auch das Sy-stem
für Arbeiten daran entleert werden. Eine
Handluft-pumpe war nicht
vorhanden. Der Dieselmotor konnte ohne Druckluft gestartet werden, daher musste diese nicht von Hand erzeugt werden. Um diese erste Leitung abschliessen zu können, muss noch er-wähnt werden, dass darin auch ein Überdruckventil ver-baut wurde.
Dieses war dazu vorgesehen den
Luftdruck in den Leitungen
und damit im System auf einen Wert von zehn
bar zu beschränken. Wurde der
Wert überschritten öffnete das
Ventil und die Luft entwich in den
Maschinenraum.
Mit diesem Wert haben wir ein System erhalten, das bei der Auslieferung
durchaus fortschrittlich war, denn in jenen Jahren wurden bei den Bahnen
die Systeme für die
Druckluft neu auf zehn
bar festgelegt. Der Grund dafür
werden wir später noch sehen, wichtig ist nur, der zur Schweiz
vergleichbare Wert war kein Zufall, sondern so in den Vorschriften
enthalten. Mit diesem
Ventil haben wir den ersten Teil des Systems
abgeschlossen.
Da der Vorrat
aber nur für die Ver-braucher und nicht zum Start der
Die-selmotoren
benötigt wurde, konnte die Luft in diesem Behälter nicht gespeichert
werden. Das war direkt von den Dampflokomotiven übernom-men worden. An diesem Druckluftbehälter war die für die Versorgung benötige Leitung angebaut worden. Diese war letztlich auch der Grund für den gewählten Wert.
Bezeichnet wurde diese Leitung als
Speiseleitung, oder nach
deutscher Schreibart die nicht so klare Hauptluftbehälterleitung. Ich
denke, dass wir bei der kürzeren Speiseleitung bleiben, denn auch mit HBL
führt das zu keinem anderen Ergebnis, es ist die gleiche Leitung.
Die Leitung wurde zu den beiden
Stossbalken geführt. Dort teilte sie sich
und stand dann der
Anhängelast zur Verfügung. Dazu waren am Balken ein
Absperrhahn und der
Luftschlauch vorhanden. Im Gegensatz zur Schweiz
verzichtete man in Deutschland auf den weissen Anstrich, es waren also nur
die gespiegelten
Kupplungen als einfache Kennzeichnung vorhanden. Doch nun
kommen wir zur Anhängelast und die hatte grossen Einfluss.
Die von der
Speiseleitung bereit gestellte
Druckluft wurde damals bei den
ersten
Reisezugwagen benötigt. Da diese auch international eingesetzt
werden konnten, musste der Wert für diese Leitung auf einen bestimmten
Wert beschränkt werden, denn nur so funktionierte es. Daher waren sie der
Grund, warum in diesem Bereich der
Luftdruck bei allen Bahnen in Europa
identisch gewählt worden ist, denn die
UIC griff hier ein.
Diese waren bei einer
Diesellokomotive kaum vor-handen. Daher arbeiten wir nach dem Prinzip, das
die
Druckluft ab der
Speiseleitung genommen wurde. Ausnahmen werden
erwähnt werden und diese waren wirklich selten.
Abgesehen von den
Bremsen wurde die
Druckluft für Bewegungen, akustische
Signale und Schaltungen genutzt. Diese müssen wir ansehen, bevor wir dann
zu den Bremsen kommen, die eigentlich für diese Druckluft verantwortlich
sind. Einige der Nutzer haben wir bereits kennen gelernt. So wurde bei der
Sandstreueinrichtung der Sand mit Hilfe von Druckluft auf die
Schienen
geblasen. So gelangte der
Quarzsand genau vor die
Lauffläche.
Ebenso bekannt sind die
Scheibenwischer. Diese waren mit einem
pneumatischen
Antrieb versehen worden. Mittels zwei
Zylinder wurde
wechselweise die Bewegung ausgeführt. Damit das ging, war im Antrieb auch
eine einfache Steuerung vorhanden, denn ohne diese konnte diese Lösung
nicht umgesetzt werden. Es war das einzige Teil, das mittels einer
Steuerung betrieben wurde, bei den anderen Nutzern, war der Betrieb
einfacher.
Das ist besonders
wichtig, da diese für Erteilung von akustischen Signalen genutzt wurden.
Zudem sollte die
Warnung von gefährdeten Personen wahrgenom-men werden. Weniger von den Leuten entlang der Bahnstrecke wahrgenommen wurde die mit der Druckluft betrie-bene Ansteuerung der Wendegetriebe. Damit diese korrekt in die Endlage gedrückt wurden, verwendete man Druckluft.
Fiel
diese jedoch aus, konnte die Fahrrichtung nicht mehr geändert werden. Da
jedoch der Druck fehlte wechselte das
Getriebe in den Leerlauf. Sie können
diese Regelung mit jener der
Wendeschalter verglei-chen.
Durchaus auch in der Schweiz bekannt war die
Spurkranzschmierung. Bei
dieser wurde mit
Druckluft ein
Schmiermittel auf den
Spurkranz
aufgetragen. Durch diese
Schmierung konnte der Verschleiss gemildert
werden. Wobei die Anlage nicht so intensiv arbeitete, wie in der Schweiz,
wo viele enge
Kurven vorhanden waren. Das Netz in Deutschland kannte viele
gerade Strecken und daher ist nicht so oft zu schmieren.
Länger können wir es nicht mehr herauszögern. Wir kommen nun zu den
Bremsen. Genau genommen geht es um die Druckluftbremsen. Diese hatten sich
vor Jahren schon durchgesetzt und gehörte seither dazu. Bei
Triebfahrzeugen wird zugleich die oft auch als Doppelbremse bezeichnete
Lösung mit zwei getrennten
Bremssystemen angewendet. Eine Ausnahme von
dieser Regel machten auch diese
Lokomotiven nicht, es gab beide
Bremssysteme.
Ich beginne auch hier mit der einfacheren Version. Auf der
Lokomotive
wurde eine
direkte Bremse eingebaut. Diese nur auf das Fahrzeug wirkende
Bremse arbeitete mit einem
Ventil, dass die
Druckluft mit veränderlichen
Druck in die
Bremszylinder leitete. Mit dem hier verbauten
Bremsventil der
Bauart Knorr konnten die Werte der in der Schweiz bekannten
Rangierbremse
erreicht werden. Das war klar, wurde sie auch hier zu diesem Zeck
benötigt.
Bei diesem wurde mit einem
Brems-ventil eine
Leitung mit
Druckluft so ge-füllt, dass ein Wert von fünf
bar vor-handen
war. In dem Zustand galt diese
Bremse als gelöst. Diese Leitung wurde ebenfalls zu den beiden Stossbalken geführt. Auch wenn uns der Begriff Hauptleitung ge-läufiger ist, wurde hier von der Haupt-luftleitung HLL gesprochen.
Auch jetzt waren
Kupplung und
Ab-sperrhahn
rot markiert worden. Es war also optisch nicht zu erkennen, welche der
beiden Leitungen nun welchem Zweck diente. So gesehen macht es durchaus
Sinn, wenn man die Kupplungen gespiegelt ausführt.
Eine
Bremsung bei dieser indirekten
Bremse wurde mit Absenken des Druckes
in dieser
Hauptleitung eingeleitet. Daher wurde von der
automatischen Bremse gesprochen. Das mag überraschend klingen, denn der Hersteller des
Steuerventils ist der Betrieb, der für die Bezeichnung verantwortlich ist.
Daher haben wir bei der vorgestellten
Lokomotive eine ganz normale
Westinghousebremse bekommen. Es ist so, hier lieferte die Firma
Westinghouse.
Speziell an diesem
Steuerventil war, dass es über einen Bremsdruckregler
verfügte. Bei dieser Regelung wurde bei einer Geschwindigkeit von über 60
km/h eine höhere
Bremskraft erzeugt. Fiel das Tempo unter den Wert von 50
km/h reduzierte sich der
Luftdruck wieder. Sollten Sie nun nach einem
passenden Namen suchen, dann würde ich
R-Bremse vorschlagen. Der Regler
arbeitete nach dem gleichen Prinzip und selbst die Geschwindigkeiten waren
gleich.
Mit einer Umstellvorrichtung konnte die
Bremse bei diesem
Steuerventil
angepasst werden. So war neben der bereits erwähnten
R-Bremse auch die
Personenzugsbremse und die
G-Bremse verbaut worden. Während die
Güterzugsbremse für
Güterzüge benötigt wurde, war bei
Reisezügen die
P-Bremse aktiv. In dem Fall konnte auch die Erhöhung mit dem
Bremsdruckregler aktiviert werden. Es war eine in der Schweiz durchaus
bekannte Lösung.
Ob von der
direkten Bremse, oder vom
Steuerventil kommend, die
Druckluft
wurde den
Bremszylindern zugeführt. Dabei war jeweils einer für jede
Achse
verbaut worden. Diese Lösung verhinderte ein schweres
Bremsgestänge und
wir wissen ja, dass hier um jedes Gramm gekämpft wurde. Das kurze am
Zylinder angeschlossene Gestänge bewegte die
Bremsklötze so, dass diese
gegen die
Lauffläche gepresst wurden und das
Rad sich nicht mehr frei
drehen konnte.
Diese Reibungsbremse war auch als
Klotzbremse bekannt geworden. Bei jedem
Rad wirkte diese von beiden Seiten auf die
Lauffläche. Wegen den verbauten
Bremssohlen aus Grauguss, erfolgte die Abnützung an diesen
Bremsklötzen
und deshalb war im
Bremsgestänge ein
Gestängesteller verbaut worden und es
ergab sich so eine optimal arbeitende
Bremse, die damals bei
Lokomotiven
international durchaus üblich war.
Diese
Handbremse wirkte jeweils
auf die benachbarte
Achse und die damit verbundenen
Bremskraft reichte um
die
Loko-motive auf den Streckennetz der Deutschen Bundesbahn DB
abzustellen. Was uns eigentlich noch fehlt, ist die Bremsrechnung. Die genauen Werte lassen wir weg, denn für den Einsatz in der Schweiz gab es hier die grössten Umbauten. Bei einer Geschwindigkeit von unter 60 km/h konnte ein Bremsverhältnis von 68% erreicht werden.
Das galt sowohl bei der
P-Bremse,
als auch bei der lang-sameren
Güterzugsbremse. Unterschiedliche Werte waren
da-mals kaum mehr vorhanden, da die
Luftdrücke identisch waren.
Spannend wird nun der Bremsdruckregler. Dieser arbeitete nun vom Prinzip
her, wie die
R-Bremse. Wenn wir die
Bremskräfte jedoch ansehen, gab es
grosse Unterschied. Das zeigte sich beim
Bremsverhältnis, das nun mit
stolzen 168% angegeben wurde. Die Kraft wurde also mehr als verdoppelt und
so waren auch bei einem Wert von 140 km/h kurze
Bremswege kein Problem.
Die
Lokomotive war ideal für schnelle Züge geeignet.
Es wurde keine
Magnetschienenbremse verbaut. Diese waren während dem Bau
noch selten und sie bedeuteten auch ein Gewicht, das hier gespart wurde.
Diese
Bremse war bei Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h auch nicht
erforderlich und daher war der Verzicht klar. Magnetschienenbremsen bei
Lokomotiven sollten immer eine Ausnahme bleiben, weil sie ein ansehnliches
Gewicht hatten. Wirklich umgesetzt wurden sie nur bei der Reihe
Re 460 und
Re 465.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
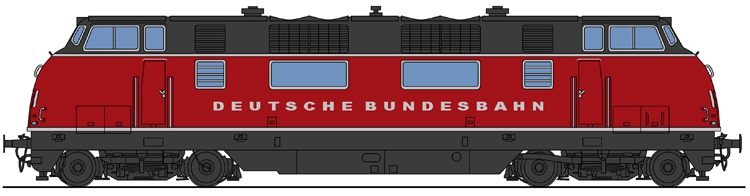 Schon bei den
Schon bei den
 Die von den beiden
Die von den beiden
 Die erzeugte und aufbereitete
Die erzeugte und aufbereitete
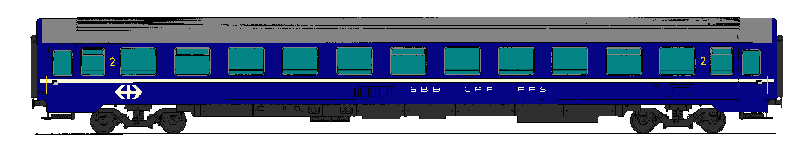 Auf dem Fahrzeug genötigte Abweichungen bei der
Auf dem Fahrzeug genötigte Abweichungen bei der

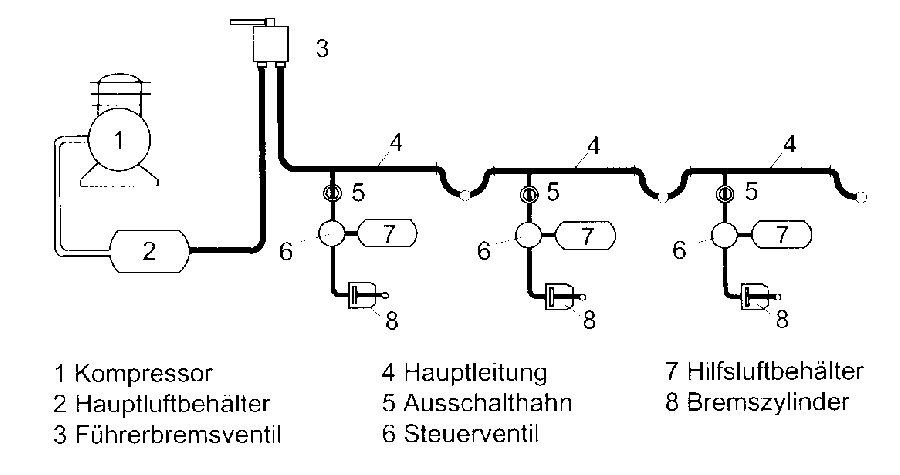 Gerade die her verbaute
Gerade die her verbaute

 Mit einer in jedem
Mit einer in jedem