|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
| Baujahr: | 1935 - 1938 | Leistung: | 394 kW / 536 PS | |
| Gewicht: | 38 / 41 t | V. max.: | 125 km/h | |
| Normallast: | 30 t bis 13 ‰ | Länge: | 22 400 / 25 000 mm | |
|
Als mit der gewonnen Volksabstimmung die Verstaatlichung der fünf
grossen
Privatbahnen
beschlossene Sache war, wusste niemand, was dieser Entscheid für das Land
für Folgen haben sollte. Die nur den Aktionären verpflichteten
Organisationen waren verschwunden und es entstand ein grosses direkt dem
Staat unterstelltes Unternehmen. Um 1900 sollte daher ein neuer Wind durch
die Welt der Eisenbahnen wehen.
So wurden neue
Dampfmaschinen,
wie die Baureihen A 3/5 und
C 5/6 ins Leben gerufen. Beide
sollten zu den neusten Stars der Schweiz werden und daran zweifelte
niemand. Der Weltkrieg sorgte dafür, dass bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB die neuen Technologien in den Vordergrund rückten und da
war an erster Position der
Wechselstrom.
Die
Gotthardbahn sollte, analog zur Lötschbergstrecke damit betrieben
werden.
Die Umstellung auf den elektrischen Betrieb erfolgte in den 20er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts in grossen Schritten. Nachdem im Jahre
1920 die Anlagen am Gotthard in Betrieb genommen wurden, dauerte es nicht
lange, bis auch weitere Strecken dazu kommen sollten. Die Panik vor der
Kohlennot, wirkte beflügelnd und die
Fahrleitungen
wurden in der Schweiz wirklich nahezu monatlich eingeschaltet und so der
Verkehr umgestellt.
Wenn
wir 1930, also nur zehn Jahre später das Netz ansehen, erkennen wir, dass
die wichtigsten Strecken unter
Fahrdraht waren. Die
Magistralen West-Ost
hatte im Gegensatz zu jener Nord-Süd noch Lücken, aber die Umstellung war
beschlossen und neu kamen die ersten
Nebenstrecken dazu. Nur das war
längst nicht mehr so einfach, wie bei den
Hauptstrecken, denn der
Oberbau
war neben den Magistralen nicht auf so hohem Niveau.
Die erste Generation für den Gotthard wurde von der zwei-ten Reihe für das Flachland abgelöst.
Jedoch blieb es mei-stens bei der Lösung
von
Lokomotive und Wagen. Ein Konzept, das von den alten Dampflokomotiven
übernommen wurde. Nur es gab auch andere Lösungen und für diese waren die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB ebenfalls offen.
So
kamen erste
Triebwagen
in den Bestand. Die Modelle der Baureihen
Ce 4/6
und Fe 4/4 zeigten gute Ergebnisse. Jedoch waren sie zu schwach und ihr
Fahrverhalten war auch nicht optimal. Die Fahrgäste wurden
durchgeschüttelt. Schlimmer war die Belastung für das
Gleis, denn die
Schienen hatten daran auch keine Freude. Alles in allem ein
unbefriedigender Zustand beim
Rollmaterial und die dritte Generation stand
auch schon an.
Sie
müssen wissen, dass nach 1930 durchaus Bestrebungen im Gang waren, die
Zukunft neu zu schreiben. Erwähnt werden muss dabei die
Lokomotive
Ae 8/14
mit der Nummer 11 851, die durchaus die Schwächen der
UIC-Standardkupplung
aufzeigen konnte. Sinnvoll waren solche Monster nur am grossen Berg, im
Flachland sollte man flink und agil operieren können. Daher musste man
hier durchaus andere Gedanken anstellen.
Bis
1930 waren die wichtigsten Strecken des Landes unter Fahrdraht. Zwar gab
es auf den
Hauptstrecken immer noch Lücken, aber die sollten in den
nächsten Jahren geschlossen werden. Das galt zum Beispiel auch für den
Simplontunnel, der bisher mit
Drehstrom betrieben wurde und der seit dem
02. März 1930 mit dem neuen System befahren werden konnte. Neu sollten
auch erste
Nebenstrecken von der
Fahrleitung profitieren.
Um mitzuhalten wurden einfach die vorhandenen
Bau-reihen erweitert. So entstand die umfangreichen Serien Ae 3/6 I und
Ae
4/7.
Lokomotiven die zum Sinnbild der
Staatsbahn werden sollten.
In
erster Linie waren das jedoch schwere
Lokomotiven, die in grosser Anzahl
beschafft wurden. Für die
Nebenstrecken waren sie oft zu schwer. So war es
eigentlich mit der
Fahrleitung nicht getan, der Oberbau musste auch
angepasst werden. Nur das überforderte selbst die
Staatsbahn, denn auch
sie hatte nicht unbeschränkte Ressourcen zur Verfügung. Daher wurden die
alten
Triebwagen
wieder wichtiger.
Während die Reihe
Ce 4/6 sich nicht optimal in Szene setzen konnte,
startete der
Triebwagen
Fe 4/4 voll durch. Auf
Nebenlinien sollte er zu
grosser Bekanntheit gelangen. Als Beispiel soll hier durchaus das Seetal
gehören, denn dort installierte sich dieser Triebwagen so gut, dass er
lange Zeit verkehren konnte. Der Vorteil im
Seetal war dabei, dass man
durch die Dörfer nicht so schnell fahren konnte. Auf anderen Linien sollte
es durchaus zügiger zugehen.
Alle
diese Fahrzeuge hatten einen Nachteil, denn sie waren nicht so schnell.
Mit den
Schnellzügen fuhr man damals 100 km/h und das war nicht schneller,
als 1902 mit den
A 3/5. Die Verkürzung der
Fahrzeiten erfolgte nur durch
die Tatsache, dass jetzt auch leichte Steigungen mit diesem Tempo gefahren
wurden. Dabei galten als leichte Steigung rund 10‰ als Standard.
Insbesondere die Baureihe
Ae
4/7 zeigte sich hier von der guten Seite.
Das war deutlich mehr, als bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB, wo man durchaus auch gerade Strecken
hatte. Zudem hatte man elektrische Fahr-zeuge, so dass diese Werte nicht
nur auf dem Papier galten. Es muss erwähnt werden, dass bei Dampflokomotiven die Höchstgeschwindigkeiten im Regelbetrieb oft nur auf flachen Abschnitten ausgefahren werden konnten. Kamen Steigungen fiel der Wert deutlich ab.
Die elektrischen
Lokomotiven der Schweiz operierten im
Flachland durchaus über längere Zeit
im Bereich der maximal erlaubten Tempi. Hier machte sich der geän-derte
Charakter der neuen Technik bemerkbar.
Gerade die neusten
Triebwagen
in der Schweiz misch-ten vorne mit. Nur diese
gab es bei den Schweizer-ischen Bundesbahnen SBB nicht und auch sonst waren
sie auf
Hauptstrecken eher selten. Auf Schmalspurbahnen zeigten sie gute
Ergebnisse und das führte dazu, dass die Lötschbergbahn für die
Erweiterung ihres Bestandes diese Lösung suchte. Die
Staatsbahn war dazu
auch bereit, nur dauerte es bei staatlich organisierten Unternehmen immer
etwas länger.
Die
Lötschbergbahn ging mit neuen leichten
Triebwagen
der Reihe
Bei der dritten
Generation woll-te man sich an diese Lösungen wagen. Die Zeit der
Notelektri-fikation war vorbei, jetzt soll-ten die optimalen Fahrzeuge
folgen. Da konnte man es in Bern durchaus etwas gemütl-icher angehen. Die Schweizerischen Bundes-bahnen SBB sahen sich davon angetan und suchten nach Lösungen und dies vor allem für den passenden Einsatz. Auf den Nebenstrecken entwickelte sich der Betrieb erfreulich.
Die Anzahl der
Reisenden stieg stetig an. Die Züge mussten länger und schwerer werden.
Dank den elektrischen Maschi-nen konnte aber wiederhin schnell gefahren
werden, was den
Fahrplan stabilisierte und so die Bahn zuverlässig war.
Einige Strecken litten jedoch unter mangelnder Nachfrage und sollten
ebenfalls bei der Kundschaft beliebter werden. Besonders zeigte sich das
auf
Nebenstrecken und im
Regionalverkehr, wo oftmals nur altes
Rollmaterial
verwendet wurde. Auch wenn die Baureihe Ae 3/6 I neu 110 km/h erreichte,
mit den
Regionalzug war man davon noch weit entfernt. Das machte das
Angebot unattraktiv und daher war dort das Problem zu lösen.
Im
Regionalverkehr hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB aber die
schweren
Lokomotiven im Einsatz. Diese arbeiteten oft nur im Bereich von
Teillasten. Auch ältere Lokomotiven waren mit zwei bis drei
Reisezugwagen nicht
ausgelastet. Hinzu kam, dass nur wenige Baureihen auch die höchsten
Geschwindigkeiten erreichten, und so der
Regionalzug mit dem älteren
Modell friedlich mit maximal 75 km/h durch das Land tuckerte.
Dabei war die kleine
Lokomotive gut ausgelastet. Die
Folge davon war klar, dass es etwas Zeit dauerte, bis dieses Tempo
erreicht war. Jedoch konnte es danach lange Zeit gehalten werden. Für den Regionalzug kam dann eine ältere Maschine, oder aber ein Triebwagen Ce 4/6 zum Einsatz. Im besten Fall erreichten diese Fahrzeuge 85 km/h. Die Lokomotive war zudem längst nicht ausgelastet.
Der Begriff vom «Bummler»
entstand in jener Zeit und er sollte seine Berechtigung haben, denn diesen
Unterschied merkten auch die Fahrgäste. Die Reise nach Bern oder Thun
dauerte daher mit dem
Nahverkehr fast doppelt so lange.
Dieser
Nahverkehr sollte schneller abgewickelt werden, zudem war es auch
an der Zeit die Geschwindigkeit im Land grundsätzlich zu erhöhen. Im
Fernverkehr sollten daher ebenfalls neue Massstäbe geschaffen werden.
Dabei sollten durchaus Werte erreicht werden, die sich im internationalen
Vergleich zeigen konnten. Das Land der Eisenbahn sollte die passenden
Lösungen bekommen und da sah man die
Triebwagen
als ideale Lösung an.
Die
neuen Züge der Schweizerischen Bundesbahnen SBB sollten meist als
Alleinfahrer sowohl im Schnell-, als auch im
Regionalverkehr eingesetzt
werden. Durch den Verzicht auf
Anhängelasten
wollte man spurtstarke
Triebfahrzeuge. Besonders der Verkehr auf den neu mit
Fahrleitung versehenen
Nebenstrecken wollte man damit beleben. Zusätzlich wollte man aber auch
Ausflüge mit den neuen Fahrzeugen anbieten können.
Ausflüge mit der Bahn wurden in diesen Jahren immer beliebter. Die Leute
reisten einfach zum Vergnügen und nicht mehr aus der Notwendigkeit heraus.
In
Gruppen wurden Fahrten nach entfernten Teilen des Landes angetreten.
Die
Staatsbahn musste die
Sonderzüge oft mit
Lokomotive und einem, oder
zwei Wagen führen, was natürlich unwirtschaftlich war. Die häufigen
Richtungswechsel waren auch nicht leicht zu organisieren.
Zwar entsprachen diese leichten mit
Dieselmotor
be-stückten Modelle noch nicht der später bekannten Bau-reihe VT 95, jedoch
gerieten sie in den Fokus der Leute in Bern. Dort war man von den
Fahrzeugen angetan, auch wenn sie nicht zur Schweiz passten. Diese Triebwagen waren so ausgelegt worden, dass sie alleine, oder mit passenden Wagen verkehren konnten. Auf den Nebenstrecken des Landes reichten diese mo-dernen Lösungen durchaus.
Auch die
Flinke leichte innovative Regionaltriebwagen sollten entstehen, auch wenn
man damals in der Schweiz den Begriff «FLIRT» noch nicht kannte. Die
zweiachsigen Modelle in Deutschland waren betrieblich nicht ausgereift und
sie wurden mit einem
Dieselmotor betrieben, was in der Schweiz auch noch
nicht erfolgte. Gerade auf einigen
Nebenstrecken, wo sich eine
Fahrleitung
nicht lohnen sollte, wären solche Modelle auch in der Schweiz möglich.
Da
man aber den grössten Teil des Landes unter
Fahrleitung hatte, sollten
diese neuen Schienenomnibusse elektrisch betrieben werden. Zudem sollten
sie etwas mehr Platz anbieten können und das Mitführen von zusätzlichen
Wagen war nicht vorgesehen. Dank diesem Konzept sollte jeder Wendebahnhof
seinen Schrecken verlieren. In wenigen Minuten konnte so wieder
losgefahren werden und das Fahrzeug war optimal einsetzbar.
Die
Lösung waren deshalb
Triebwagen, die als Alleinfahrer verwendet werden
konnten. So konnten die
Sonderzüge mit speziellen Fahrwegen lukrative
Fahrzeiten anbieten. Nur sollten es in der Schweiz nicht Schienenomnibusse
sein, sondern man sprach von neuartigen
Tramzügen. Diese sollten auch den
Aufwand beim Personal verringern, denn bei den Tramzügen sollte nur noch
der Lokführer anwesend sein und die
Fahrscheine von ihm kontrolliert
werden.
Bevor
wir uns diesen besonderen Fahrzeugen zuwenden, muss gesagt werden, dass
die Idee mit den
Tramzügen ein so grosser Erfolg wurde, dass die Züge
überrannt wurden. In der Folge kamen wieder die Lösungen mit
Lokomotive
und Wagen, jedoch auch der zweite Weltkrieg mit seinen Folgen für das
Land, das sich mit allen Mitteln verteidigen wollte. Da waren flinke
leichte innovative Regionaltriebwagen nicht gefragt.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
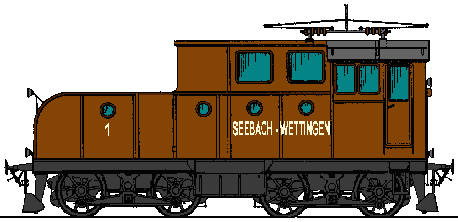 Die
neue
Die
neue
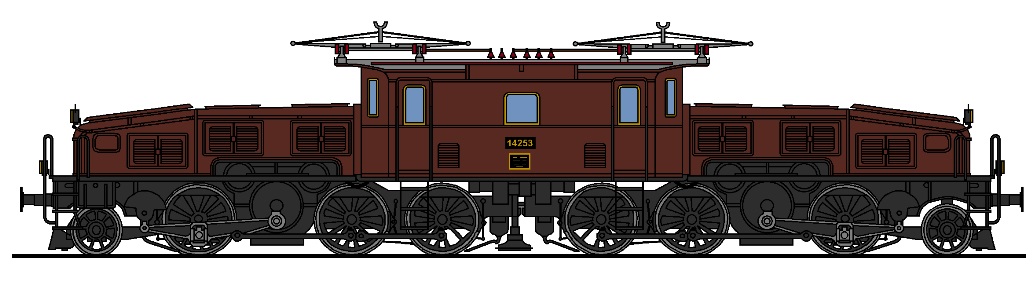 Mit
dieser schnellen Umstellung vermoch-ten die
Mit
dieser schnellen Umstellung vermoch-ten die
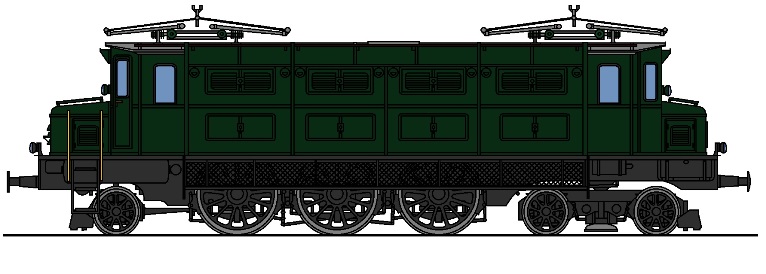 Jedoch hatte die Umstellung nicht nur Vorteile. Die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB mussten auch die
Jedoch hatte die Umstellung nicht nur Vorteile. Die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB mussten auch die
 Blickte man ins Ausland, erkannte man, dass dort mit neuen
Dampflokomotiven ein schneller Verkehr aufge-zogen werden konnte. In
Deutschland fuhr man seit einigen Jahren mit der Baureihe 01
Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h.
Blickte man ins Ausland, erkannte man, dass dort mit neuen
Dampflokomotiven ein schneller Verkehr aufge-zogen werden konnte. In
Deutschland fuhr man seit einigen Jahren mit der Baureihe 01
Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Die
Die
 Wie
sich das darstellte, soll ein Beispiel zeigen. Dabei sehen wir uns die
Strecke zwischen Bern und Thun an, die schon damals zur Rennbahn mutierte.
Der
Wie
sich das darstellte, soll ein Beispiel zeigen. Dabei sehen wir uns die
Strecke zwischen Bern und Thun an, die schon damals zur Rennbahn mutierte.
Der
 Wieder lohnt es sich, wenn wir kurz über die Grenzen und damit ins Ausland
blicken. In Deutschland begannen die ersten Schienenomnibusse der Baureihe
VT 135 Fahrt aufzunehmen.
Wieder lohnt es sich, wenn wir kurz über die Grenzen und damit ins Ausland
blicken. In Deutschland begannen die ersten Schienenomnibusse der Baureihe
VT 135 Fahrt aufzunehmen.