|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
| Baujahr: | 1953 | Leistung: | 1 470kW / 2 000 PS | |
| Gewicht: | 68 / 64 t | V. max.: | 110 km/h | |
| Normallast: | 200 t bei 75 km/h | Länge: | 23 700 mm | |
|
Bevor wir mit der Vorstellung dieser drei besonderen
Triebwagen
beginnen, müssen wir einige Punkte klären. Es kann auch in Fachbüchern
immer wieder gelesen werden, dass es sich hier um die
Prototypen
für eine grössere Serie ähnlicher Triebwagen bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB handelte. Hatten es die grossen
Staatsbahnen
bei ihren Triebwagen
RBe
4/4 es wirklich nötig, sich bei der
Privatbahn
zu bedienen?
Die drei Fahrzeuge der BLS-Gruppe,
jedoch nur als
Prototypen
zu sehen, ist falsch. Es war eine kleine Serie, die gebaut wurde um den
Betrieb auf einigen Strecken zu beschleunigen.
Das Hauptproblem der
Staatsbahnen
war, dass in wenigen Jahren in Lausanne eine Landesausstellung
ausgerichtet werden sollte. Die Regierung des Landes erwartete dabei, dass
die eigene
Bahngesellschaft
dafür sorgt, dass zahlreiche Besucher an den Lac Leman reisen konnten. Das
war nicht neu und doch für die
Staatsbahnen
ein Problem. Die geplante Erneuerung mit der späteren
Lokomotive
Re 4/4 II hatte
erst begonnen.
Um die Leute in die Westschweiz zu bringen, mussten schnell
kräftige Fahrzeuge her, die zudem bei den
Bahnsteigen
keinen Platz vergeudeten. Da man sich wegen der notwendigen kurzen
Lieferfrist keine lange Entwicklung leisten konnte, sah man sich bei
anderen
Bahngesellschaften
um. Dabei fanden die Konstrukteure die drei hier vorgestellten
Triebwagen
der BLS-Gruppe.
Diese passten ganz gut für den Verkehr.
Es handelte sich bei den drei
Triebwagen
der BLS-Gruppe
um eine kleine Serie, die bei vielen kleinere
Privatbahnen
durchaus üblich waren. Die von den
Staatsbahnen
verlangte kurze Lieferfrist verlangte, dass man sich an den hier bereits
gemachten Erfahrungen die Ideen für das Modell holte. So konnten die
Prototypen
der Reihe
RBe
4/4 schnell gebaut und ausgeliefert werden, was das
Problem mit Lausanne löste.
Es muss auch erwähnt werden, dass einige andere
Privatbahnen
mit den auch als EAV-Triebwagen
bekannten Fahrzeugen, Ableitungen beschaffen konnten, die auf dem Muster
der
Staatsbahnen
aufbauten. So gesehen, waren auch das direkte Nachkommen der hier
vorgestellten Triebwagen, die als einige dieser Familie als Ce 4/4 in
Betrieb genommen wurden. Gerade die Modelle des EAV hatten zusätzlich ein
Gepäckabteil
erhalten.
Auch wenn man es anhand der Bezeichnung annehmen könnte, die
beiden Modelle waren mit der gleichen
Wagenklasse
versehen worden. In den ersten Zeichnungen der neuen
Triebwagen
der
Staatsbahnen
wurde noch von
RCe
4/4 gesprochen. Die dritte Wagenklasse wurde
aber während dem Bau aufgehoben. Die etwas älteren Ce 4/4 der BLS-Gruppe
mussten daher in der Folge während dem Betrieb neu benannt werden.
Das bei den
Staatsbahnen
geführte R in der Bezeichnung mag verwirren, aber die bei den Modellen der
BLS-Gruppe
gewählte
Höchstgeschwindigkeit
lag zu tief, als man die
Triebwagen
als RCe 4/4 hätte führen müssen. Hinzu kam, dass sich die
Privatbahnen
viele Jahre gegen diesen Hinweis sträubten. Wir hier wollen uns nun aber
ansehen, wie es zur Reihe Ce 4/4 der BLS-Gruppe kam, die oft auch als neue
Lokomotive
gesehen wurde.
Dieser Fehler entstand, als die BLS-Gruppe
einige
Lokomotiven
der Reihe
Ce 4/6 der
Laufachsen
beraubte. Dadurch entstand die Reihe
Ce 4/4. Zu diesem
Zeitpunkt sind die hier vorgestellten
Triebwagen
jedoch bereits als Be 4/4 geführt worden. Auch wenn es etwas verwirrend
sein kann, wir sehen uns den Triebwagen an und dabei beginnen wir bei den
Lokomotiven, die auf der BLS verkehrten, denn diese waren nicht
unschuldig.
Dieses sah vor, dass die
Schnellzüge
von und nach Brig bereits ab Bern mit Modellen der BLS bespannt verkehren.
Die
Lokomotiven
der
Staatsbahnen
blieben bis Interlaken Ost vor den schnellen Zügen. Der
Lokwechsel in Thun konnte so entfallen und die
Fahrzeit
wurde kürzer. Was so einfach klingt, war für die BLS-Gruppe eine grosse Herausforderung, die gelöst werden musste. Die Schnell-züge nahmen grundsätzlich den Weg durch das Aaretal.
Das war insbesondere von den internationalen
Verbind-ungen
über den Lötschberg und durch den Simplon der Fall. Ausschlaggebend war
die
Kapazität
im Aaretal und die Tatsache, dass diese Strecken nach dem internatio-nalen
Standard aufgebaut war. Auch wenn es auf der Gürbetalbahn immer noch Schnell-züge gab, diese blieben auf die Strecke beschränkt. Die Zeiten, wo man mit dem schnellen Zug durch das Gürbetal und auf der Thunerseebahn nach Interlaken Ost reiste, waren längst verschwunden.
Wie vorher erwähnt, war es die Lötschbergstrecke und deren neuer
Standard schuld.
Schnellzüge
auf
Nebenbahnen
sah man so oder so nur sehr selten und das auch in der Schweiz.
Das Aaretal war aber ein grosses Problem für die BLS-Gruppe.
Die Strecke war durch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB vor wenigen
Jahren begradigt und für Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h ausgebaut
worden. Mit der Reihe
Ae 3/6 I wurde diese auch ausgefahren und das war für die BLS-Gruppe
schlicht zu viel. Mit der Reihe Ae
6/8 erreichte man gerade einmal 90 km/h, was deutlich zu langsam für
das Aaretal war.
Mit geringem Aufwand konnte die Reihe
Be 6/8 auf 90 km/h
angehoben werden. Mehr war jedoch nicht möglich und so blieb man hinter
den
Staatsbahnen
zurück, was aber nur ein Punkt war.
Die Modelle der
Baureihe
Ae 6/8 waren auch vor
den
Güterzügen
gefragt. Mit der vorhandenen An-zahl konnte daher der neue Verkehr nicht
abgedeckt werden. Noch schlimmer war, dass man mit den Güterzügen über die
Strecken der
Staatsbahnen
nach Basel fuhr. Das band weitere
Lokomotiven
und es fehlte an Maschinen für die schweren
Schnellzüge.
In der Not wurde in Thun wieder gewechselt, auch wenn das nicht geplant
war.
Als Ersatz für die nicht verfügbare
Lokomotive
Ae 6/8, kam der
Triebwagen
CFe 4/5
und die umgebaute Lokomotive Ae 5/7
zum Einsatz. Aber auch diese konnten nicht mit den Geschwindigkeiten der
Staatsbahnen
mithalten. Somit war klar, die
Betriebsgruppe
musste den Verkehr mit den
Schnellzügen
auf der
Bergstrecke
verbessern. Die Finanzen waren wegen dem durch den Weltkrieg bedingten
Ausfall nicht gut.
Zwar verdiente man mit den schweren
Güterzügen
auf der
Bergstrecke
etwas, aber das reichte nicht um mit der grossen Kelle anzurühren. Man
kochte auf kleinem Feuer. So fehlte es an allen Ecken und Enden. Wir
sehen, auch wenn das Problem mit der
Kohle
nicht mehr vorhanden war, der Weltkrieg brachte die
Privatbahnen
der Schweiz finanzielle in Bedrängnis. Dabei war die BLS-Gruppe
im Vergleich noch gut aufgestellt.
Nachdem ein Modell der Staatsbahnen abgelehnt wurde, kam es mit der Reihe Ae 4/4 zu einer Lokomotive, die den Weg in die Zukunft darstellen sollte.
Hohe
Leistung
und keine
Laufachsen
war schon viel, aber auch noch schnell fahren, war wirklich ein Wunder.
Die ersten beiden Maschinen kamen noch während dem zweiten
Weltkrieg in den Betrieb. Eigentlich hätte man schnell mehr Modelle
benötigt, aber es fehlte an den Geldern und so kamen die Maschinen in
Schritten zur BLS-Gruppe.
Das Problem mit den
Schnellzügen
löste sich langsam und damit konnte man sich auch den anderen Bahnen der
Betriebsgruppe
zuwenden. Dort verkehrten mit wenigen Ausnahmen noch die
Lokomotiven
von 1920.
Bei den Bahnen im Oberland konnte der Verkehr so noch aufrecht
erhalten werden. Auf dem Abschnitt nach Schwarzenburg versorgte man einen
der unbeliebten CFe 2/6.
Eigentliche Probleme gab es nur im Gürbetal und auf der Linie nach
Neuchâtel. Auf beiden wollte man mit
Schnellzügen
fahren und diese sollten endlich auch dem Namen gerecht werden. Auch wenn
Berner sprichwörtlich langsam sein sollen, bei der Bahn ging das nicht.
Als Folge der neuen
Baureihe
Ae 4/4 konnten auf der
Bergstrecke
einige Maschinen der Reihe
Be 5/7 abgelöst werden.
Diese ebenfalls nicht neuen
Lokomotiven
waren schneller als die Reihe
Ce 4/6 der
Nebenbahnen.
Zudem besass sie eine hohe
Zugkraft,
was gerade bei den dort vorhandenen Steigungen ein wichtiger Punkt war.
Für die oftmals kleinen Bahnen wären diese günstigen Maschinen eigentlich
ideal gewesen.
Hauptproblem war jedoch die
Achslast.
Die für die
Bergstrecke
gebauten Maschine hatte Werte von bis zu 20 Tonnen auf den
Triebachsen.
Das war für den
Oberbau
der
Nebenbahnen
schlicht zu viel. Um die Strecken auf diese Achslast auszubauen fehlte
jedoch das Geld. So konnte diese Lösung nicht umgesetzt werden und das war
ein Problem für zwei Bahnen der
Betriebsgruppe
und deren Situation sehen wir uns an.
Keine der mitbetriebenen Bahnen hatte die
Achslasten,
die auf der BLS zugelassen waren. Das waren internationale Standards und
diese galten damals noch nicht für die zahlreichen
Nebenbahnen.
Wir erinnern uns, dass diese schon verstärkt wurden, als die elektrischen
Maschinen kamen. Jetzt müsste der
Oberbau
komplett ersetzt werden. Das benötigte Zeit und vor allem viel Geld, dass
bekanntlich nicht vorhanden war.
Im Gürbetal verkehrten immer noch
Schnellzüge.
Auch wenn die Reise von Bern nach Interlaken Ost dank den Zügen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB über das Aaretal schneller war, hielt man
bei der
Nebenbahn bei den Schnellzügen fest, Dabei war man
aber weit abgeschlagen und das merkte man bei den Reisenden. Wir jedoch
fragen uns, wo denn das Problem lag, denn das Gürbetal war nicht schlecht
aufgestellt.
Wegen dem Gewicht mussten die
Schnellzüge
im Gürbetal mit der
Lokomotive
Ce 4/6 bespannt werden.
Mit einer
Höchstgeschwindigkeit
von 65 km/h konnte um 1950 nicht mehr von einem Schnellzug gesprochen
werden. Man bummelte etwas durch die Gegend und das führte schnell dazu,
dass der Reisende das Aaretal nahm, weil dort die Post abging. Es fehlte
schlicht eine schnelle Lokomotive mit geringer
Achslast.
Mit 125 km/h war sie jedoch für die Strecke im Gürbetal noch zu
schnell. Mehr als 110 km/h war auf der Strecke damals nicht zuge-lassen
und zudem war die
Lokomotive
der
Staatsbahnen
der BLS-Gruppe
nicht geheuer.
Hinzu kam, dass man im Gürbetal mit der Länge der
Bahnsteige
kämpfte. Mit der
Lokomotive
Ce 4/6 musste oft über
das Ende vorgezogen werden und dann konnte der Zug in der Gegenrichtung
nicht mehr einfahren. Betrieblich verlangte das nach einer genauen
Planung, die aber nicht immer sauber umgesetzt werden konnte. Das Modell
der
Staatsbahnen
hätte zu keiner Verbesserung bei der Situation mit dem Platz geführt.
Mit einem kräftigen und schnellen
Triebwagen
konnte das Problem gelöst werden. Dieser ersetzte einen Wagen und
eliminierte die
Lokomotive.
Mit anderen Worten, der
Schnellzug
im Gürbetal wäre wieder mit einer zu den
Bahnsteigen
passenden Länge versehen. Dass dieses Konzept funktionierte, wusste man
bei der BLS-Gruppe
bereits seit einigen Jahren und damit kommen wir zur zweiten
Bahngesellschaft
mit Problemen.
Die BN, die zwischen den Städten Bern und Neuchâtel verkehrte,
stellte schon immer einen besonderen Fall innerhalb der
Betriebsgruppe
dar. Dort wurden die
Schnellzüge
mit den neuen elektrischen
Lokomotiven
sogar langsamer als bisher. Die
Schnellzugslokomotiven
Ea 3/6 hatten 90 km/h erreicht.
Die Reihe
Be 4/6 tuckerte
mit gemütlichen 75 Km/h über die Strecke in der Ebene, die weitaus höhere
Geschwindigkeiten erlaubte.
Schwer waren diese nicht, aber sie mussten schnell sein. Jedoch
lag die
Höchstge-schwindigkeit
bei 90 km/h und so war man immer noch nicht schneller unterwegs, als mit
der
Dampfmaschine,
die längst verschwunden war. Die BN griff daher zu einer eigenen Lösung.
Seit die Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch elektrisch fahren
konnten, verkehrten immer wieder
Lokomotiven
der
Staatsbahnen
auf der BN. Das oft auch im direkten Auftrag der
Bahngesellschaft.
Gerade bei den
Schnellzügen
die über Neuchâtel hinaus in den Jura verkehrten, ging es mit den
Triebwagen
nicht mehr so schnell. Wie mit der Lokomotive der Staatsbahnen. So griff
man zu dieser um wirklich schnell zu sein.
Das wirkte sich jedoch negativ auf die Kilometerschuld der BN aus.
Damals wurden solche Einsätze mit der Distanz aufgerechnet. Um die hohen
Schulden abarbeiten zu können, mussten die
Triebfahrzeuge
über Neuchâtel hinaus am
Schnellzug
bleiben. Das ging nur mit einem neuen schnell Triebfahrzeug und daher
schied die Reihe
Be 5/7 schlicht aus,
denn man wollte ja schneller und nicht langsamer über die Strecke fahren.
Gerade die
Achslasten
waren auf der BN kein Problem mehr. Jedoch ergab sich durch die Erhöhung
der
Höchstgeschwindigkeit
ein Bedarf nach einem neuen Modell. Wir haben damit zwei Bahnen erhalten,
die schnelle
Triebfahrzeuge
brauchten und dabei war bei beiden wegen den
Bahnsteigen
und deren Länge nur ein
Triebwagen
von Vorteil. Zusammen konnte man auch neue Ausführungen in Betracht
ziehen.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
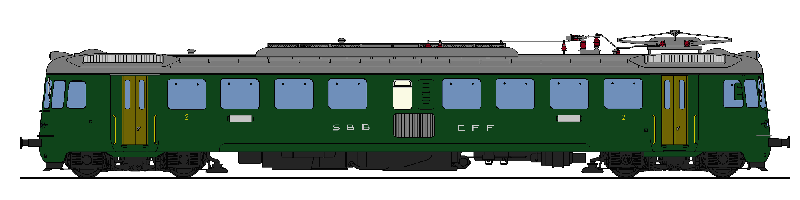

 Bei
der BLS hatte sich während dem zweiten Weltkrieg viel verändert. Noch vor
dem Ausbruch kam es zum Ab-kommen mit den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB.
Bei
der BLS hatte sich während dem zweiten Weltkrieg viel verändert. Noch vor
dem Ausbruch kam es zum Ab-kommen mit den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB. Auch
wenn die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die kräftigeren Modelle der
Reihe
Auch
wenn die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die kräftigeren Modelle der
Reihe 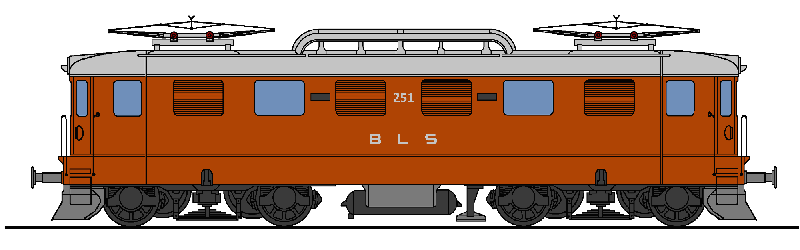 Für
die
Für
die

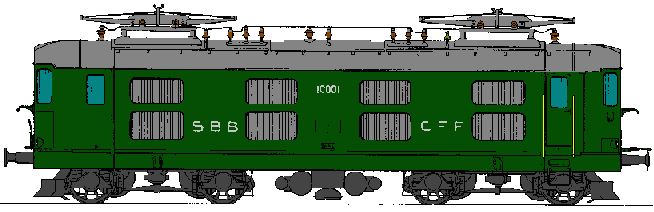 Diese
hätte es sogar gegeben. Die
Diese
hätte es sogar gegeben. Die
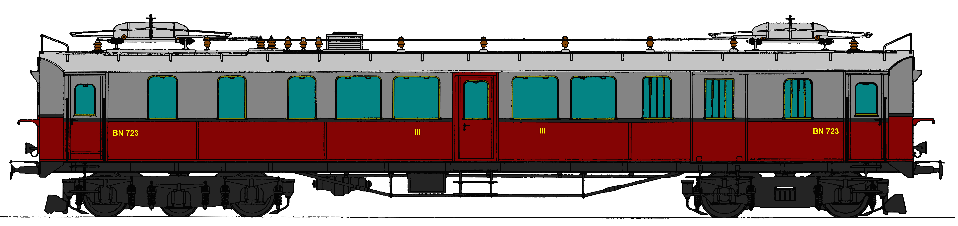 Aus
diesem Grund hatte man die
Aus
diesem Grund hatte man die