|
Betriebseinsatz SBB |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Nachdem sich die beiden
Lokomotiven
zehn Jahre bei der Maschinenfabrik Oerlikon in einem Schlummerschlaf
befunden hatten, kam es zu einer Situation, die dafür sorgte, dass der
Staubwedel genommen wurde. Die abgestellten und seit Jahren nicht mehr
bewegten Lokomotiven sollten für einen weiteren Einsatz vorbereitet
werden. Grund dafür war, die eingesetzte Euphorie bei der Elektrifizierung
der Strecken in der Schweiz.
Insbesondere die Schweizerischen Bundesbahnen SBB waren hier an
erster Stelle. Man hatte sich dazu entschlossen, die Strecke über den
Gotthard mit
Wechselstrom
zu versorgen. Das war ein folgenschwerer Entscheid, denn bekanntlich fuhr
damals die
Staatsbahn
im Wallis mit
Drehstrom
auf einem immer grösser werdenden Netz. Der Vorteil von Wechselstrom, lies
erkennen, dass der Drehstrom früher oder später verschwinden sollte.
Mit dem
Fahrdraht
war es nicht getan, es mussten neue Maschinen entwickelt und erprobt
werden. Das erfolgte noch bevor es einen Meter Fahrdraht am Gotthard gab.
Für die erforderlichen Tests hatte man in der Schweiz bekanntlich die
Strecke über den Lötschberg. Die war vergleichbar, aber von Bern aus nur
mit Dampflokomotiven zu erreichen. Das
Depot
Bern sollte jedoch den Unterhalt vornehmen und daher lohnte sich eine
andere Lösung.
Es konnte an die Erprobung gegangen werden. Nur, so leicht war das
gar nicht, denn es fehlten elektrische
Trieb-fahrzeuge,
die auch einen guten Teil der fahrplanmässigen Züge übernehmen konnten. Aus diesem Grund benötigte man sehr schnell Maschinen, die eingesetzt werden konnten. Die Hersteller bemühten sich schnell passende Exoten beizusteuern. Dabei waren es oft Maschinen, die anderweitig erprobt wurden und nun nicht mehr benötigt wurden.
Ich will hier kurz zwei Modelle vorstellen, die wahrlich zu Exoten
im Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen SBB werden sollten. Auch wenn
es zum Teil gute Erprob-ungsträger sein sollten.
Von der Firma BBC in Münchenstein stammte die Ma-schinen Fb 2/5.
Diese wurde in Fachkreisen auch als MIDI-Lokomotive
bekannt. Der Grund war, dass sie ursprünglich auf der entsprechenden
Strecke mit 11 000
Volt
eingesetzt werden sollte. In der Not passte man diese Maschine an und fand
zuerst bei der BLS und später bei den
Staatsbahnen
einen guten Abnehmer, für diese nicht ganz gelungene Maschine mit weniger
Triebachsen,
als man meinen könnte.
Ein weiterer Exot sollte die Fc 2x 3/3 von Siemens sein. Obwohl
man sich dort keinen Auftrag erhoffen konnte, wurde die Maschine in die
Schweiz überstellt. Sie war ursprünglich für die Erzbahn zwischen Kiruna
und Narvik gebaut worden, konnte jedoch wegen dem Krieg nicht ausgeliefert
werden. Damit konnte sie nun in die Schweiz überstellt werden. Dort
sollte sie den nicht gerade schmeichelhaften Namen «Röthenbachsäge»
bekommen.
Mit der bescheidenen
Leistung hätten sie für den
Rangierdienst
und die Bespannung von leichten Zügen genutzt werden können. Unter den
vorher vorgestellten Exoten aus der halben Welt, reihten sich die alten
Maschinen aus Oerlikon ganz gut ein. Die Maschinen konnten nach leichten Anpassungen leichte Aufgaben übernehmen und so zum Beispiel im Personenverkehr eingesetzt werden. Die beiden Lokomotiven, die vermutlich immer noch im Raum Seebach waren, wurden in der Folge an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkauft.
Dabei darf man nicht vergessen, dass in den Hallen der MFO die
ersten Maschinen der Baureihe Fc
2x 3/4 gebaut wurden. Bekannt werden sollten diese als «Krokodil». Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB richteten die beiden Loko-motiven soweit nötig für den vorgesehenen Streckendienst her. Dazu wurden auf dem Dach die alten Stromabnehmer entfernt und ein neueres zu verbauten Fahrleitung passendes Modell aufgesetzt.
Die ehemalige MFO 2 wurde dabei im elektrischen Teil zusätzlich
noch an die Schwester angepasst. So sollten von der elektrischen Seite her
zwei identische Maschinen entstehen.
Erstmals bekamen die beiden
Lokomotiven
ein
Steuerstromnetz,
Batterien
und elektrisches Licht. Diese
Beleuchtung
hatte sich mittlerweile bei elektrischen Lokomotiven durchgesetzt und
daher wurden auch die alten Maschinen damit versehen. Das nun vorhandenen
Bordnetz
erlaubte auch leichte Anpassungen bei der Steuerung der
Fahrstufen.
Man kann fast behaupten, dass es eine leichte Modernisierung war.
Speziell war dabei eigentlich nur, dass dies acht Tage nach der
Auslieferung der
Lokomotive
mit der Bezeichnung Fc 2x 3/4
durch die Firma BBC erfolg-te. Nur, konnte man auch diese alten
Lokomotiven gebrauchen.
Gerade mit den beiden Maschinen der MFO erkennen wir, wie viel
Aufwand damals betrieben wurde um möglichst schnell elektrische
Lokomotiven
für 15 000
Volt
und 16 2/3
Hertz
zu bekommen. Damit wurden diese beiden Lokomotiven jedoch teilweise von
den ersten
Prototypen
für die
Staatsbahnen
überrannt. Doch nun hatte man die Möglichkeit den Betrieb auf der Strecke
elektrisch durchzuführen und das war letztlich das Ziel.
Die beiden
Lokomotiven
wurden logischerweise dem
Depot
Bern zugeteilt und kamen bereits vor dem offiziellen Übernahmedatum in
Betrieb. Bern war damals das einzige Depot der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB, das mit einer
Fahrleitung
versehen worden war. Mit Ausnahme der erwähnten Strecke nach Thun, sollte
sich Bern jedoch bei der Fahrleitung etwas gedulden müssen, denn in der
Hauptstadt wurden lediglich die Maschinen für den Gotthard erprobt.
Bis zur Aufnahme des offiziellen Betriebs auf der Strecke wurden
die
Lokomotiven
zwischen Wylerfeld und Thun für Schulungen und
Probefahrten
genutzt. Die beiden Maschinen leisteten somit erneut Pionierarbeit, wobei
es jetzt um das Personal der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ging. Sie
müssen sich vorstellen, dass dieses bisher lediglich Dampflokomotiven
kannte und damit wusste umzugehen. Jedoch kamen nun
Spannungen
und
Ströme
in den
Führerstand.
Mit Aufnahme des fahrplanmässigen elektrischen Betriebs zwischen
Bern und Thun beförderten die beiden alten
Lokomotiven
leichte Personenzüge und besorgten gelegentlich auch den
Rangierdienst.
Für Schnell- und
Güterzüge
reichten ihre
Leistungen jedoch schlicht nicht mehr aus. Dazu waren die
Prototypen
der neueren Generation und die abgelieferten ersten gigantischen
Lokomotiven für den Gotthard verantwortlich.
Bei der Maschinen-fabrik Oerlikon wur-de zu jener Zeit die erste Maschine der Reihe Fc 2x 3/4 «Krokodil» gebaut.
Diese später als
Ce 6/8 II bezeichnete
Maschine, hatte eine
Leistung von 1 650 kW. Alleine ein Motor der neuen
Maschinen leistete bereits mehr, als die ganze
Lokomotive
aus dem Versuchsbetrieb. Damit erkennen wir deutlich die damals gemachten
Fortschritte.
Die beiden
Lokomotiven
brachten es im Jahre 1919 auf eine beachtliche Laufleistung von je 18 000
km. Dieser Wert zeigt deutlich, wie intensiv diese alten Maschinen
eingesetzt wurden. Sie funktionierten im Gegensatz zu den anderen Exoten
sehr zuverlässig und sie konnten sich daher für eine kurze Zeit in Szene
setzen. Es war klar, lange wird das nicht so weitergehen können, denn es
wurden neue Lokomotiven erwartet.
Das war es daher auch schon, denn jetzt kamen die fabrikneuen
Baureihen Fb 2x 2/3 (Be 4/6)
und Fc 2x 3/4 (Ce 6/8 II)
in Betrieb. Dabei war bereits bei der Ablieferung klar, dass es nicht bei
diesen beiden Maschinen bleiben würde, denn die ersten Serien wurden
bestellt und sie sollten sich in Bern ausbreiten, bis am Gotthard endlich
umgestellt werden konnte. Mehr oder weniger wurde gewartet, bis dort der
Schalter umgelegt wurde.
Die für den Gotthard bestimmten
Lokomotiven
lösten daher die Maschinen aus dem Versuchsbetrieb ab. Das «Marieli» (12
101) und der «Karli» (12 102), wie die beiden Veteranen liebevoll genannt
wurden, mussten das Feld den neuen stärkeren Lokomotiven räumen. Die
Urahnen hatten vorerst keine geregelte Arbeit mehr und verdienten sich ihr
Gnadenbrot im
Rangierdienst.
Wobei dort auch nicht die grossen Arbeiten anstehen sollten.
Abgeschlossen wurde die Elektrifikation der Schweiz erst, als
nahezu 100% unter
Fahrdraht
waren. Den grössten Schritt dazu schufen die beiden hier vorgestellten
Lokomotiven
aus dem Hause MFO, auch wenn man dort nun ein «Krokodil»
gebaut hatte.
Die beiden Maschinen wurden im Jahr 1920 erneut mit einer neuen
Bezeichnung versehen. Die bisher geführte Lösung war nicht durchdacht
worden. Nun war aber klar, dass die elektrischen
Lokomotiven
nicht mehr zu den Exoten gehörten und daher wurde bei diesen eine neue
Lösung eingeführt. In der Folge sollte es zu einer einfacheren Lesbarkeit
kommen, denn aus den beiden bisherigen Fc 2x 2/2 wurden nun die beiden Ce
4/4.
Neu wurden auch die Nummern. Für die elektrischen
Lokomotiven
wurden neue Muster verwendet. Dabei wurde die zweite Ziffer der neuen
fünfstelligen Nummer verändert. Bei den beiden Maschinen hatte diese
Massnahme jedoch auch Auswirkungen auf die ganze Nummer. Daher wurden sie
nun mit 13 501 und 13 502 versehen. Dabei blieben jedoch die Endziffern
erhalten, so dass wir die Maschinen immer noch unterscheiden können.
Ihre jährlichen
Leistungen sanken jedoch auf rund 1 000 Kilometer. Daran
änderte auch das Jahr 1921 nichts mehr. Die
Lokomotiven waren bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB nur noch als
Rangierlokomotiven
zu
gebrauchen. Die Leistung reichte einfach nicht mehr für höherwertige
Aufgaben. Dort setzte man nun die Reihen Be 4/6 und Ce 6/8 II ein.
Schliesslich hatte man davon genug Maschinen im Bestand.
Im Schlepp einer Dampflokomotive
A 3/5 traten
die Be 4/6 und Ce 6/8 II den langen Weg nach Erstfeld an. Im Schlepptau
dieser Maschinen befanden sich auch die beiden Veteranen. Oft waren diese
sogar noch älter, als die Dampflokomotive, die den Zug zog. Die Lokomotiven wurden nach Biasca versetzt und ka-men somit erstmals in ihrem Leben an den Gotthard. Eine Strecke, für die sie nie gebaut worden waren. Sie sollten dort auch nicht eingesetzt werden, denn am Gotthard wurde nun auch elektrisch rangiert und dazu waren die Lokomotiven geeignet.
Man konnte bei der
Staatsbahn noch etwas warten, bis man die
eigentlichen elektrischen
Rangierlokomo-tiven
beschaffte. In Biasca wurden sie deshalb als Rangierlokomotiven eingesetzt. Für diesen Einsatz reichte die Leistung der beiden Maschinen immer noch aus.
Obwohl
die beiden
Lokomotiven nicht über mangelnde Arbeit klagen konnten, machten
sie so keine Kilometer. Im
Rangierdienst kann man keine grossen Distanzen
zurücklegen, denn viel Arbeit erfolgte lediglich mit kurzen Fahrten über
eine
Weiche und zurück. Das wirkt sich auf den Zähler nicht gross aus.
Nur lange sollten die Maschinen nicht im Tessin bleiben, denn bereits ein
Jahr später änderte man den Plan für die
Lokomotiven erneut. Dabei ging
man rigoros vor und die beiden Schwestern, die seit 1905 immer zusammen
eingesetzt wurden, sollten nun getrennt werden. Es gab für den
Rangierdienst bessere
Bahnhöfe als das Biasca war, auch wenn dort wirklich
schwere Züge zerlegt werden mussten. Doch gerade da war einfach zu wenig
Kraft vorhanden.
1923 trennte man diese beiden Maschinen daher erstmals. Die 13 501 kam
wieder in die deutschsprachige Schweiz und somit nach Erstfeld. Dort
sollte sie dann bis in das Jahr 1938 im
Rangierdienst eingesetzt wurde.
Sie hatte daher ein paar ruhigere Jahre vor sich. Auch wenn Erstfeld
bedeutete, dass man sich auch in Altdorf und Flüelen verdingen musste. Das
ergab jedoch eine leichtere Steigerung bei der jährlichen
Leistung.
Die 20 Jahre alte
Lokomotive zeigte
erstmals ihre Schwächen. Nur 1904 wurde sie schlicht nicht für einen
solchen Einsatz gebaut und nur die Not brachte diese Maschine in den
Rangierdienst auf der
Gotthardbahn, ein Widerspruch in sich. Die 13 502 wurde durch die Schweizerischen Bun-desbahnen SBB erneut umgebaut und erhielt einen Transformator, der auch mit 5 500 Volt betrieben werden konnte.
Dieser Umbau war nötig, weil die
Lokomotive im
Seetal
aushelfen sollte und dort damals war noch eine andere
Spannung und
eine andere
Frequenz von 25
Hertz vorhanden. Damit mutierte diese Maschine
zu einer Lokomotive für zwei Spannungen und zwei Frequenzen.
Aus der ersten
Lokomotive mit Motoren für
Wechselstrom und einer
Spannung
von 15 000
Volt weltweit, wurde nun eine der ersten Zweifrequenzmaschinen
der Schweiz. Seinerzeit hätte lediglich die Schwester (13 501) in der Zeit
mit
Umformer mit zwei unterschiedlichen Spannungen betrieben werden können.
An einen solchen Einsatz dachte damals jedoch niemand. Nur jetzt war die
Nummer 2 an der Reihe mit zwei Systemen.
Stationiert wurde die Nummer 13 502 deshalb in Luzern und wurde ab dort im
Seetal
eingesetzt. Die gefahrenen
Leistungen stiegen damit etwas an. Nur,
das Seetal war eigentlich auch nicht für diese Maschine geeignet. Jedoch
halfen die alten Maschinen erneut in der Not, denn die Umstellung des
Seetals auf das normale System war keine so leichte Aufgabe, wie man
meinen könnte und da war die MFO 2 durchaus ideal geeignet.
Als sie auch im
Seetal
nicht mehr genutzt werden konnte, kam die
Lokomotive wieder zu ihrer Schwester und somit auch nach Erstfeld. Dort
verwendete man die Maschine ab September 1929 unter anderem auch zum
Schweissen von
Schienen. Sie erreichte dabei wieder jährliche
Leistungen
von 10 000 Kilometer, was mehr als das Doppelte der 13 501, die
ausschliesslich in Erstfeld rangierte, war. Sie kam wirklich etwas herum.
Es kamen nun ein paar ruhige Jahre, wo die beiden ungleichen Schwestern
Rangieraufgaben in Erstfeld, Airolo und Altdorf übernahmen. Erst 1938
änderte sich das wieder, dafür grundsätzlich. Neue
Rangierlokomotiven der
Baureihe
Ee 3/3 sorgten dafür, dass man auf die ältesten
Lokomotiven
verzichten konnte. Das waren nun aber nicht mehr nur Dampflokomotiven,
sondern die beiden Maschinen mit Baujahr 1904 und 1905.
Die beiden
Lokomotiven aus dem Versuchsbetrieb gingen nun komplett
getrennte Wege. Einzige Gemeinsamkeit war, dass Sie von den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB letztlich verkauft wurden. Wobei das bei
der 13 502 in mehreren Schritten erfolgte. Letztlich endete somit der
Betriebseinsatz der beiden Lokomotiven mit dem Verkauf an andere
Bahngesellschaften. Nur war die Geschichte der beiden Maschinen nicht
fertig geschrieben.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Noch
vor dem Gotthard sollte daher die Strecke zwischen Bern und Thun mit einer
Noch
vor dem Gotthard sollte daher die Strecke zwischen Bern und Thun mit einer
 Verfügbar
waren zu jener Zeit bei der MFO lediglich die zwei Exem-plare aus dem
Versuchsbetrieb. Diese wurden seinerzeit abgestellt und sie passten zum
System mit
Verfügbar
waren zu jener Zeit bei der MFO lediglich die zwei Exem-plare aus dem
Versuchsbetrieb. Diese wurden seinerzeit abgestellt und sie passten zum
System mit
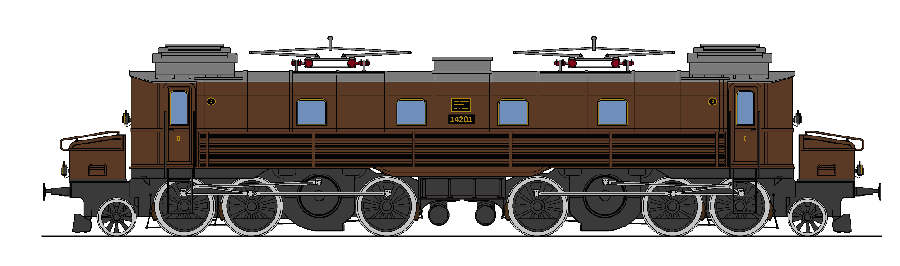 Die
beiden doch nun schon rund 15 Jahre alten
Die
beiden doch nun schon rund 15 Jahre alten
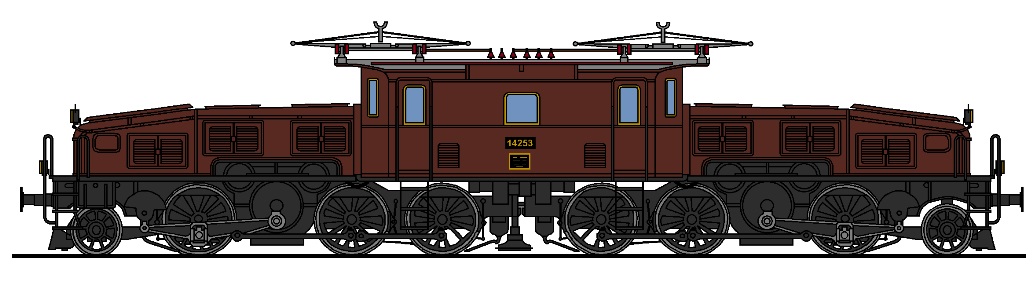 Hier
lohnt sich ein Vergleich. Die beiden Maschinen der MFO hatten eine
Hier
lohnt sich ein Vergleich. Die beiden Maschinen der MFO hatten eine
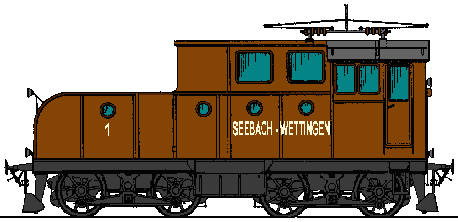 Man
konnte jedoch mit den alten Maschinen wertvolle Erkenntnisse sammeln und
es waren die beiden
Man
konnte jedoch mit den alten Maschinen wertvolle Erkenntnisse sammeln und
es waren die beiden
 Lange ruhig bleiben sollte es in Bern jedoch nicht mehr. Am Gotthard waren
die Arbeiten abgeschlossen worden und so konnten die neuen
Lange ruhig bleiben sollte es in Bern jedoch nicht mehr. Am Gotthard waren
die Arbeiten abgeschlossen worden und so konnten die neuen
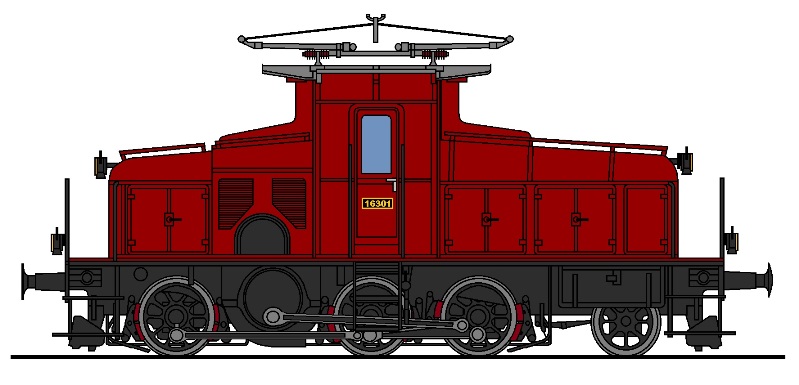 Zu der
Zu der