|
Druckluft und Bremsen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Die Anlage für die
Druckluft
und die pneumatischen
Bremsen
wurde von der Firma Knorr Bremsen AG geliefert. Da der Hersteller der
Ausrüstung bei den Angaben zu diesen aufgeführt wurde, war das bei den
Anschriften zu erkennen. Diese wurden mit dem Kürzel KE angeführt und
damit war dieser Hersteller festgelegt worden. Wir jedoch beginnen auch
hier mit der Herstellung der Druckluft, denn ohne ging schlicht nichts
mehr.
Mit diesem wurde die im
Maschinenraum
bezogene Luft verdich-tet und in die Leitungen entlassen. Auch wenn hier
von einem
Luftpresser
gesprochen wurde, bei der Erzeugung gab es kaum Unterschiede. Speziell war die Ansteuerung des Motors. Auf diese hatte das Lokomotivpersonal keinen Einfluss mehr. Alleine der verbaute Druckschwankungsschalter war zuständig. Bei einem Vorrat von 8.5 bar wurde der Kompressor gestartet und Druckluft erzeugt.
Wurde der
Luftdruck
von zehn
bar
erreicht, stoppte die Anlage wieder. Da jedoch ein Defekt einen
Dauerbetrieb des
Luftpres-sers
zur Folge hatte, musste der Wert im System beschränkt werden. Es waren zwei Überdruckventile verbaut worden. Dabei war je-doch nur eines für den maximalen Luftdruck verantwortlich. Es beschränkte den Wert im System auf zwölf bar.
Damit haben wir nun komprimierte Luft, die so aber noch nicht dem
System zugeführt werden konnte. Luft hatte die Eigenschaft, Wasser bei
sinkendem
Luftdruck
auszuscheiden. Was in der Natur für Wolken sorgt, hat in einem System für
Druckluft
nichts zu verlieren.
Aus diesem Grund wurde dem
Kompressor
ein
Lufttrockner
mit zwei Kammern nachgeschaltet. Dieser entnahm das Kondensat aus der Luft
und leitete dieses einem einfachen Abscheider zu. Dort wurde das
Kondensat
schliesslich wieder in die Umwelt entlassen. Die Probleme von früher
konnten mit neuen
Schmiermittel
eliminiert werden. Daher war die Entlassung kein Problem und wir müssen
das System weiter verfolgen.
Jedoch wurde die
Druckluft
auch be-nötigt, um die
Lokomotive in Betrieb zu nehmen. Aus diesem Grund konnte
der Vorrat mit
Absperrhähnen
einge-schlossen werden. Daher war die nor-male Funktion vorhanden. Bei geöffneten Hauptluftbehälter-hähnen strömte die Druckluft in die Speiseleitung. Da auch hier die üb-lichen Bezeichnungen nicht verwendet wurden, müssen wir uns mit der Hauptluftbehälterleitung befassen.
Da so lange Wörter nicht leicht zu schreiben und zu lesen waren,
wurde sehr oft die Abkürzung
HBL
verwendet. Für uns reicht es jedoch, dass diese HBL der bekannten
Speiseleitung
entsprach und sie auch so aufgebaut wurde.
Neben den anschliessend betrachteten Verbraucher, muss noch
erwählt werden, dass die
HBL
auch zu den beiden
Stossbalken
geführt wurde. Dort teilte sie sich und stand in zwei
Luftschläuchen
mit
Absperrhähnen
bei Bedarf auch der
Anhängelast
zur Verfügung. Zur Kennzeichnung der Leitung wurden der Bediengriff und
die
Kupplung
in weisser Farbe gehalten. Diese Farbe entsprach den internationalen
Normen.
Auf der
Lokomotive wurde sämtlich Verbraucher an dieser Leitung
angeschlossen. Wo der
Luftdruck
nicht passte, wurden nach dem Anschluss
Druckreduzierventile
eingebaut. Eine Lösung, die seit Jahren angewendet wurde und die dafür
sorgte, dass auf eine
Apparateleitung
verzichtet werden konnte. Auch hier war das Gewicht entscheidend und wir
kommen nun zu den Verbrauchern und dabei war der erste Punkt sogar ein
Problem.
Ohne
Energie aus der
Fahrleitung
konnte die
Druckluft
nicht erzeugt werden. Mit der
Speiseleitung,
oder eben mit der
HBL,
konnte der Vorrat von einem anderen
Triebfahrzeug
geliefert werden. Jedoch war nicht gesichert, dass dieses verfügbar war.
Somit musste die dringend benötigte Druckluft mit von der Spannung in der Fahrleitung unabhängigen Lösungen erzeugt werden. Da die von früher be-kannte Handluftpumpe längst nicht mehr zeitgemäss war, wurde ein Hilfsluft-presser eingebaut.
Mit diesem
Hilfsluftkompressor
wurde die
Druckluft
mit einem ab den
Bat-terien
angetriebenen
Kolbenkompressor
erzeugt. So stand dann die Luft für die Bügel zur Verfügung. Aktiviert wurde der Hilfsluftpresser automatisch. War der Vorrat in dem verbauten Hauptluftbehältern auf einen Wert von unter 4.8 bar gesunken, aktivierte sich mit Hilfe der Steuerung der Hilfsluftkompressor. Das
war so lange der Fall, bis die normale Lösung aktiviert werden konnte.
Auch in dem Fall war die Steuerung für die einzelnen Schritte
verantwortlich. Wir haben nun aber in jedem Fall
Druckluft
auf dem Fahrzeug.
Wenn wir nun wirklich zu den von den
Bremsen
unabhängigen Verbrauchern kommen, dann können wir die elektrische
Ausrüstung ausblenden, denn die beiden wichtigen Bereiche
Stromabnehmer
und
Hauptschalter
AC haben wir ja bereits behandelt. Es wird nun aber wichtig, dass wir noch
einige mit
Druckluftt
betriebene bekannte Baugruppen aufgreifen, denn diese funktionierten nur,
wenn Druckluft verfügbar war.
Da davon jedoch acht Stück eingebaut worden waren, führte die
Lokomotive einen Vorrat von 500 Kilogramm mit, was einer
halben Tonne entsprach und eine grosse Menge darstellte. Der Quarzsand aus den Behältern wurde nun mit Hilfe von Druckluft durch die Rohre gepresst und auf die Schienen gestreut. Damit dieser auch auf diesen liegen blieb, wurde die Anlage mit einem Luftdruck von fünf bar betrieben.
Die dabei verteilte Menge war jedoch so gering, dass der Vorrat
für längere Zeit ausreichte und so konnte die Anlage bei Bedarf auch
dauerhaft betrieben werden und das war hier wichtig.
Auch bekannt ist die
Spurkranzschmierung.
Das hier verwendete
Schmiermittel
war sehr zäh, denn es sollte ja nicht gleich abgewaschen werden. Damit
dieses auf die
Spurkränze
gelangte, musste das Mittel mit Hilfe von
Druckluft
durch eine Düse verteilt aufgetragen werden. Wann diese
Schmierung
jedoch erfolgte, war durch die Steuerung geregelt worden. Dabei gab es je
nach Land andere Zeitabstände zu beachten.
Ebenfalls an der
HBL
angeschlossen wurden der Sitz des Lokführers und die auf dem Dach der
Führerkabine
montierten
Makrofone.
Diese elektrisch angesteuerten Bauteile erzeugten einen nach vorne
gerichteten Schall. Dabei waren für das Personal zwei Tonlagen verfügbar.
Das akustische Signal konnte unterschiedlich laut erteilt werden. Die in
der Schweiz bekannte Tonfolge konnte jedoch nur schwer erzeugt werden.
Diese funktionierten auf unterschied-liche weise auf die mechanischen Bau-teile der Bremse.
Dabei beginnen wir auch hier mit der einfacher aufgebauten Lösung.
Es han-delte sich dabei um eine
direkte Bremse,
die nur auf dem Fahrzeug wirkte. Bei der direkten Bremse wurde von einem Bremsventil Druckluft zu den Zylindern geführt.
Da keine weiteren Bauteile dazwischen geschaltet wurden, konnte
diese sehr genau reguliert werden. Der maximal mögliche
Luftdruck
im
Bremszylinder
war auf 3.3
bar
beschränkt worden. Höher musste der Druck wegen den verbauten
Bremsen
nicht angesetzt werden. Ein sehr einfaches
Bremssystem,
das nicht immer angewendet wurde.
Wie die bei älteren
Baureihen
vorhandene
Rangierbremse,
wurde auch die
direkte Bremse
in diesem Bereich eingesetzt. Zudem nutzte man die direkte Bremse um das
Triebfahrzeug
vor ungewolltem losrollen zu schützen. All diese Funktionen wurden bei
mitgeführter
Anhängelast
noch mit der Funktion ergänzt, dass so die
Lokomotive unabhängig von der
automatischen Bremse
arbeiten konnte. Beim kuppeln von Wagen war das wichtig.
Wir hingegen kommen damit zum zweiten auf der
Lokomotive verbauten
Bremssystem.
Bei diesem wurde mit einen
Bremsventil
eine als
Hauptluftleitung
bezeichnete
Hauptleitung
gefüllt. Die
HLL
wurde ebenfalls zu den
Stossbalken
geführt und dort geteilt. Die
Absperrhähne
und die
Kupplungen
waren nun rot behandelt worden. Zudem waren die Kupplungen so angeordnet,
dass die HLL nicht mit der
HBL
vertauscht werden konnte.
War dieser Wert vorhanden, galt diese Bremse als gelöst und wenn in der Leitung kein Luftverlust erkennbar war, galt auch die Bereitschaft.
Wir jedoch haben nun das Problem, denn die
Bremsung
wurde mit einer Absenkung eingeleitet und so konnten die
Zylinder
nicht direkt angesteuert werden. Um die Bremsung mit Druckluft zu er-möglichen, musste bei dieser indirek-ten Bremse ein Steuerventil eingebaut werden.
Gerade dieses
Steuerventil
war so wichtig, dass bei den Anschriften der Hersteller aufgeführt werden
musste. Dabei werden wir nun aber eine Überraschung erleben, denn das hier
verbaute
Ventil
stammte von den modernen Wagen für
Reisezüge und es konnte auch auf ähnliche
Weise eingestellt werden.
Die Einstellmöglichkeiten dieses
Steuerventils
lies die Wirkung der
G-Bremse
des
Güterverkehrs,
der üblichen
Personenzugsbremse
und der
R-Bremse
zu. Diese waren auch wirksam, wenn die
Lokomotive geschleppt wurde. Der Aufbau war zudem so,
dass es sich um ein mehrlösiges
Bremsventil
handelte. Damit hatte die Lokomotive eine klassische Hochleitungsbremse
erhalten, die nun
Druckluft
zu den
Bremszylindern
führte und so wirksam war.
Bevor wir zu den mechanischen Bauteilen kommen, müssen wir noch
die weitere Lösung anzeigen. Bei der
Lokomotive war eine
EP-Bremse
verbaut worden und sie besass die
NBÜ
nach den Standards der Deutschen Bahn DB. Von dieser Seite her konnte mit
der Lokomotive auch ein
Reisezug
ohne grössere Probleme geführt werden. Hinderlich war dabei aber die
Höchstgeschwindigkeit
von 140 km/h, da das zu langsam war.
Eine Rückholfeder sorgte dafür, dass der
Kolben
beim entfernen der Luft in die ursprüngliche Position wech-selte. So weit
waren hier kaum Veränderungen mög-lich, jedoch wurde jedes
Rad
mit einem eigenen
Zylinder
versehen. Dabei waren nicht alle Bremszylinder identisch aufge-baut worden. Bei jeder Achse war bei einem Zylinder noch eine Federspeicherbremse vorhanden. Diese wurde als Feststellbremse der Lokomotive be-nötigt und die Bremse wurde mit der Kraft einer Feder ausgeführt.
Um diese Einrichtung zu lösen, musste in einem
Zylinder
ein
Luftdruck
von 5.5
bar
erzeugt werden. Wie gut diese
Feststellbremse
wirkte, zeigt ein Blick auf die Daten.
Bei der
Feststellbremse
waren die Unterschiede zwischen den Ländern vorhanden. In der Schweiz
konnte damit ein
Bremsgewicht
von 18 Tonnen erreicht werden. Bei den anderen Ländern galt jedoch der
UIC-Wert
von 46 Tonnen. Dieser Wert war auch in der Schweiz vorhanden, er durfte
jedoch wegen den geltenden Regeln nicht angerechnet werden. Doch damit
stellt sich die Frage, mit was für Teilen denn effektiv gebremst wurde.
Wegen dem im
Drehgestell
kaum verfügbaren Platz, wurden
Radscheibenbremsen
benutzt. Bei diesen
Scheibenbremsen
wird die
Bremsscheibe
auf dem Radkörper montiert und die
Bremszange
greift seitlich an diese Fläche.
Bei der Funktion gab es zu den bekannten
Wellenbremsscheiben
keinen Unterschied, auch wenn bei den
Rädern
die thermische Belastung verringert werden musste. Aber das hatte kaum
Auswirkungen.
Um
deren
Leistung
zu erkennen, müssen wir noch die
Bremsrechnung
durchführen. Dazu müssen wir nun aber das Gewicht der
Lokomotive kennen. Bei der
Baureihe
wurde in dem Fall von einem Wert von 87 Tonnen gesprochen. War bei der automatischen Bremse die Güterzugs-bremse aktiviert, konnte für die Bremsrechnung ein Bremsgewicht von 79 Tonnen angerechnet werden. In dem Fall war nun ein Bremsverhältnis von 91 % vorhanden.
Ein für die
G-Bremse
sehr guter Wert, da hier ja nicht die volle Bremswirkung gerechnet wurde.
Auf den Abzug konnte nicht verzichtet werden, da die Berechnungen immer
mit der
P-Bremse
erfolgten.
Wurde die
Personenzugsbremse
angewendet, erhöhte sich das
Bremsgewicht
auf 93 Tonnen. Wenn wir nun die
Bremsrechnung
durchführen, kommen wir auf 106 %. Bei der wirksamen
Bremsstellung
konnte nun aber auch die höhere
Bremsstufe
der
R-Bremse
angerechnet werden. Im dem Fall war nun einen Gewicht von 131 Tonnen
vorhanden. Das ergab ein
Bremsverhältnis
von 150 %, was für eine
Lokomotive des
Güterverkehrs
ein sehr guter Wert war.
Noch höhere Werte konnten bei der
Bremsrechnung
mit der Anrechnung der
elektrischen
Bremse erreicht werden. Zulässig war das aber nur bei der
Personenzugsbremse
und der
R-Bremse.
Diese wurden in der Schweiz jedoch nicht angerechnet und zudem wurde dazu
die elektrischen Ausrüstung benötigt und von dieser kennen wir kaum etwas.
Daher wird es Zeit, wenn wir uns diesem Thema zuwenden, denn der Teil
stellte das grösste Gewicht dar.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 In
einer als eigene Baugruppe ausgeführten Luftaufbereitungsan-lage wurden
die Bauteile für die Erzeugung der
In
einer als eigene Baugruppe ausgeführten Luftaufbereitungsan-lage wurden
die Bauteile für die Erzeugung der
 Die
vom
Die
vom
 Sowohl
die vier
Sowohl
die vier
 Bereits
kennen gelernt haben wir die
Bereits
kennen gelernt haben wir die
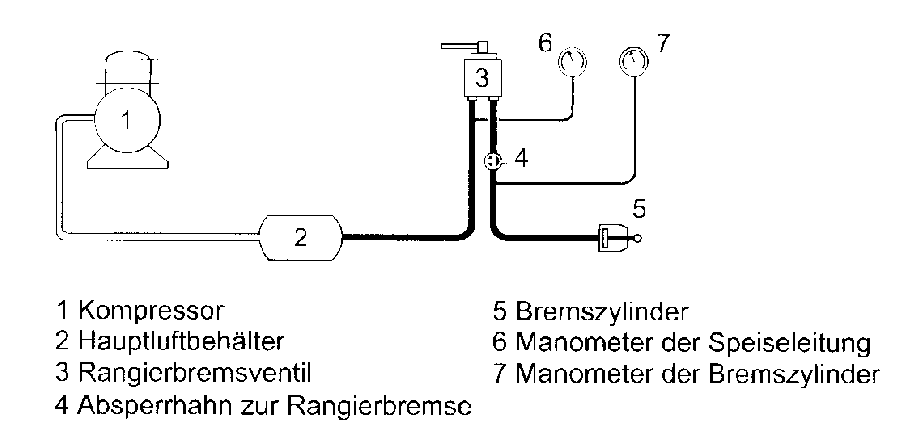 Damit
kommen wir zu den mit
Damit
kommen wir zu den mit
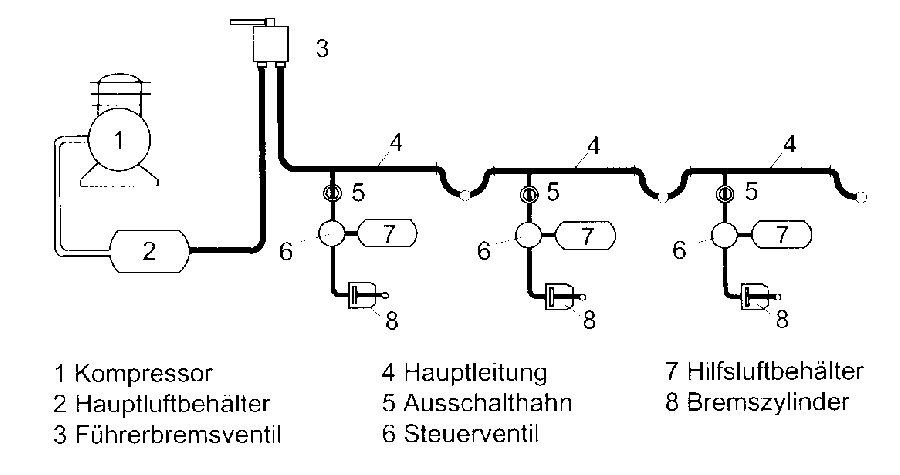 Bei
dieser als
Bei
dieser als
 Um
mit der
Um
mit der
 Da
die
Da
die