|
Einleitung |
|||||||||||
|
|
Navigation durch das Thema | ||||||||||
|
Baujahr: |
2004 |
Leistung: |
6 400 kW / 8 700 PS 1) | ||||||||
|
Gewicht: |
87 t |
V. max.: |
140 km/h | ||||||||
|
Normallast: |
700 t |
Länge: |
19 580 mm |
||||||||
| 1) Unter DC 6 000 kW | |||||||||||
|
Bevor wir uns mit der Vorstellung befassen, muss der Titel erklärt
werden. Bei der vorgestellten
Lokomotive handelt es sich um ein in Europa bei vielen
Güterverkehrsunternehmen eingesetztes
Triebfahrzeug.
Dieses wurde beim Hersteller unter der Bezeichnung ES64F4 geführt und es
war in vielen Konfigurationen erhältlich. Hier vorgestellt wird jedoch nur
die Ausführung, die bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingesetzt
wurde.
Die von den schweizerischen
Staatsbahnen
vergebene Bezeichnung lautete Re 474. Als dieser Artikel entstand, waren
von der
Baureihe
ES64F4 bei den in der Schweiz registrierten
EVU
nur diese Maschinen vorhanden. Anderen Verkehrsunternehmen setzten oft
auch gemietete Modelle ein, die jedoch nicht in der Schweiz geführt
wurden. Mit Ausnahme der genauen Konfiguration entsprachen diese jedoch
den hier vorgestellten Maschinen.
Nur schon der Hinweis, dass es verschiedene Konfigurationen davon
gab, macht natürlich neugierig. Um es etwas vereinfachter aufzuzeigen,
dann erwähne ich, dass die
Baureihe
Re 474 eine Variante davon war. Genauer waren bei der Re 474 die Varianten
VE, VD und VF vorhanden. Warum es diese drei waren ist, dass nur bei
diesen Konfigurationen in der Schweiz gefahren werden durfte und das war
eine wichtige Bestimmung.
Bevor Sie befürchten, dass Ihnen etwas entgehen könnte, muss ich
erwähnen, dass sich die Unterschiede auf die Ausrüstung mit den
Zugsicherungen
und den auf dem Dach montierten
Stromabnehmer
beschränkten. Je nach geplantem Einsatz gab es dann noch kleinere
Anpassungen. Einige davon betrafen auch die Reihe Re 474, die hier
effektiv vorgestellt wird. Wie die
Lokomotive ausgerüstet wurde, war an einem Raster zu erkennen.
Ein Raster, das natürlich nur erkannt werden konnte, wenn man vor
der
Lokomotive stand. Die vorher erwähnten Konfigurationen sind da
aussagekräftiger. Um nicht lange Texte zu erfassen, bei denen keine für
die hier vorgestellte
Baureihe
wichtigen Hinweise vorhanden sind, sehen wir uns diese Konfigurationen in
einer einfachen Tabelle an. Sie können dann schnell erkennen, welche
Version bei Ihnen vor Türe zu sehen war.
|
|||||||||||
|
Land |
VL |
VE |
VD |
VI |
VH |
VJ |
VM |
VO |
VP |
VR |
VF |
|
D |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||
|
CH |
X |
X |
X |
||||||||
|
PL |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
CZ |
X |
||||||||||
|
SK |
X |
||||||||||
|
H |
X |
||||||||||
|
B |
X |
||||||||||
|
I |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
NL |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
Einige Punkte in der Tabelle müssen wir genauer ansehen. Die scheinbar identischen Vesionen VD und VF unterscheiden sich bei der Zulassung, jedoch nicht in der Technik. Die Versionen VJ und VK besitzen jedoch technische Unterschiede bei gleicher Zulassung. Sie sehen, diese doch recht umfangreiche Tabelle kann nicht alle vorhandenen Möglichkeiten sauber aufzeigen.
Die Reihe Re 474 war, wie wir schon wissen eine Variante davon.
Genau genommen haben wir hier die Konfiguration VF erhalten. Bei dieser
war, wie die Tabelle zeigt auch eine
Zulassung
für Deutschland vorhanden. Die letztlich vom Lieferanten an die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgelieferte Variante hatte jedoch keine
Zulassung für Deutschland erhalten und würde so eine eigene Konfiguration
darstellen.
Wobei die Bedingungen für die Niederlande natürlich nicht
berücksichtigt wurden, denn dort sollten die Mo-delle ja nicht eingesetzt
werden. Jedoch stellt sich so auch die Frage, warum es diese Konfiguration
bei den
Lokomotiven gab und dazu müssen wir an den Anfang.
Beginnen wir mit der Entstehung und dabei müssen wir nach
Deutschland gehen, denn die Wurzeln sind dort zu finden und genauer bei
der Deutschen Bahn DB. Viele Jahre bevor der heute bekannte Verkehr
entstand, musste bei der
Staatsbahn
von Deutschland eine Modernisierung vorgenommen werden. Die meisten
Baureihen
waren seit Jahren im Einsatz und kamen langsam an das Ende der
Lebensdauer, die überall vorhanden ist. Diese Modernisierung startete in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ein umfangreiches Programm zur Erneuerung des Parkes bei den Lokomotiven. Dabei wurden für den Verkehr im Land drei verschiedene Modelle definiert. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass die Bespannung der Züge im Gegensatz zur Schweiz nicht immer mit universellen Lokomotiven erfolgte. Diese gab es zwar, aber auch klassische Lösungen waren vorhanden.
Für den Verkehr mit
Schnellzügen
wurde eine neue
Schnellzugslokomotive
benötigt. Diese klassische Schnellzugslokomotive wurde damals in
Deutschland immer noch für den hochwertigen Verkehr vorgesehen und damit
musste mit den Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreicht werden.
Die höheren Tempi wurden auch in Deutschland von
Triebzügen
übernommen. Diese waren als
ICE
allgemein bekannt geworden.
Die
Anfahrzugkraft sollte bei 300 kN liegen und es sollten nur noch vier
Triebachsen
verbaut werden. Als Vergleich kann hier die in der Schweiz einge-setzte
Reihe
Re 460 genommen werden. Hersteller dieser neuen Schnellzugslokomotive sollte die Firma Adtranz werden. Da sich in diesem Namen auch die Erbauer der erwähnten Lokomotive in der Schweiz befanden, kann durchaus angenommen wer-den, dass auf diesen Erfahrungen aufgebaut wurde.
Viele Daten passten und da später die
Höchstge-schwindigkeit
auf 220 km/h angehoben wurde, kann von einer vergleichbaren
Baureihe
gesprochen wer-den.
Zu einem Verkauf dieses Modells an ein schweizerisches
EVU
sollte es jedoch nicht kommen, da bei den betreffenden Bereichen mit den
Baureihen
Re 460 und
Re 465 schon Maschinen vorhanden
waren. Später sollten sich in diesem Bereich auch die
Triebzüge
durchsetzen, so dass es zu keiner Weiterentwicklung der Baureihe BR 101
gekommen war. Damit belschiessen wir die
Schnellzugslokomotive
und kommen zum zweiten Modell.
Für den leichten
Güterverkehr
und den Einsatz im
Personenverkehr
sollte eine weitere
Lokomotive entwickelt werden. Diese wurde als
Baureihe
BR 145 geführt und sie wird insofern spannend, dass von diesem Muster auch
Maschinen in die Schweiz kamen. Vom
EVU
Lokoop wurden Maschinen der Reihe BR 145 beschafft und als Re 486 geführt.
Diese kamen später als Re 481 zu den Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Wegen der geringen Leistung entstand eine leichte Lokomotive, die dann in einer grossen Stückzahl ge-baut wurde.
Jedoch war sie wegen diesem geringen Gewicht auch für die weitere
Entwicklung geeignet und das sollte sich dann auf den grossen Erfolg
auswirken. War bei der Reihe BR 145, oder später BR 146, noch das leichte Gewicht wichtig, wurde das später aufge-geben. Leicht sollte die Lokomotive sein, damit sie auch auf Nebenbahnen eingesetzt werden konnte.
Wie in der Schweiz hatten diese auch in Deutschland einen
schwächeren
Oberbau
erhalten und daher konnten schwere
Lokomotiven nicht verwendet wer-den. Auch ein Grund um auf
universelle Modelle zu verzichten.
Als Muster wurde dafür die von der Firma AEG auf eigene Rechnung
entwickelte
Lokomotive der Reihe BR 128 genommen. Diese war in der neuen
Firma vorhanden und sie konnte ohne Probleme leichter gebaut werden. Das
erlaubte dem Hersteller Adtranz, die Lokomotive mit sehr vielen
Optionen
vorzusehen. Damals noch nicht geläufig war für diese sehr leichte Maschine
für
Nebenbahnen,
die Bezeichnung als TRAXX.
Später offiziell überall als
TRAXX bezeichnet, sollte aus der einfachen BR 145 eine
Mehrsystemlokomotive
gebaut werden. Mit höherer
Leistung
und einem zweiten
Stromsystem
sollte so auch nach Frankreich gefahren werden. Es war der Ersatz für die
dort eingesetzte BR 181 und daher wurde dieses Muster zur BR 185. Mit
einer leichten Anpassung kamen diese auch in die Schweiz und wurden dort
als Reihen
Re 482 (SBB) und Reihe
Re 485 (BLS) geführt.
Diese war für den schweren
Güterverkehr
vorgesehen und damit war auch eine entsprechende Anpassung vor-genommen
worden.
Güterzüge
verkehrten langsamer und daher konnte die
Höchstgeschwindigkeit
auf 140 km/h gesenkt werden. Das wurde auch von der Deutschen Bahn DB erkannt und daher sollte die neue für den Güterverkehr gebaute Lokomotive eigentlich ein Modell der Reihe BR 101 sein, aber nur mit der Höchstgeschwindigkeit der Reihe BR 145 versehen werden.
Für eine
Güterzugslokomotive
waren schon immer ein hohes Gewicht und eine sehr hohe
Anfahrzugkraft ge-fragt. Daher waren hier bisher sehr oft Modelle mit
sechs
Triebachsen
üblich. Damit wir die Schweiz nicht gerade vergessen, sei er-wähnt, dass man hier in den flacheren Gebieten durch-aus von Werten sprach, die der Reihe Ae 6/6 entspra-chen.
Die als universale
Baureihe
für hohe
Zugkräfte
auch bei hohem Tempo gebaute
Baureihe
Re 6/6 spielte in einer eigenen
Liga, denn sie war eine sehr universell gebaute
Lokomotive. So etwas sollte es nicht mehr geben, denn die
Vorzeichen passten nicht.
Mit der neuen vierachsigen
Lokomotive sollten gemäss Deutscher Bahn DB die damals im
Güterverkehr
eingesetzt schweren sechsachsigen
Baureihen
abgelöst werden. Mit einer
Leistung
von 6 400 kW und einem hohen
Adhäsionsgewicht
versehen, war sie ideal für den geplanten Einsatz gerüstet und dabei war
spannend, dass es dafür bereits ein Muster gab und dieses sollte für die
hier vorgestellten Maschinen ausschlaggebend sein.
Speziell dabei war, dass dieses Modell in der Schweiz vorgestellt
wurde. Das erfolgte im Rahmen der Beschaffung von neuen
Lo-komotiven für den Huckepack-Korridor. Damals verlor Siemens
gegen die Reihe
Re 460.
Mit der daraus entwickelten BR 152 gelang jedoch der grosse Wurf.
Die nun für die Deutsche Bahn DB gebaute
Lokomotive hatte jedoch ein Nachteil, denn es handelte sich um
eine
Baureihe,
die für ein
Stromsystem
vorgesehen war und wegen dem sehr hohen Gewicht konnte eine Anpassung
nicht so leicht erfolgen, wie bei der Konkurrenz und der Reihe BR 145. Es
musste über die Bücher gegangen werden, um international Erfolg zu haben.
Aus der BR 152 wurde daher von der Firma Siemens die Baureihe BR
189 entwickelt. Intern als ES64F4 bezeichnet war so eine
Mehrsystemlokomotiven
entstanden. Dabei beruht die Bezeichnung auf Abkürzungen und steht für
Eurosprinter (ES), 64 (6 400 kW), Fracht (F) und 4 für die verbauten vier
Stromsysteme.
Damit haben wir die
Lokomotive erhalten und nun kommen wir unweigerlich zur Frage,
wie sie letztlich in die Schweiz kam.
Bevor wir das jedoch ansehen, kam ein neues Geschäftsfeld zum
Einsatz. Was bei Fahrzeugen der Strasse schon länger üblich war, sollte
nun auch bei den Bahnen Einzug halten. Firmen die
Lokomotiven vermieteten wurden ins Leben gerufen. Anfänglich
gedacht, um kurze Spitzen beim Verkehr aufzufangen, entwickelte sich
daraus ein lukrativer Markt mit Mietlokomotiven, der besonders von
kleineren
Eisenbahnverkehrsunternehmen
genutzt wurde.
Diese umfassten Veränderungen bei den verbauten
Zugsicherungen
und bei den
Stromabnehmern,
die an die
Fahrleitungen
angepasst werden mussten. Wenn wir damit zu SBB
Cargo
kommen, dann liegen wir nicht so falsch. Nach dem Wechsel ins neue Jahrhundert veränderte sich bei den Bahnen sehr viel. Der internationale Verkehr sollte an der Grenze nicht mehr umge-spannt werden. Lokomotiven sollten den Zug über längere Strecken bespannen.
Dazu nutzte SBB Cargo die Modelle
Re 482, die so-wohl in der Schweiz,
als auch in Deutschland ein-gesetzt wurden. Da der
Verbund
von drei
Bahnge-sellschaften
gescheitert war, fuhr man auf eigene Rechnung.
Geblieben war nur noch der Lokomotivwechsel zu Italien. Gerade
dort waren aber die Probleme gross.
Güterzüge,
die nördlich der Alpen beschleunigt werden konnten, blieben oft an der
südlichen Grenze stehen, weil sich bei Trenitalia keine
Lokomotiven, oder kein Personal finden lassen wollten. Das war
für den Verkehr nicht gut. Auch von der Politik angestrebte Bemühungen zur
Verbesserung brachten nicht viele Verbesserungen.
SBB
Cargo
hatte im Jahre 2003 die Zusammenarbeit mit Trenitalia aufgekündigt und
wollte nun selber in Italien operieren. Die Gründe für diesen Schritt,
sollten hier nicht näher erläutert werden. Es reicht, dass man mit sehr
kurzen Lieferzeiten arbeiten musste. Lange Entwicklungen konnte man sich
nicht leisten. Somit benötigte das Unternehmen bestehende
Lokomotiven die in den beiden Ländern verkehren konnten.
|
|||||||||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
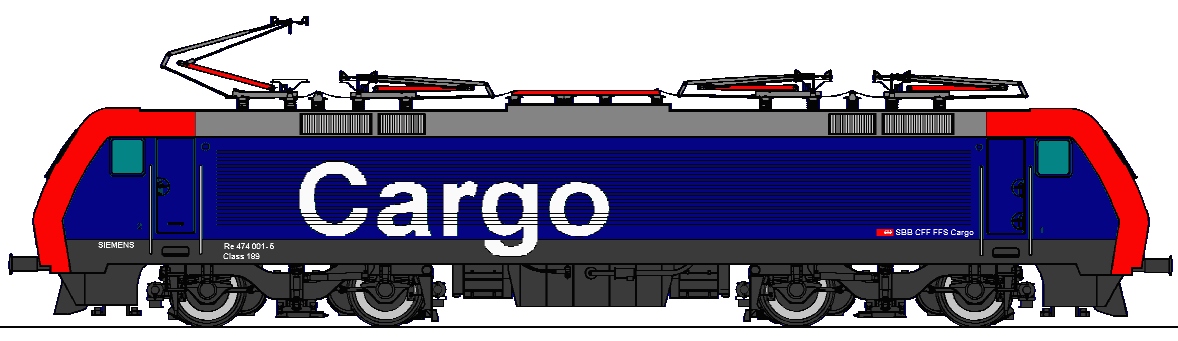
 Welche
der vielen Konfigurationen für unsere
Welche
der vielen Konfigurationen für unsere
 Die
als
Die
als
 Die
Reihe BR 145 wurde wegen dem geplanten Ein-satz mit einer
Die
Reihe BR 145 wurde wegen dem geplanten Ein-satz mit einer
 Beide
erwähnten
Beide
erwähnten
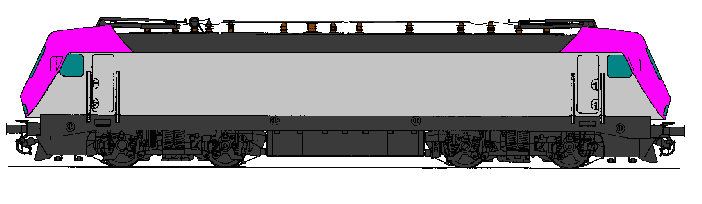 Die
Firma Siemens hatte auf eigene Rechnung einen
Die
Firma Siemens hatte auf eigene Rechnung einen
 Um
mit wenigen Modellen einen breiten Markt ab-decken zu können, wurden vom
Vermieter Dispolok einige Maschinen der
Um
mit wenigen Modellen einen breiten Markt ab-decken zu können, wurden vom
Vermieter Dispolok einige Maschinen der