|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie kompliziert die Herstellung von
Druckluft
sein konnte, zeigten diese Maschinen. So gab es für die Erzeugung der
Druckluft effektiv zwei unterschiedliche Lösungen. Gemeinsam dabei war,
dass der für die Herstellung benötigte
Kompressor
im
Vorbau
der Seite II eingebaut wurde. Dort wurde die benötigte Luft über die
Jalousien angezogen und im Raum etwas beruhigt. Es stand daher nicht mehr
der ganze
Maschinenraum
zur Verfügung.
Dieser arbeitete mit zwei Stufen und verdichtete so die Luft in
der Niederdruckstufe zuerst auf zwei
bar.
In der zweiten Stufe wurde schliesslich der Druck auf acht bar gesteigert.
Der maximal für diesen
Kompressor
zulässige Druck betrug jedoch zehn bar. Wenn wir nun die oben vorhandenen Lücken füllen, kom-men wir zu den restlichen Maschinen dieser Baureihe. Hier wurde ein veränderter Kompressor eingebaut. Dieser verdichtete die Luft nicht mehr, sondern schöpfte diese mit Hilfe von Kolben in die Leitung.
Daher wurde dieser
Kompressor
auch als
Kolbenkom-pressor
bezeichnet. Der zulässige Druck lag jedoch auch hier bei zehn
bar,
wobei der betriebliche Druck tiefer an-gesetzt wurde. Die von den beiden Modellen in die Leitung geschöpfte Luft wurde wieder entspannt. Dadurch schied diese Was-ser aus. Dieses entstand durch die Luftfeuchtigkeit.
Zusammen mit den
Schmiermitteln
des
Kompressors
bildete dieses Wasser eine Emulsion, die nicht in die weitere Leitung
gelangen sollte. Daher führte man die Luft nun an einem Ölabscheider
vorbei. Dort sammelte sich das Konzentrat und konnte in der Werkstatt
abgelassen werden.
In dieser Leitung, die zu den beiden
Hauptluftbehältern
führte, war auch das
Überdruckventil
eingebaut worden. Dieses kontrollierte den Druck in der Leitung. Dabei
öffnete es sich, wenn der Druck auf einen Wert von über acht
bar
angestiegen war. Wobei diese
Ventile
so eingestellt wurden, dass ein um 20% höherer Druck zugelassen war. Damit
konnte die Leitung auf nahezu zehn bar gefüllt werden. Nenndruck war
jedoch acht bar.
Damit die Luft nicht mehr über den
Kompressor
ent-weichen konnte, wurde in der Zuleitung ein Rückschlag-ventil montiert.
Die davon abgehenden Leitungen zu den Verbrauchern besassen jedoch
Absperrhähne,
die sich unmittelbar bei den Behältern befanden. Von den Hauptluftbehältern wurde die Druckluft schliess-lich zu den Bremsventilen und zu den restlichen Ver-brauchern geführt. Die Leitung zu den Verbrauchern wur-de auf der Lokomotive als Speiseleitung bezeichnet.
Dabei war die Leitung mit einem Druck von bis zu acht
bar
auf die
Lokomotive
beschränkt. Damals wurde diese Leitung noch nicht für Funktionen der Wagen
benötigt, so dass sie auf die Lokomotive beschränkt blieb. Direkt an dieser Speiseleitung der Lokomotive ange-schlossen wurden nur wenige Verbraucher, diese konnten mit unterschiedlichen Drücken arbeiten.
Das waren die
Antriebe
der
Scheibenwischer,
die
Sander
und die auf dem Dach der
Führerstände
montierte
Lokpfeife.
Letztere konnte mit einem
Ventil
in der Leitung vom Personal angesteuert werden. Je nach
Zugkraft
am Bedienhebel des Ventils, entstanden so die geänderten Töne an der
Lokpfeife.
Jedoch soll uns das noch nicht weiter beschäftigen, denn auch an dieser Leitung angeschlossen wurden die auf dem Dach montierten Stromabnehmer. Es wurde daher Druckluft benötigt um die Stromabnehmer zu heben.
Damit diese auch gehoben werden konnten, wenn keine
Druckluft
vorhanden war, wurde in der Leitung zu den
Stromabnehmern
eine
Handluftpumpe
montiert. Mit dieser konnten die Bügel gehoben werden. Damit nicht die
ganze
Lokomotive
gefüllt werden musste, war ein Umschalthahn vorhanden. So wurde an der
Handluftpumpe lediglich die Leitung zum Stromabnehmer angeschlossen.
Der grösste Verbraucher von
Druckluft
waren jedoch die eingebauten
Druckluftbremsen.
Diese wurden direkt von den
Hauptluftbehältern
über eine eigene Leitung angeschlossen. Ein
Ventil
in der Leitung diente dazu, dass die Versorgung der
Bremsventile
im unbesetzten
Führerstand
abgetrennt werden konnte. Dieser
BV-Hahn
befand sich jedoch unmittelbar bei den entsprechenden Ventilen, die in
jedem Führerstand identisch waren.
Das einfachere
Bremssystem
der
Lokomotive
war die
Regulierbremse.
Diese wurde über das entsprechende
Bremsventil
mit mehr oder weniger Druck in der Leitung versorgt. Der maximal zulässige
Druck in dieser Leitung wurde mit 3.6
bar
angegeben und entsprach somit nicht mehr den anderen damaligen Baureihen
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Speziell bei dieser
Bremse
war hingegen, dass die Regulierbremse nur auf die vier
Triebachsen
wirkte.
Jedoch wurde die Leitung der
Regulierbremse
zu den beiden
Stossbalken
geführt. Dort teilte sie sich, so dass jeweils zwei Schläuche verwendet
werden konnten. Die Leitungen bei den Stossbalken besassen spezielle rot
eingefärbte
Kupplungen
mit Rückschlagventil. Dieses
Ventil
verschloss die Leitung im ungekuppelten Zustand und wurde jedoch
automatisch geöffnet, wenn die Leitungen verbunden wurden. Dadurch war es
keine Sicherheitsbremse.
Sie wurde im besetzten Führerstand über ein Führerbremsventil W4 mit einem maximalen Druck von fünf bar gefüllt.
War
die
Hauptleitung
mit diesem Druck gefüllt, waren die
Bremsen
der
Lokomotive
und der angehängten Fahrzeuge gelöst und betriebsbereit. Für die angehängten Fahrzeuge wur-den die Leitungen zu den Stossbalken geführt und stand in zwei Schläuchen bereit.
Diese hatten offene rote
Kupplungen
und beim
Stossbalken
identisch ge-färbte
Absperrhähne.
Die Kupplungen waren zudem so ausgelegt worden, dass sie sich bei einer
Zugstrennung
ohne Schaden öffnen konnten. Damit war die
Hauptleitung
jedoch nicht mehr dicht und die
Druckluft
entwich daraus.
Um
eine Bremsung mit diesem
Bremssystem
einzuleiten, musste der Druck abgesenkt werden. Damit nun aber auf der
Lokomotive
eine Bremsung einsetzte, wurden zwei
Steuerventile
der
Bauart
Westinghouse
benötigt. Diese reagierten auf den Druckabfall in der
Hauptleitung
und versorgten die
Bremszylinder
aus einen Hilfsluftbehälter mit der benötigten
Druckluft.
Der bei dieser
Bremse
maximal zulässige Druck im Bremszylinder betrug 3.6
bar.
Stieg der Druck in der
Hauptleitung
wieder an, steuerten die
Steuerventile
um und die
Bremse
wurde vollständig gelöst. Das fand auch statt, wenn die Hauptleitung nicht
auf den normalen Wert erhöht wurde. Aus diesem Grund, wurde in den
Handbüchern bei den hier verwendeten Steuerventilen von einlösigen
Bremsventilen
gesprochen. Die
Lokomotive
konnte jedoch jederzeit mit der
Regulierbremse
abgebremst werden, so dass immer eine Bremse vorhanden war.
Wurde der Umstellhahn betätigt, wurde dieses
Steuerventil
nicht mehr angesteuert. Daher war es nur aktiv, wenn der Griff des
Umstellhahnes auf der
Personenzugsbremse
und damit auf der normalen
Westinghousebremse
stand. War die normale P-Bremse aktiviert, wurden von den beiden Steuerventilen die Bremszylinder der Triebachsen und der Laufachsen im Drehgestell mit Druckluft versorgt.
Die
einzelne
Laufachse
auf der Seite zwei der
Lokomotive
war hingegen nicht mit einer
Bremse
ausgerüstet worden, was in der Schweiz jedoch üblich war. Somit waren von
den sieben
Achsen
deren sechs abgebremst worden, was damals einer guten Bremse entsprach.
Wurde das
Steuerventil
auf die
G-Bremse
umgestellt, wurden die
Bremszylinder
mit dem gleichen Druck von 3.6
bar
gefüllt. Da nun aber das Steuerventil der
Bremsen
im
Drehgestell
nicht angesteuert wurde, waren nur noch die beiden Bremszylinder der vier
Triebachsen
vorhanden. Dadurch wurde durch Wegfall eines Teils der
Bremsklötze
die
Bremskraft
mit der
Güterzugsbremse
reduziert. Ein Vorgang, der jedoch auch einsetzte, wenn die
Lokomotive
geschleppt wurde.
Von
den pneumatischen
Bremsen
wurden die zwei
Bremszylinder
der
Triebachsen
in jedem Fall angesteuert. Bei der
automatischen Bremse
wurde zudem bei Anwendung der
P-Bremse
auch das
Laufdrehgestell
angesteuert und somit gebremst. Dort waren ebenfalls zwei Bremszylinder
eingebaut worden. Beginnen wir die Betrachtung der mechanischen Bremsen
dieser
Lokomotive
jedoch mit den vier Triebachsen und den dort verwendeten beiden
Bremszylinder.
Dabei konnte dieses Bremsgestänge mit der Hilfe eines eingebauten Gestängestellers manuell an die Abnützung der Bremsbeläge angepasst werden.
Diese Lösung entsprach den damaligen Standards und wurde daher auch hier
verwendet. Deshalb musste die
Lokomotive
regelmässig in den Unterhalt. Die Triebachsen wurden mit Bremsklötzen, die auf die Laufflächen wirkten, an der freien Drehung gehindert. Diese Bremsklötze wirkten von jeder Seite auf ein Rad. Damit besass jede Triebachse vier Bremsklötze.
Für
die
Lokomotive
bedeutete das hingegen, dass 16
Bremsklötze
bei den
Triebachsen
vorhanden waren. Da-mit diese im gelösten Zustand nicht auf der
Lauffläche
auflagen, war im
Bremszylinder
eine Rückholfeder ein-gebaut worden.
Da
sich die
G-Bremse
auf diese vier
Triebachsen
beschränkte, können wir die Werte dieser
Bremse
bereits bestimmen. Bei der G-Bremse wurde ein
Bremsgewicht
von 78 Tonnen für die
Lokomotiven
der BBC und der SAAS angegeben. Bei den etwas schwereren Modellen aus dem
Hause MFO galten in diesem Fall 80 Tonnen für die G-Bremse. Damit
erreichten jedoch alle Lokomotiven dieser Baureihe bei der G-Bremse ein
Bremsverhältnis
von rund 65%.
War
die
P-Bremse
eingeschaltet, wurde auch das
Laufdrehgestell
angesteuert. Hier wurden ebenfalls zwei
Bremszylinder
eingebaut. Wegen dem Platz konnte hier jedoch kein normales
Bremsgestänge
eingebaut werden. Daher drückte jeder Bremszylinder je ein
Bremsklotz
an die beiden
Laufachsen.
Dabei waren diese auf beiden Seiten vorhanden, so dass hier zusätzlich
noch vier weitere Bremsklötze vorhanden waren.
Bei
den Maschinen aus dem Hause MFO wurde ebenfalls eine Steigerung von sechs
Tonnen erreicht. Daher hatten diese
Lokomotiven
ein
Bremsgewicht
von 86 Tonnen er-reicht. Das
Bremsverhältnis
der
P-Bremse
betrug daher 70%. Da sowohl die Regulier- als auch die Westinghousebremse nicht wirksam waren, wenn keine Druckluft vorhanden war, musste die Lokomotive mit einer rein mechanisch wirkenden Bremse ausgerüstet werden.
Dazu wurde in jedem
Führerstand
eine einfache
Hand-bremse
eingebaut. Zur
Sicherung
war bei der Kurbel eine Arretierung vorhanden, so dass diese Handbremse im
Stillstand zur Sicherung der
Lokomotive
benutzt werden durfte. Die Handbremse wirkte jeweils auf das benachbarte Bremsgestänge der Triebachsen. Damit konnten sämtliche Triebachsen auch von Hand abgebremst werden.
Da von Hand jedoch nicht die Kräfte der pneumatischen
Bremse
erzeugt werden konnten, wurden für jede
Handbremse
nur 27 Tonnen als
Bremsgewicht
angegeben. Für die
Lokomotive
bedeutete das, dass mit beiden Handbremsen ein Bremsgewicht von 54 Tonnen
erreicht wurde.
So
erreichte die
Lokomotive
trotz des hohen Gewichtes ein gutes
Bremsgewicht
für die
Handbremse,
was gerade bei steilen Strecken, wie es sie am Gotthard und Simplon gab,
vorteilhaft war. Die Maschinen der Baureihe Ae 4/7 durften daher auf dem
gesamten Netz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ohne Beschränkungen
abgestellt werden. Wobei dazu meistens die flacheren Bereiche der
Bahnhöfe
und
Depots
genutzt wurden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bei
den
Bei
den
 Die
im
Die
im

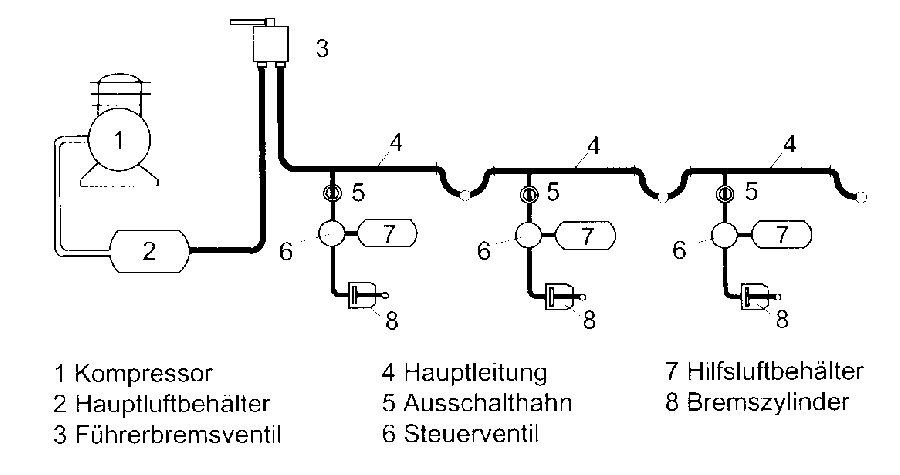 Das
zweite auf der
Das
zweite auf der
 Das
einlösige
Das
einlösige
 An
den beiden
An
den beiden 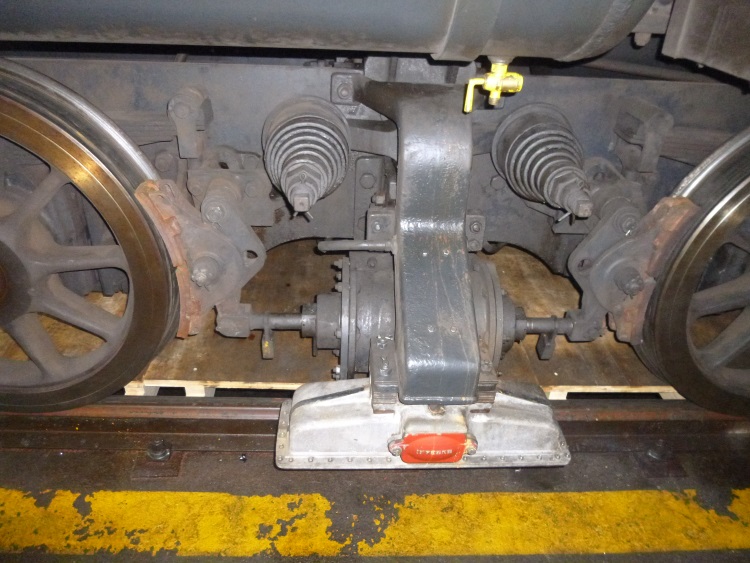 Durch
die zusätzlichen
Durch
die zusätzlichen