|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die
Lokomotive
war ein
Prototyp,
der nie in Serie gebaut wurde. Daher verwundert es eigentlich nicht, dass
an der Maschine sehr schnell viel verändert und verbessert wurde. Oftmals
waren das noch Mängel, die zu beheben waren. So auch die hier nicht
vorhandene
elektrische
Bremse. So wollten die
Staatsbahnen
die Lokomotive nicht übernehmen. Es wurde schnell eine solche Anlage
eingebaut und dann ein neuer Versuch unternommen.
So wurden zum Beispiel auch bei anderen
Baurei-hen
erkannte Mängel sehr schnell behoben und be-seitigt. Es lohnt sich, wenn
wir uns mit diesem Thema etwas genauer befassen. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum ich bei den Neben- und Hilfsbetrieben die Zugsheizung nicht grosss erwähnt hatte. Die Idee der Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB wurde schneller über den Haufen geworfen, als die Hersteller die Loko-motiven bauen konnten.
Mit anderen Worten, es wurde eine elektrische
Zugsheizung
benötigt und das auch bei den
Güterzugslokomotiven,
auch wenn diese kaum vor
Reisezügen
verkehren sollten. Dazu wurde im Transformator an einer Anzapfung die Spannung von 1000 Volt abgenommen und ein-em Heizhüpfer zugeführt.
Dort konnte die Einrichtung ein- oder ausgeschaltet werden. Unter
dem rechten
Puffer
befand sich dann die
Heizsteckdose.
Spannend dabei war, dass nur eine
Spannung
vorhanden war und nicht eine Umschaltung auf 800
Volt
erfolgte. Es klingt simpel, denn dazu gab es keine passende
Anzapfung.
Wir kommen noch einmal zur
elektrischen
Bremse. Diese hastig noch eingebaute Einrichtung war
nur bei einem
Drehgestell
vorhanden. Mit der Übergabe musste diese noch komplettiert werden. Erst
jetzt stand die gigantische
Leistung
dieser
Rekuperationsbremse
auch zur Verfügung. Sie konnte nun zeigen, was sie konnte. Nicht unbedingt
viel Freude mit diesen
Bremskràften
hatten die
Stangenpuffer,
denn die wurden leicht verbogen.
Wenn
es dann einen Einschlag gab, verhinderte die
Spule
nicht, dass der
Hauptschalter
wegen dem höheren
Strom
ausgeschaltet wurde. Die Schäden waren zwar vorhanden, aber nicht so
gross, dass sich die blöde Spule rechnete. Damit hätten wir die ersten Änderungen bereits kennen gelernt. Die Lokomotive funktionierte daher recht gut und es war auch kein so grosser Verlust für die BBC, dass die Serie nicht kam. Man
konnte in Münchenstein die
Schnellzugslokomotive
bauen und das war auch nicht schlecht. Abgesehen von der
elektrischen
Bremse war die nahezu gleich aufgebaut worden. Dank
einer
Triebachse
weniger fand das
Lauf-werk
unter dem Kasten platz. Die Laufeigenschaften der Lokomotive liessen aber trotz der verbauten Laufachse zu wünschen übrig, so dass ihr schnell der Spitzname «Schlotterbeck» angehängt wurde.
Noch waren die vier vorhandenen Koffer nicht direkt für den
Spitznamen verantwortlich. Der erwähnte Begriff lässt aber erkennen, dass
es wohl keine ruhige Fahrt gewesen war. Die nicht ausgeglichen
Achslasten
wirkten sich aus, die
Laufachse
wirkte so nicht optimal.
Zudem bemängelte das
Lokomotivpersonal
die extrem unübersichtliche
Lokomotive.
Wir erinnern uns, dass es in der Fronttüre kein Fenster gab. Die Signale
waren deswegen nicht besser zu erkennen, als bei den
Dampfmaschinen.
So wurde zur Verbesserung in der
Fronttüre
ein zusätzliches Fenster vorgesehen. Es wurde etwas übersichtlicher. Das
auch, weil das Personal nicht begreifen konnte, warum nicht links bedient
wurde.
Diese wurden ausgerechnet bei der nun als Ce 6/8 I bezeichneten
Maschine getestet. Wenn sie hier funktionierten, dann ging es auch bei den
anderen
Baureihen.
Es war daher schon früh klar, das Modell wurde zum
Versuchs-träger. Mit der neuen Bezeichnung kamen auch die neuen Nummern. Diese lautete nun 14 201 und dabei sollten die beiden ersten Ziffer ein Schlüssel sein. Mit der Ziffer eins wurde die elektrische Lokomotiven definiert. Die
zweite Ziffer war mit der vier für den
Güterverkehr
gedacht. Die drei noch verbliebenen Ziffern waren die Nummern, die etwas
nach den Her-stellern geordnet werden sollten. Die BBC hatte die tieferen
erhalten. Die sensationelle elektrische Bremse der BBC hatte viele Nachteile. Die Bedienung war sehr kompliziert und daher kam sie auch nicht bei der Reihe Be 4/6 zum Einbau.
Die vielen Schäden und Störungen führten schliesslich dazu, dass
sie im Jahre 1931 ausgebaut wurde. Die auffälligen Abdeckungen mit den als
Shunt benötigten
Widerständen
blieb mit diesen zusammen erhalten. Nutzloser
Ballast?
Die
Achslasten
waren dafür verantwortlich.
Ebenfalls nachgerüstet wurde das Fahrberechtigungssignal. Zwar
wurde dieses
Signalbild
bisher auch schon verwendet und der Lokführer konnte es durch das Öffnen
der Türe erstellen. Nur erkannte man, dass es besser wäre, wenn das Signal
auch während der Fahrt erstellt werden könnte. Daher baute man auf der
oberen Lampe eine zusätzliche Lampe mit rotem Glas ein. Diese konnte im
Führerstand
eingeschaltet werden.
Als die Schweizerischen Bundesbahnen SBB den einmännigen Betrieb
auch mit den
Lokomotiven
einführten, mussten diese umgebaut werden. Der Beimann war nicht mehr
vorhanden und es wurde eine
Sicherheitssteuerung
eingebaut. So konnte die Verfügbarkeit des Lokführers überwacht werden.
Wichtig war, dass der Zug angehalten wurde. Das Personal galt damals oft
als Verbrauchsmaterial und dessen Schutz stand kaum im Vordergrund. Für diese Sicherheitssteuerung wurde beim Führerpult ein Pedal am Boden montiert. Damit diese Einrichtung nicht umgangen werden konnte, wurde ein Blech darüber platziert. So konnte das Personal das Pedal nur mit dem Fuss, der zwischen Pedal und Blech geschoben wurde, gegen die Kraaft einer Feder niederdrücken. Die von den Staatsbahnen benutzte Einrichtung funktionierte wegabhängig und bestand nur aus einer einzigen Form der Überwachung.
So lange der Lokführer auf dem
Pedal
stand, passierte nichts. Liess er es los, ertönte nach einem Fahrweg von
50 Metern ein Warnton. Der Lokführer hatte nun weitere 50 Meter Zeit, die
Sicherheitssteuerung
erneut zu bedienen. Tat er das nicht, löste die Einrichtung den
Hauptschalter
aus und leitete eine
Zwangsbremsung
ein. Der Zug, oder auch nur die
Lokomotive
kam zum Stehen. Aufgehoben werden konnte diese Zwangsbremse mit dem
Drücken des Pedals.
Im Gegensatz zu anderen
Lokomotiven
montiere man sie hier jedoch nicht in der Mitte, sondern bei den beiden
Laufachsen.
Damit hatte die
Zugsiche-rung
gegenüber den anderen Fahrzeugen eine we-sentlich bessere Wirkung
erhalten. Es mag sicher fraglich sein, dass hier sehr schnell diese Einrichtung nach Integra-Signum eingebaut wurde. Die Lokomotive war als Exot als Versuchs-träger ideal geeignet.
Wenn man etwas neues testen wollte, kam die
Lokomotive
automatisch zum Zug. Die notwen-digen Bedienelemente wurden im
Führerstand auf dem Pult montiert. Danach ging es auf die
Ver-suchsfahrten.
Da sie erfolgreich waren, blieb die Anlage auf der Lokomotive.
Damit war die
Lokomotive
immer auf dem aktuell-sten Stand, was die Sicherheit anbelangte. Die
ein-gebaute
Zugsicherung
nach
Integra-Signum
konnte jedoch nur die Begriffe «Warnung» und «Frei» erkennen. Im Fall der
Warnung
wurde durch die Sonden die Wegmessung der
Sicherheitssteuerung
aktiviert und diese sprach an, wenn das Signal nicht korrekt quittiert
wurde. Anfänglich löschte dabei nur eine Lampe mit gelbem Licht.
Eine weitere Anpassung betraf die elektrische Ausrüstung. Die
Stromabnehmer
erhielten doppelte
Schleifleisten,
so dass nur noch ein Stromabnehmer gehoben werden musste. Auch das war
aber keine auf diese Reihe beschränkte Massnahme und wenn wir die
elektrische
Bremse weglassen, war der BBC eine funktionierende
Lokomotive
gelungen. Ihr Problem war, dass die andere aus Oerlikon noch etwas besser
gebaut wurde.
Die grosse Achslast der mittleren
Achsen
führten dazu, dass die
Laufachse
entlastet wurde und so ihre Aufgabe schlicht nicht mehr wahrnehmen konnte.
Viel schlechter wäre der Verzicht auch nicht gewesen. Als man schliesslich damit begann, die alten Lokomotiven etwas auf Vordermann zu bringen, wurden bei der Ce 6/8 I die Übergangsbleche entfernt. Die Türen in der Frontund auf der rechten Seite verschlossen und so der Lokführer etwas vor Zugluft geschützt.
Arbeiten, die ebenfalls nahezu alle
Baureihen
betrafen, hier wurden dabei auch gleich die vier Koffer mehr oder weniger
vom Inhalt befreit, was aber optisch nicht zu erkennen war. Die
Lokomotive
hatte die Gepäckbox daher vor dem
Führerstand
und nicht auf dem Dach.
Neu erhielt die
Lokomotive
einen Anstrich in Grün. Das
Laufwerk
wurde grau gestrichen, was aber dank dem austretenden
Schmiermittel
nicht lange der Fall geblieben war. Jedoch verzichtete man auf eine
Leistungserhöhung, wie man sie bei den
Krokodilen
Ce 6/8 II durchführte. Die
Einsätze waren längst in den flacheren Bereichen und da war immer noch
genug Power vorhanden. Man gab also nicht viel Geld aus.
Gerade der fehlende grosse Umbau der
Lokomotive
zeigte, dass die damals eingebaute Technik recht gut funktionierte. Die
BBC konnte mit den Erfahrungen, die mit dieser Lokomotive gemacht wurden,
dazu beitragen, dass die Reihe Be 4/6
gelungene Lokomotiven wurden. So gesehen, war die Ce 6/8 I eher der
Vorgänger dieser Maschinen, als jener der
Krokodile. Auch wenn die letzten Krokodile den gleichen
Antrieb,
wie diese Lokomotive hatten.
Trotzdem wurde der Maschine die elektrische Bremse, wie sie bei der Reihe Be 4/6 verwendet wurde, auch noch eingebaut.
Es war die zweite verschleisslose
Bremse,
die hier verbaut wurde. Nun wurden einfache
Widerstände
verwendet.
Dazu konnte man die auf dem Dach bereits vom ersten Versuch übrig
gebliebenen
Widerstände
und Abdeckungen weiter verwenden. Die
Leistung
dieser
elektrischen
Bremse kam jedoch nie mehr an die ursprüngliche
Version heran. Jedoch war es nun wieder möglich, die Baureihe Ce 6/8 I
auch auf Strecken mit
starken Gefällen
zu verwendet. Das zur Reihe
Be
4/6 passende Dach war nun auch gleich geschaltet worden.
Viele kleinere Anpassungen gab es aus dem Betrieb heraus. Bei der
Baureihe Ce 6/8 I kam es nie zu einem grossen Umbau, auch eine
Modernisierung, wie sie von einigen Modellen der Reihe
Ce 6/8 II durchlaufen
wurde, gab es hier nicht. Die BBC hatte gute Arbeit geleistet und der
einzige Fehler war, dass man am Reissbrett nur änderte und nicht neu
zeichnete. Die miesen
Laufeigenschaften
sollten ein Zeugnis davon bleiben.
Dass die
Lokomotive
nicht weiter verfolgt wurde, war nur der Tatsache zu verdanken, dass die
legendären
Krokodile von der MFO
ausgerüstet wurden und diese hervorragend funktionierten. Zudem kamen
diese Krokodile mit der Fc 2x 3/4 in Betrieb, womit die MFO ihren
Vorsprung in diesem Sektor noch ausnutzen konnte. Die Fc 2x 3/4 Nummer 12
201 blieb immer ein Einzelstück und hatte auch keine direkten Nachkommen
und wurde nie umgebaut.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Das
führte dazu, dass die
Das
führte dazu, dass die
 Eine
weitere elektrische Änderung betraf die
Eine
weitere elektrische Änderung betraf die
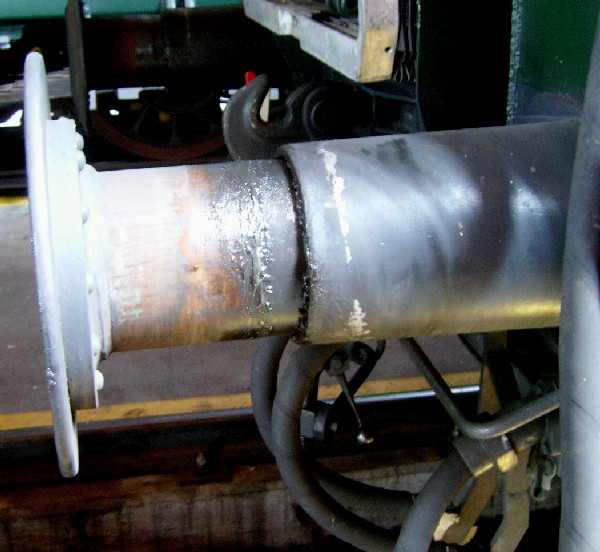 Die
starke
Die
starke
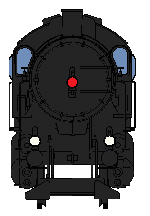 Es
stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Lösung. Es wurden die
Vorschriften geändert. Neu waren Fahrten auf dem
Es
stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Lösung. Es wurden die
Vorschriften geändert. Neu waren Fahrten auf dem
 Nach
einer Reihe von schweren Unfällen wurde in der Schweiz die
Nach
einer Reihe von schweren Unfällen wurde in der Schweiz die
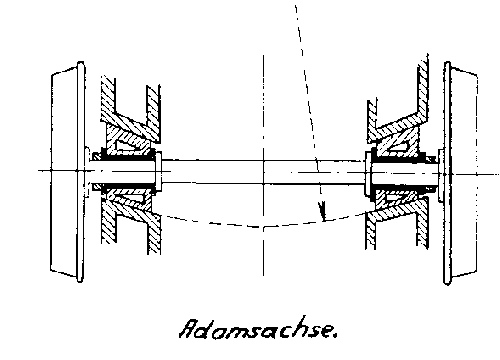 Geschadet
hatte der
Geschadet
hatte der
 Die
Die