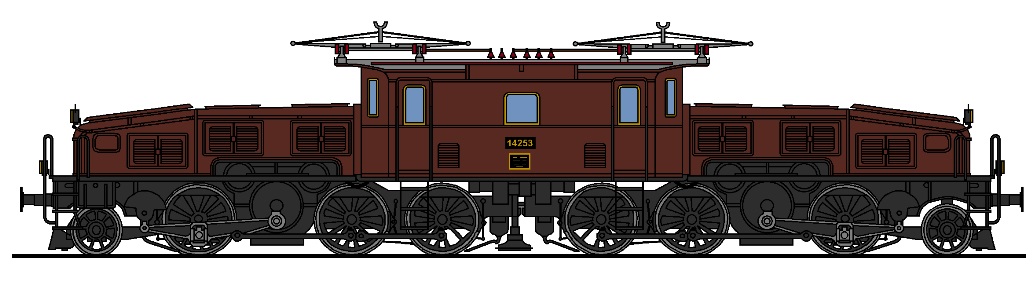|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
| Baujahr: | 1946 - 1951 | Leistung: | 1'830 kW / 2'480 PS* | |
| Gewicht: | 57 t | V. Max.: | 125 km/h | |
| Normallast: | 195 t | Länge: | 14'700 mm | |
| *Leichte Abweichungen bei den Lokomotiven mit den Nummern 427 bis 450. | ||||
|
Wenn man 1945 kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges auf den
Fahrzeugpark der Schweizerischen Bundesbahnen blickte, erkannte man, dass
viele
Triebfahrzeuge
elektrisch betrieben wurden. Die Seit 1920 vorangetriebene
Elektrifizierung hatte einen sehr hohen Stand. Selbst die ersten
Nebenlinien
wurden mit dieser
Fahrleitung
versehen. Das Ziel war klar, man wollte das ganze Netz überspannen und so
vom Ausland unabhängig verkehren.
Damit konnten sie in diesem Punkt immer noch mit den elektrischen
Modellen mit-halten. Jedoch zeigten sie auch Schwach-stellen und das war
nicht nur die im-portierte
Kohle. Die neuen Maschinen fuhren kaum höhere Höchstgeschwindigkeiten, als die alten mit Kohle befeuerten Dampflokomotive. Jedoch vermochten die elektrischen Ma-schinen diese Geschwindigkeiten auch in den vielen leichten Steigungen einzu-halten.
Wo die
Dampfmaschine
an Geschwindig-keit verlor, machte die elektrische
Lokomotive viel Zeit gut. Damit konnten die
Fahrzeiten
mit den vorhandenen
Reisezügen deutlich reduziert werden.
Jedoch waren die Strecken im
Flachland vom Aufbau her durchaus in der Lage, auch noch
höhere Geschwindigkeiten bei den Fahrzeugen zu erlauben. Abklärungen
ergaben, dass viele Abschnitte problemlos mit 125 km/h befahren werden
konnten. Bei den engeren
Kurven
konnte jedoch keine Steigerung erreicht werden. Dort galten die Gesetze
der Fliehkraft und diese durfte nicht zu hoch werden. So blieben nur die
geraden Abschnitte.
In den Jahren vor dem Krieg begannen die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit einer Vereinfachung des Verkehrs. Die direkte Folge davon waren die grossen und schweren Maschinen der Baureihe Ae 8/14. Sie sollten schlicht eine Besatzung auf der Lokomotive einsparen und so einen wirtschaftlichen Betrieb auf steilen Abschnitten ermöglichen. Die grossen Maschinen wurden jedoch zum grossen Opfer der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren.
Dabei sollten aber auch attraktive
Verbindungen
für die Reisenden entstehen und so die Leute vermehrt auf die Züge locken.
Die
Staatsbahnen
begannen die Konkurrenz mit dem Auto bereits damals deutlich zu spüren.
Wer es sich leisten konnte, reiste mit dem eigenen Wagen und nicht mit der
Eisenbahn. Wer sich keinen Wagen leisten konnte, konnte sich auch die Züge
nicht leisten. Die Wagen der ersten
Wagenklasse
blieben daher leer.
Bei der Baureihe Ae 4/7
ging ein vergleichbarer Schritt jedoch nicht, da die vier
Triebachsen
in den
Geleisen
zu sehr klemm-ten. Daher konnten nur leichte Züge davon profitieren.
Ein kleiner Schritt, aber damals jedoch wertvolle Minuten brachte.
Schliesslich gab es in der Schweiz noch keine Auto-bahnen, die den
Autofahrern einen zeitlichen Vorteil gebracht hätten. Wer im Land schnell
reisen wollte, benutzte damals noch die Eisenbahn, auch wenn im
internationalen Vergleich 110 km/h wenig waren. Im Ausland fuhr man
bereits mit bis zu 160 km/h planmässig durch das Land und konnte so
deutlich schneller das Ziel erreichen.
Sie müssen jedoch wissen, dass diese 110 km/h ohne moderne
Hochleistungsbremsen gefahren wurden. Diese Züge hatten die herkömmliche
P-Bremse
und die
Bremswege
zwischen
Vorsignal
und
Hauptsignal
mussten auch hier eingehalten werden. Oft mussten die Vorsignale trotzdem
noch um ein paar Meter verschoben werden. Die Strecken waren somit auch
ein Teil der zur geringen Geschwindigkeit beitrug und dabei waren es nicht
nur die
Kurven.
Lösungen, die man in anderen Ländern von Europa anwendete gingen
nicht, denn die Anlagen konnten nicht im grossen Stil verändert werden,
denn dazu war die Schweiz zu klein und das Streckennetz zu dicht. Es war
klar, wenn der Zug schnell fuhr, sollte er dies auch längere Zeit machen
können. In den flachen Gebieten von Deutschland und Frankreich war das
keine grosse Sache. Aber in der hügeligen Schweiz wurde es schwer.
Bei den Zügen wurde jedoch nicht nur die Geschwindigkeit erhöht.
Damit der Betrieb wirtschaftlicher wurde, war auf dem Fahrzeug nur noch
der Lokführer vorhanden. Dieser besorgte nebenbei die Kontrolle der
Fahrkarten.
Die dazu angeschafften
Triebwagen
CLe 2/4 wurden beim
Volk sehr schnell unter dem Namen «Roter
Pfeil» bekannt. Das passte, denn mit einer
Geschwindigkeit von 125 km/h waren sie schnell. Im ganzen Land gab es
nichts, dass auch nur annähernd mithalten konnte. Schnell wie ein Pfeil
und dazu noch rot. Der Name für diese Züge war geboren. Es sprach wirklich
niemand mehr von etwas anderem, denn im Roten Pfeil konnte man wirklich
rasen.
Ihr Nachteil war jedoch, dass sie so erfolgreich waren, dass die
kleinen
Triebwagen
hoffnungslos überfordert waren. Die kleinen
Roten
Pfeile wurden förmlich von den Reisenden überrannt.
Zusatzwagen konnte man jedoch nicht mitgeben. Auch wenn man solche
Personenwagen
durchaus im Bestand hatte, man konnte sie nicht an den Triebwagen kuppeln,
weil dieser wegen dem geringen Gewicht keine passenden
Zugvorrichtungen
erhalten hatte.
Besonders die 125 km/h, die diese Züge oft nicht nur auf dem
Papier fuhren, zeigte deutlich auf, eine weitere Erhöhung der
Geschwindigkeit war möglich, musste aber mit speziellen Bremslösungen
erfolgen. Die angewendeten Systeme der
Roten
Pfeile gingen aber nur bei speziellen
Triebzügen
und nicht bei
Lokomotive und Wagen. Daher beschloss man bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die Beschaffung solcher Triebzüge.
Dabei erkannte man jedoch auch, dass der Zug kaum einmal wirklich
schneller als 125 km/h fahren konnte. Die fantastische
Höchstgeschwindigkeit
existierte daher nur noch auf dem Papier und das war keine wirtschaftliche
Lösung. Zudem, war auch dieser Zug hoffnungslos überfordert.
Was bei den leichten
Triebwagen
und
Triebzügen
jedoch sehr viel Zeit brachte, war die Tatsache, dass sie schneller um die
Kurven
fuhren. Dabei waren sie oft 10 km/h schneller und kamen so auch in diesen
Abschnitten besser vorwärts. Wegen den leichten Fahrzeugen waren die
Belastungen auf die
Schienen
zum Teil immer noch geringer, als bei den älteren Baureihen. Jedoch war
diese Erhöhung für die Reisenden gerade noch zumutbar.
Daher wurde eine neue
Zugreihe
geschaffen. Diese wurde mit R für «rapid» bezeichnet und galt für
Fahrzeuge, die aufgrund der Bauweise und der zugelassenen Kräfte im
Gleis
schneller um die
Kurven
fahren. Zudem musste auch die
Höchstgeschwindigkeit
dieser Fahrzeuge über 110 km/h liegen. Der Wert ergab sich aus der
Baureihe Ae 3/6 I, die teilweise mit diesen Geschwindigkeiten durch das
Land fuhr. In der Folge bekamen die
Roten
Pfeile eine neue Bezeichnung.
Die Lösung konnte nur mit neuen
Triebfahrzeugen
und leichten Wagen gefunden werden. Dazu bestellten die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB neue sehr leichte Wagen, die später als
Leichtstahlwagen
sehr bekannt wurden. Bespannt werden sollten diese Züge mit den neuen
Triebwagen
RFe 4/4, die ebenfalls bestellt wurden. Damit sollten spezielle und
schnelle
Pendelzüge
gebildet werden. Mit zwei verwendeten Triebwagen sollte eine gute
Beschleunigung erreicht werden.
Die
Leistungsgrenze
des
Triebwagens
lag bei 91 km/h. Das war ein Wert, den man bisher noch nie angepeilt
hatte. Erst die
Lokomotiven für 140 km/h und mehr, hatten hier wieder
höhere Werte.
Mit
diesen Fahrzeugen wollte man Züge formieren, die aus mindestens zwei RFe
4/4 und zehn
Leichtstahlwagen
bestanden. Notfalls hätten diese Züge mit weiteren RFe 4/4 ergänzt werden
können. Die Idee war durchdacht und baute auf dem Einsatz mit
Vielfachsteuerung
auf. Gerade zu Beginn des zweiten Weltkrieges glaubte man fest an diese
neue Einrichtung. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sollten damit
jedoch nicht nur Freude bekunden.
Der
zweite Weltkrieg mit seinen Entbehrungen hatte auf den Verkehr in der
Schweiz erneut fatale Auswirkungen. Zwar konnten die Bahnen dank den
elektrischen
Lokomotiven und
Triebwagen
ohne Schwierigkeiten verkehren. Anders sah das beim Strassenverkehr aus.
Der akute Mangel an
Treibstoff,
lies die Wagen auf den Plätzen stehen. Die Folgen waren für die Bahnen
dramatisch, denn die Leute nahmen nun wieder den Zug.
Beliebt waren die schnellen Züge. So kamen die RFe 4/4 mit den
Leichtstahlwagen
schnell in Bedrängnis. Die zehn Wagen reichten oft nicht um die Leute zu
befördern. Hinzu kam, dass das Gepäck nur an beiden Enden in kleinen
Abteilen verstaut werden konnte. So musste ein
Gepäckwagen
mitgeführt werden und die
Leistung
der RFe 4/4 reichte dann meistens nicht mehr aus. Insgesamt war dies für
die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ein unbefriedigendes Ergebnis.
Der
anhaltende Krieg rund um die Schweiz führte nun doch noch dazu, dass die
Reisezüge
schwächer ausgelastet wurden. Die Leute befürchteten immer mehr, dass das
Land in den Krieg einbezogen wurde und da blieb man zu Hause und sorgte
dafür, dass man trotz aller Not, noch etwas zu essen im Garten oder auf
dem Balkon züchten konnte. Die Projekte mit schnellen Reisezügen gingen
daher sehr schnell vergessen und verschwanden in den Schubladen.
Nun
nahm aber der
Güterverkehr
massiv zu. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB benötigten nun
leistungsfähige
Lokomotiven für den Güterverkehr.
So entstanden in dieser
Zeit der grössten Materialknappheit die Baureihe
Ae 4/6
für den Gotthard und die
Triebwagen
Deh 4/6 für die Strecke über den Brünig. Besonders die Lokomotive
Ae 4/6
sollte von der
Vielfachsteuerung
profitieren und so den Betrieb am Gotthard vereinfachen.
Auch wenn es nicht sonderlich erwähnt wurde, die Baureihe
Ae 4/6
sollte mit der
Zugreihe R
verkehren. Dazu sah man eine
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h vor, verpasste der Maschinen sehr gute
Bremsen,
und rundete die
Führerstände.
Doch das
Fahrwerk
war so gut gelungen, dass an diese
Zulassung
schlicht nicht zu denken war. Selbst die 110 km/h der Reihe Ae 3/6 I
erreichte man mit den neuen Modellen schlicht nicht.
Deutlich zeigte sich aber der Bedarf an leistungsfähigen
Fahrzeugen. So baute man in dieser Zeit die Reihe
Ce 6/8
II, also die ältesten elektrischen
Lokomotiven im Bestand, zu leistungsfähigeren Modellen
der Baureihe
Be 6/8
II um. Damit war man im
Güterverkehr
gerüstet und konnte den Bedarf decken. Der
Personenverkehr
blieb auf dem bisherigen Niveau stehen und rückte angesichts der
schwierigen Zeit immer mehr in den Hintergrund. Die
Staatsbahn
wurde zur Güterbahn.
Erst als sich 1943 ein Ende des Krieges erkennen liess, konnte an
die Planung von
Rollmaterial
für die Nachkriegszeit herangetreten werden. Dabei stand jetzt ein
Triebfahrzeug
im Vordergrund, das nun endlich imstande sein sollte die Ae 3/6 I an den
Städteschnellzügen
abzulösen und deren
Fahrzeiten
zu unterbieten. Die ersten Schritte in diese Richtung hatte man bei den
Ae 4/6
schon gemacht. Nur machte das
Fahrwerk
nicht mit.
Mit einer neuen
Lokomotive war es jedoch noch nicht getan. Die Wagen
mussten auch dringend erneuert werden. Die alten schweren
Personenwagen,
die zum Teil noch über Holzkasten verfügten, genügten einfach nicht mehr
für den modernen Verkehr. Der Komfort der Wagen war veraltet und die
Fahrzeuge schlichtweg viel zu schwer. Man brauchte dazu starke, aber auch
schwere Lokomotiven. Nur diese waren nicht sehr schnell.
Eigentlich gab es in der Schweiz nur zwei
Lokomotiven, die ideal gewesen wären. Das war die
Baureihe
Ae 4/4
der BLS-Gruppe.
Diese Maschine war ebenfalls so bestellt worden, dass die
Zugreihe R
ermöglicht werden sollte. Zwar war dort das Fahrverhalten deutlich besser,
als bei der Reihe
Ae 4/6.
Nur für die
Zulassung
zur Zugreihe R reichte das jedoch noch nicht. Es fehlte zwar nicht viel,
aber es reichte trotzdem nicht.
Die neuen Züge der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten
schneller und komfortabler sein. Nur so konnte man die Leute wieder auf
die Züge holen und attraktive
Verbindungen
anbieten. Dazu hatte man bereits geeignete, leichte und komfortable Wagen
zur Verfügung. Diese
Leichtstahlwagen
erreichten die ausgedachten Geschwindigkeiten ohne Probleme und es fehlte
eigentlich nur noch ein passendes
Triebfahrzeug.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
 Daneben
gab es jedoch noch zahlreiche Dampflokomotiven. Darunter waren je-doch nur
noch wenige Baureihen ver-blieben. Diese neueren Dampfmaschinen verkehrten
dabei mit den Geschwindig-keiten 100 km/h (
Daneben
gab es jedoch noch zahlreiche Dampflokomotiven. Darunter waren je-doch nur
noch wenige Baureihen ver-blieben. Diese neueren Dampfmaschinen verkehrten
dabei mit den Geschwindig-keiten 100 km/h (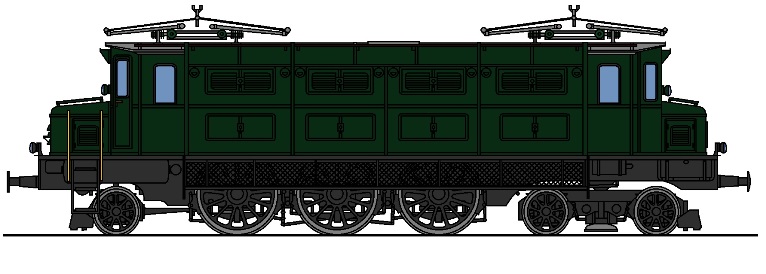 Um
die
Um
die
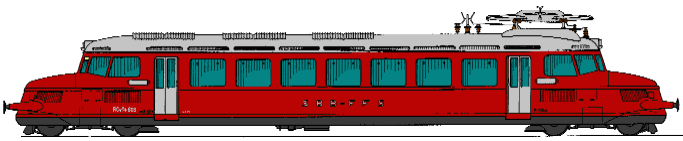 Im
Im
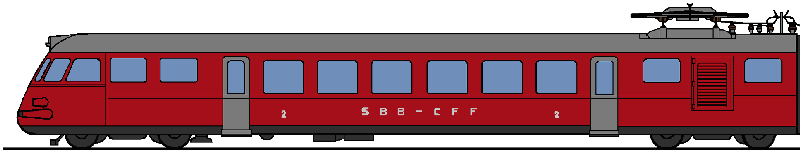 Unter
diesem Erfolg wurden dann kurz vor dem zweiten Weltkrieg die beiden
Unter
diesem Erfolg wurden dann kurz vor dem zweiten Weltkrieg die beiden
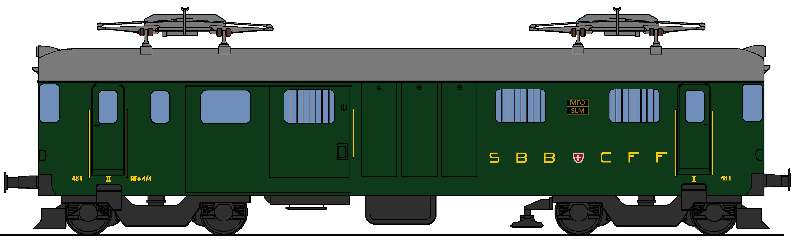 Ein
Blick in die technischen Daten zeigt auf, wie diese
Ein
Blick in die technischen Daten zeigt auf, wie diese
 So
musste auch das Experiment mit den RFe 4/4 nach kurzer Zeit als
gescheitert betrachtet werden. Da die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
über genügend
So
musste auch das Experiment mit den RFe 4/4 nach kurzer Zeit als
gescheitert betrachtet werden. Da die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
über genügend