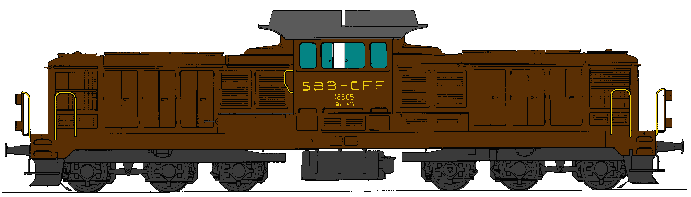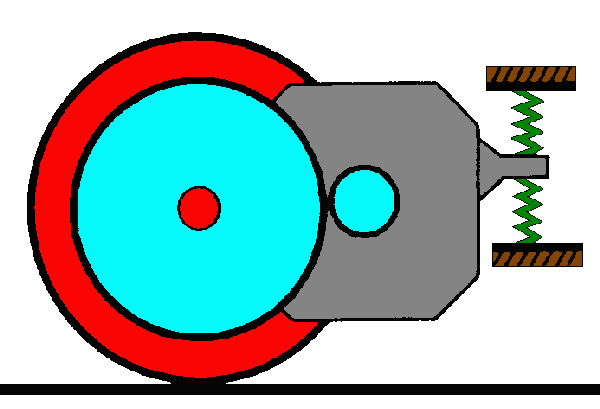|
Mechanische Konstruktion |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der Grundaufbau der Lokomotive bestand aus einem massiven Rahmen, der als Lokomotivbrücke ausgeführt wurde. Diese Lokomotivbrücke wurde um Gewicht zu sparen, als Hohlkörper konstruiert. Die Querträger stabilisierten die Brücke zusammen mit den Stossbalken. Die einzelnen Teile dieses Rahmens wurden mit mittlerweile üblichen Schweissverbindungen zusammengefügt. So entstand eine stabile und verwindungssteife Konstruktion, die das Gewicht der Lokomotive trotz geringem Eigengewicht tragen konnte. Abgeschlossen wurde die Lokomotivbrücke auf beiden Seiten mit den verstärkten und in der Lokomotivbrücke integrierten Stossbalken. Dank den Verstärkungen konnten die auftretenden Zug- und Stosskräfte besser aufgenommen werden. Zudem wurde die Konstruktion hinter den Stossbalken so konstruiert, dass die Kräfte der beiden Puffer besser auf die Lokomotivbrücke verteilt wurden. So war das tragende Element besten für die im Rangierdienst auftretenden Kräfte gerüstet.
Für die Zugvorrichtungen der Lokomotive verwendete man eine Schraubenkupplung nach UIC, die am Zughaken montiert wurde. Der Zughaken war im Stossbalken federnd gelagert worden und konnte sich seitlich leicht bewegen. So konnte die Kupplung auch die Zuckungen der ihm Rangierdienst oft locker gekuppelten Fahrzeuge aufnehmen, ohne dass sie beschädigt wurde. Jedoch galten hier die gleichen Normen, wie für Lokomotiven im Streckendienst, so dass die Lokomotive auch dort problemlos eingesetzt werden konnte. Unter der Lokomotivbrücke wurden massive Bahnräumer angebracht. Die neuen Bahnräumer schützten die Lokomotive im Rangierdienst besser, als die bei den Dampflokomotiven noch verwendeten Schienenräumer. Diese Bahnräumer bestanden aus einem leicht gegen den Spitz zulaufenden Blech, das zudem zur besseren Stabilisierung unten auch noch nach vorne gebogen wurde. So entstand ein stabiler aber leicht konstruierter Bahnräumer. Am Bahnräumer wurde zudem ein Hilfshaken für die Schraubenkupplung und in der Mitte eine Verstärkung aus hartem Kunststoff angebracht. Diese Verstärkung schützte den Bahnräumer vor der herunterfallenden Kupplung. Dies war im Verschubdienst oft der Fall, wo die gelockerte Kupplung mit einer Stange aus dem Zughaken ausgehängt wurde. Nach diesem aushängen fiel die Kupplung dann mit voller Kraft auf den Bahnräumer. Die Halterungen für die beiden Luftschläuche der automatische Bremse, wurden hingegen nicht am Bahnräumer angebracht. Sie bestanden aus an der Lokomotivbrücke montierten Halterungen. Ausser diesen beiden Luftleitungen gab es bei der Lokomotive keine weiteren Bauteile, wie Heizsteckdosen oder eine Steuerleitung, mehr. Der Stossbalken war somit nur mit den absolut nötigsten Bauteilen versehen worden und wirkte dadurch ziemlich leer. Mittig unter der Lokomotivbrücke wurde der Treibstoffbehälter montiert. Er wurde aus dickwandigen und verstärkten Blechen hergestellt. So war gesichert, dass der Tank bei einer kleinen Havarie nicht gleich aufgerissen wurde. Durch die auf beiden Seiten vorhandenen und verschliessbaren Einfüllöffnungen konnte der Tank mit 3'000 Liter Dieselöl befüllt werden. Beim Kraftstoffbehälter gab es keinerlei Vorrichtungen, die bei einem Defekt das auslaufen des gesamten Treibstoffes verhindert hätten. Über dem Treibstoffbehälter, also auf der Brücke wurde eine niedere Konsole aufgesetzt. Sie wurde fest mit der Lokomotivbrücke verschweisst und konnte daher nicht demontiert werden. Die Konsole enthielt Bauteile der elektrischen Ausrüstung und überragte das darauf montierte Führerhaus auf beiden Seiten. Damit man zu diesen Bauteilen gelangen konnte, war die Konsole im Bereich des Führerhauses seitlich mit Türchen versehen worden. Wo die Konsole jedoch von oben zugänglich war, baute man Bodenklappen ein, die durch anheben geöffnet werden konnten. Die nicht durch diese Konsole abgedeckten Bereiche der Lokomotivbrücke wurden mit einem Umlaufblech versehen. Dieses schloss somit die Lokomotivbrücke nach oben hin ab. Im Bereich der Stossbalken wurde das Umlaufblech zu Rangierplattformen erweitert. Diese Plattformen wurden nach vorne mit einem Handlauf versehen, der zudem mit einem Blech verschlossen wurde. So konnte sich dort das Rangierpersonal auf der Fahrt gefahrlos aufhalten. Weitere Absturzsicherungen waren jedoch nicht mehr vorhanden. Betreten werden konnte die Rangierplattform und somit die Lokomotive von beiden Seiten her durch einen Aufstieg, der aus den Tritten und zwei kräftigen Griffstangen bestand. Dabei waren zwei der drei Tritte im Hauptträger der Lokomotivbrücke eingelassen worden. Der unterste Tritt war aus einem massiven Trittbrett gefertigt worden. Er wurde mit massiven Eisenträgern an der Lokomotivbrücke festgeschraubt. So konnte er bei Beschädigungen leicht ausgewechselt werden. Das Führerhaus wurde in der Mitte der Lokomotive fest auf der Konsole aufgebaut. Es hatte eine Länge von 2'500 mm und war daher sehr geräumig gestaltet worden. Der Zugang zum Führerhaus war jedoch nur von den Plattformen her über das Umlaufblech erreichbar. Dazu bestieg man von der Seite aus eine der Plattformen. Danach folgte man den Vorbauten auf der linken Seite, betrat mit einem Hilfstritt die Konsole und gelangte so zur Türe des Führerhauses. Durch die grosse Höhe musste das Führerhaus, das die ganze Breite der Lokomotivbrücke ausnutzte, im oberen Bereich eingezogen werden. Nur so konnte man innerhalb der zulässigen Fahrzeugumgrenzung zu bleiben. Die Höhe war eine Folge davon, dass die Lokomotivbrücke schon eine grosse Breite hatte und darauf ja zuerst noch die Konsole montiert wurde. Das wirkte sich daher auf die Gestaltung der Wände des Führerhauses aus, die wir deshalb etwas genauer betrachten müssen. Die beiden Seitenwände des Führerhauses wurden senkrecht nach oben geführt, hatten keinen Knick erhalten und bestanden in diesem Bereich aus einem einfachen Blech, das keinerlei Öffnungen hatte. Einzig im unteren Bereich der Wand waren gegen beide Seiten je eine Nische vorhanden. Diese ermöglichten zusammen mit den am oberen Ende dieser einfachen Wand montierten Griffstangen, die Reinigung der darüber montierten Seitenfenster. So hatte das Personal den notwendigen Stand, konnte aber nur mit einer Hand arbeiten. Die Seitenfenster wurden im Bereich oberhalb dieser Wand montiert und befanden sich bereits im eingezogen Bereich. Somit befand sich der Knick, der durch den Einzug entstand, unmittelbar unterhalb der Fenster im Bereich der Griffstangen. Es konnten so einfache gerade Scheiben verwendet werden. Das reduzierte die Beschaffungskosten von Ersatzscheiben deutlich, denn speziell geformte Scheiben waren teuer in der Fertigung. Es wurden in jeder Seitenwand drei Fenster mit unterschiedlicher Breite montiert. Sie wurden jeweils durch eine Säule voneinander getrennt. Die beiden seitlichen schmalen Fenster waren fest in der Seitenwand montiert worden. Dazwischen wurde ein weiteres breites Fenster montiert. Hier konnten die Scheiben geöffnet werden. Es wurden Schiebefenster verwendet, so dass man bei geschlossenem Fenster meinen konnte, dass es eigentlich vier Fenster sein müssten. Die beiden Stirnseiten wurden im oberen Bereich eingezogen, da sie den beiden Seitenwänden folgen mussten. Auch hier verwendete man einfaches nicht isoliertes Blech zum Aufbau der Wand. Auf der linken Seite war zudem die nach aussen und gegen die Vorbauten hin öffnende Türe vorhanden. Um den Zugang zum Führerhaus zu erleichtern und einen geringen Schutz gegen Abstürze zu erhalten, war aussen an der Stirnwand noch ein weit vorstehender Handgriff montiert worden. In den Stirnwänden montierte man insgesamt vier Fenster. Wobei ein Fenster davon in der Türe eingebaut wurde. Das äussere Fenster wurde, wie jenes in der Türe, gegenüber den beiden mittleren Fenstern, nach unten gezogen. Das erfolgte einerseits um die Sichtbarkeit etwas zu verbessern und weil die mittleren Fenster wegen der Vorbauten nicht grösser ausgeführt werden konnten. Die beiden mittleren Fenster waren zudem mit einer breiten Mittelsäule getrennt worden. Die Frontscheiben waren fest in der Wand, beziehungsweise in der Türe, montiert worden und konnten nicht geöffnet werden. Hier wurde spezielles Sicherheitsglas verwendet, das nur bei einer bestimmten Temperatur die optimale Festigkeit hatte. Daher versah man diese Fenster mit einer Fensterheizung, die im Winter auch für klare Scheiben sorgte. Ergänzt wurden die Fenster dann noch mit teilweise pneumatisch betriebenen Scheibenwischern. Abgedeckt wurde das Führerhaus schliesslich noch mit einem leicht gewölbten Dach. Seitlich war es gegen die Seitenwände hin etwas stärker abgerundet worden. Es schloss auf beiden Seiten bündig mit den Wänden ab. Es konnte somit kein Regenschutz für die Seitenfenster verwirklicht werden, so dass es bei geöffneten Fenstern in den Führerstand regnete. Der Grund lag auch hier bei der zulässigen Begrenzung des Fahrzeuges. Bei den beiden Fronten wurde das Dach hingegen über die Wand hinaus verlängert und diente dort als Sonnenschutz. Auf dem Dach wurden die Schalldämpfer der Dieselmotoren montiert. Die Abgase gelangten daher an der höchsten Stelle der Lokomotive ins Freie. Sie konnten so nicht in den Führerstand gelangen und behinderten auf der Fahrt auch nicht die Sicht des Lokführers. Wie gut dieser Entscheid war, zeigten die Erfahrungen, die man bei den nicht so aufgebauten Bm 4/4 gemacht hatte. Möglich wurde diese Anordnung jedoch nur, weil auf dem Dach keine elektrischen Bauteile montiert wurden. Beidseitig des Führerhauses wurden zwei hohe Vorbauten aufgebaut. Sie behinderten die Sicht auf die Strecke und die tief montierten Signale massiv, so dass für den Lokführer nur die Sicht entlang dieser Vorbauten möglich war. Daher auch die weit nach unten gezogenen Fenster der Frontwände. Aber an Übersichtlichkeit hatte die Lokomotive damit nicht gewonnen, es blieb somit eine recht unübersichtliche Lokomotive, was dazu führte, dass der Lokführer immer wieder die Seiten wechseln musste. Es kamen bei dieser Lokomotive jedoch keine Hauben zur Anwendung, sondern man baute feste Vorbauten auf, die zahlreiche Öffnungen hatten. Im Bereich der Konsole wurden Tore montiert, die mit Lüftungsgitter versehen waren und so die Luftzufuhr für die Dieselmotoren ermöglichten. Anschliessend folgten drei Tore, die über zwei Flügel verfügten. Dadurch konnten diese Türen geöffnet werden ohne dass die Umgrenzung der Lokomotive verletzt worden wäre. Ganz am vorderen Ende waren dann noch die Lüftungsgitter der Kühlung vorhanden. Sie konnten jedoch nicht geöffnet werden, das sich unmittelbar dahinter die Kühler befanden. Oben konnten die Vorbauten dank den grossen montierten Abdeckungen geöffnet werden. Dabei wurde aber nicht der gesamte Bereich frei gegeben. Im Bereich der Konsole war daher der Vorbau oben fest angeschlossen und besass nur den Aufbau für die Abgasleitung. Am vorderen Ende der Vorbauten war zudem die Öffnung für den Ventilator der Kühlung vorhanden. Auch hier konnten die Vorbauten somit nicht geöffnet werden. Die Lokomotivbrücke stützte sich zusammen mit den Aufbauten über jeweils vier Gummielemente auf zwei Drehgestelle ab. Eine Federung des Kastens gegenüber dem Drehgestellrahmen gab es jedoch nicht, so dass die Lokomotivbrücke gegenüber dem Drehgestell ungefedert war. Die Position des Drehgestells und der Drehpunkt wurden mit Hilfe eines Drehzapfens, der auch zur Übertragung der Zugkraft genutzt wurde, festgelegt. Der Drehgestellrahmen wurde aus einzelnen Blechen zu einem stabilen Rahmen verschweisst. Es entstand so ein einfacher Rahmen der ohne Kröpfungen ausgekommen war. Gegen die Innenseite der Lokomotive wurde der Rahmen zudem leicht nach unten gezogen und dadurch etwas schwächer ausgeführt. Er erleichterte so der Lokomotive auch das Befahren der Ablaufberge von Ablaufanlagen ohne Einschränkung. Besonders bei Lokomotiven im Verschubdienst war das sehr wichtig. In jedem Drehgestell wurden drei Achsen montiert. Diese waren innerhalb des Drehgestells asymmetrisch angeordnet worden. Der Achsstand zwischen der äussersten Achse und der mittleren Achse betrug 2’050 mm. Die dritte Achse wurde jedoch nur 1'750 mm von der mittleren Achse entfernt montiert. Eine radiale Einstellung der Achsen war nicht möglich. Die mittlere Achse erhielt ein leicht grösseres seitliches Spiel. Somit betrug der feste Achsstand im Drehgestell 3'800 mm. Trotz der langen Drehgestelle und dem grossen festen Radstand, war die Lokomotive in der Lage Radien bis hinunter auf 80 Meter zu befahren. Bei den SBB waren die gängigen Minimalradien mit 100 Meter jedoch etwas grösser. So konnte die Lokomotive auf den Anlagen der SBB ohne Beschränkungen verkehren und auch Anschlussgleise konnten problemlos befahren werden. Damit der Verschleiss der Spurkränze vermindert werden konnte, wurde bei jeder Achse eine Spurkranzschmierung eingebaut. Die Triebachsen waren gegenüber dem Drehgestell abgefedert worden. Jede Achse besass zwei Rollenlager, die ohne Wartung funktionierten und so keinen Unterhalt erforderten. Das Gehäuse des Achslagers wurde in der Mitte, der darunter montierten Blattfeder, fixiert. So wurde das Drehgestell eigentlich nicht auf der Achse abgestützt, sondern war an der Federung aufgehängt worden. Die Zugkräfte wurden mit den beiden Achslagerführungen auf den Drehgestellrahmen übertragen. Es kam zur Federung der Lokomotive eine Kombination von Blatt- und Schraubenfedern zum Einsatz. Die unten montierte Blattfeder wurde dabei mit Schraubenfedern mit dem Drehgestellrahmen verbunden. Während die beiden äusseren Achsen nur jeweils aussen diese Schraubenfeder hatten, war die dritte Achse beidseitig mit Schraubenfedern versehen worden. Durch die kombinierte Federung konnten Schläge mit grosser und kleiner Schwingungsdauer von der Federung abgefangen werden. Die Schraubenfedern waren nicht mit Dämpfern versehen worden. Diese wären eigentlich nötig um ein Aufschaukeln dieser mit einer kurzen Schwingungsdauer versehenen Federn zu verhindern. Man konnte jedoch darauf verzichten, da die Achslagerführung dämpfend wirken und sich so die Schraubenfedern nicht mehr aufschaukeln konnten. Somit war eine rein mechanisch wirkende Dämpfung verwirklicht worden. Die Achse eins und zwei war mit einer Federstütze miteinander verbunden worden, so ergab sich zwischen den beiden Achsen ein guter Achslastausgleich, was gerade beim befahren der Kuppen von Ablaufbergen wichtig war. So konnten Entgleisungen wegen zu schwachem Achsdruck verhindert werden. Wegen der Federstütze waren diese Achsen in diesem Bereich nicht mit einer Schraubenfeder versehen worden. Die Achsen wurden mit zwei Speichenrädern versehen. Diese wurden auf der Achse aufgeschrumpft und so fest mit dieser verbunden. Die Räder hatten einen Durchmesser von 1'040 mm und bestanden aus dem Radkörper und der ebenfalls aufgeschrumpften Bandage. Diese Radreifen dienten als Verschleissteil und konnten in den Werkstätten einfach ausgewechselt werden, ohne dass man das ganze Rad ersetzen musste. Es entstanden so leichtere Räder, als wenn man ein Vollrad verwendet hätte. Nur so konnte die maximal erlaubte Achslast eingehalten werden. Die Farbgebung der Lokomotive war schlicht ausgefallen. Sie orientierte sich an den Rangierlokomotiven und bestand daher aus einem rotbraunen Anstrich für die Lokomotivbrücke und die Aufbauten. Für die Drehgestelle, den Treibstoffbehälter und die Bahnräumer wählte man einen dunkelgrauen Farbton. Einen etwas helleren grauen Farbton wurde schliesslich noch beim Dach angewendet. Farblich hervorgehoben wurden die in gelber Farbe gehalten Griffstangenn der Aufstiege.
Die Beschriftungen wurden in gelber Farbe ausgeführt. Bis auf einige technische Anschriften am Rahmen wurden alle Anschriften, wie das Kürzel SBB – CFF am Führerhaus angebracht. Im Gegensatz zu den übrigen Fahrzeugen der damaligen Zeit brachte man hier die Bahnanschriften an. Dabei wurde aber Farbe verwendet und man griff nicht auf die neu eingeführten verchromten Buchstaben der Re 4/4 zurück. Die Fahrzeugnummer wurde an allen Seiten der Lokomotive angebracht. Seitlich wählte man auch hier den einfachen Weg mit aufgemalten Zahlen. Somit waren seitlich nur die, an der Lokomotivbrücke angebrachten, Fabrikschilder, als aufgesetzte Schilder ausgeführt worden. An den beiden Fronten wurden die Fahrzeugnummern jedoch auch mit Schildern, die am Blech der Plattform montiert wurden, ausgeführt. Angetrieben wurde jede Achse der Lokomotive mit einem Elektromotor. Dieser übertrug das Drehmoment über einen Tatzlagerantrieb auf die jeweilige Triebachse und so auf die Schiene. Das Getriebe des Antriebs hatte eine Übersetzung von 1 : 5.93. Obwohl der Tatzlagerantrieb schon damals als problematisch angesehen wurde, konnte er bei den langsam fahrenden Diesellokomotiven verwendet werden. Zudem war es robust und so besser gegen die im Rangierdienst auftretenden Kräfte gut geschützt.
Das in den Achsen in Zugkraft umgewandelte Drehmoment, wurde über die Achslager auf den Drehgestellrahmen übertragen. Von dort gelangte die Kraft über den Drehzapfen auf die Lokomotivbrücke und so auf die am Stossbalken angebrachten Zugvorrichtungen. Eine Querkupplung zwischen den Drehgestellen gab es hier, wie einen Ausgleich der Achsentlastung, nicht. Um die Zugkräfte trotzdem gut zu übertragen, wurde vor den äussersten Achsen noch ein Sander montiert. Abgebremst wurde die Lokomotive mit einer modifizierten Klotzbremse. Diese bestand pro Rad aus zwei von beiden Seiten auf die Lauffläche wirkenden Bremsklötzen. Hier kamen jedoch keine eigentlichen Bremsklötze mehr zur Anwendung. Vielmehr baute man spezielle Sohlenhalter ein, die mit zwei Bremssohlen als Verschleissteil bestückt wurden. Somit wurde jedes Rad insgesamt mit vier Bremssohlen aus Grauguss abgebremst. Die einzelnen Sohlenhalter eines Drehgestells wurden mit einem Bremsgestänge miteinander und mit dem Bremszylinder verbunden. Die Abnützung der Bremssohlen wurde mit einem automatischen Bremsgestängesteller der Marke Stopex ausgeglichen. Dadurch war ausser dem Wechsel der abgenutzten Bremssohlen kein regelmässiger Unterhalt an den Bremsen mehr nötig. Diese Bremsausrüstung entsprach damit jedoch dem damals gängigen Standard. Die Handbremse und somit die Feststellbremse der Lokomotive, wirkte aus dem Führerstand heraus auf das Bremsgestänge des Drehgestells eins. Die Verbindungen zwischen der Bremskurbel und dem Bremsgestänge erfolgte über einen Kettenzug. Diese Bremse hatte jedoch den Nachteil, dass die Lokomotive ein schlechtes Handbremsgewicht erhalten hatte. So reichte die Handbremse nicht aus um die Lokomotive von der Druckluftbremse unabhängig in den steilsten Abschnitten zu sichern. Die pneumatischen Bremssysteme bestanden aus drei unabhängig auf die beiden Bremszylinder wirkenden Systemen. Dabei wirkten die Rangierbremse regulierend und die Schleuderbremse mit 0.8 bar Druck direkt auf die Bremszylinder in den Drehgestellen. Dank der Schleuderbremse konnten durchdrehende Räder abgefangen werden. Dabei überlagerte die stärker wirkende Bremse die andere wirksame Bremseinrichtung. Die automatische Bremse stammte aus dem Hause Oerlikon und wirkte indirekt auf beide Bremszylinder. Dabei wurde der Bremszylinder durch die Ansteuerung eines speziellen Steuerventils mit Druckluft versorgt. Es kam ein bei den Lokomotiven der SBB übliches Steuerventil der Bauart LSt 1 zum Einbau. Dieses konnte umgestellt werden, dass die Lokomotive sowohl über die schnell wirkende P-Bremse, als auch über die langsamer wirkende G-Bremse verfügte. Obwohl bereits die ersten Lokomotiven mit der stärker wirkenden R-Bremse ausgerüstet wurden, war diese Bremse hier nicht vorhanden. Diese wurde nur benötigt, wenn mit dem Fahrzeug schneller als 100 km/h gefahren werden sollte. Da die Lokomotive jedoch eine wesentlich geringere Höchstgeschwindigkeit hatte, konnte auf diese Hochleistungsbremse verzichtet werden. Damit war die Bremsausrüstung aber auch auf den Einsatz im Rangierdienst abgestimmt worden, denn dort war die R-Bremse schlicht nicht aktiv. Die für die pneumatischen Bremsen und andere Verbraucher notwendige Druckluft wurde in einem Kompressor hergestellt. Es wurde dazu ein Rotationskompressor verwendet der elektrisch von den Hilfsbetrieben der Lokomotive angetrieben wurde. Der maximale Enddruck dieses Kompressors betrug 8 bar und lag daher unter dem Wert der anderen Streckenlokomotiven, die Drücke von bis zu 10 bar hatten. Da jedoch keine Verbindung über eine Speiseleitung zu anderen Lokomotiven bestand, war dies kein Mangel und stellte auch keine Gefahr für die Lokomotive selber dar. Die elektropneumatisch betriebe Sandstreueinrichtung bestand aus dem in der Lokomotivbrücke eingebauten Sandbehälter. Von dort führte eine Leitung zu dem vor den Rad der ersten Achse montierten Sander. Jedes ausgerüstete Rad hatte dabei seine eigene Sandstreuvorrichtung erhalten. Die Ventile der Sandstreueinrichtungen wurden abhängig von der Fahrrichtung aktiviert und wirkten somit immer nur vor der, in Fahrrichtung gesehen, ersten Achse der Lokomotive.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2011 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Am
Am