|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Ein wichtiger, jedoch oft vergessener Punkt bei der Steuerung ist
die
Beleuchtung.
Diese ist für die Signalisation wichtig, hat aber auch die Aufgabe, den
Leuten eine verbesserte Sicht zu ermöglichen. Egal um was für ein Fahrzeug
es sich handelt, es gibt immer irgendwie Licht. Gut vielleicht Ihr Fahrrad
nicht, aber dann sollten Sie nicht nachts damit fahren, weil Sie sonst
schnell erfahren, dass dies keine gute Idee war. Genau dieser Punkt war
bei der Eisenbahn wichtig.
Zudem wurden damit auch spezielle betrieblich bedingte
Signalbilder
gezeigt. Eher nebensächlich war, dass die Strecke vor dem Zug damit
ausgeleuchtet wurde und so dem Lokführer die Sicht verbesserte. Am Vorbau wurden über den Hilfspuffern je eine einfache Lampe mit klarem Glas eingebaut. Ein in der Lampe vor-handener Reflektor sorgte dafür, dass das Licht der Glüh-birne nach vorne geworden wurde.
Dabei war dieses durchaus hell genug, dass der Bereich vor dem
Fahrzeug ausgeleuchtet wurde. Da wegen dem langen
Vorbau
das Bedienpersonal diesen Bereich jedoch kaum einsehen konnte, war es eher
ein nebensächlicher Effekt. Um die farbigen Signalbilder und den erforderlichen Zug-schluss zu signalisieren, konnten vor den Lampen einfache Steckgläser eingesteckt werden. Diese Gläser wurden jedoch nur nachts und in Tunnel benötigt, bei Tag wurden entsprechend eingefärbte Tafeln verwendet.
Diese Tafeln konnten seitlich an den Hilfspuffern aufge-steckt
werden. Nicht benötigte Signalmittel mussten je-doch im Fahrzeug beim
zugehörigen
Führerstand
depo-niert werden.
Damit die
Beleuchtung
komplettiert werden konnte, wurde am Dach über dem
Führerstand
in der Mitte eine weitere Lampe montiert. Damit konnten die in der Schweiz
üblichen drei weissen Lichter gezeigt werden. Im Aufbau unterschied sich
diese Lampe von den unteren Modellen eigentlich nur darin, dass hier keine
Halterung für die Farbscheiben vorhanden war. Dabei musste in der Schweiz
auch hier rot signalisiert werden können.
War dieses
Signalbild erforderlich, wurde die untere Lampe
eingeschaltet und die obere gelöscht, damit war nun ein rotes Licht zu
erkennen. Um zu verhindern, dass durch die Sonne falsche Signalbilder
gezeigt wurden, war die rote Lampe mit einem
Sonnendach
versehen worden. Neben dieser Dienstbeleuchtung waren auch im Fahrzeug Lampen montiert worden. Diese dienten, wie das bei allen Triebfahrzeugen der Fall war, der Ausleuchtung der Anzeigen für das Lokomotivpersonal.
Diese waren jedoch anders ausgeführt worden, wie das bisher der
Fall war. Statt dem
Messingdom
verwendete man in den
Instrumenten
eingebaute Lampen. Damit konnten die dort angezeigten Werte jedoch auch
nicht besser abgelesen wer-den.
Der letzte Teil der
Beleuchtung
war die Ausleuchtung des
Fahrgastraumes.
Diese sollte auch verändert werden. So wur-de in jedem Abteil eine Lampe
montiert. Es war so möglich, den Innenraum optimal zu erhellen, so dass
dieser auch in der Nacht freundlich wirkte. Jedoch gab es da ein Problem,
denn diese Lampen konnten den Lokführer blenden. Daher hatte er in seinem
Rücken einen Vorhang, den er ziehen konnte.
Alle Lampen funktionierten mit elektrischem
Strom
und waren auch aktiv, wenn der
Triebwagen
ausgeschaltet war, oder der
Dieselmotor
nicht lief. Damit das möglich war, wurde die
Beleuchtung
an der Steuerung angeschlossen und diese wurde ab einer
Batterie
mit der notwendigen Energie versorgt. Dabei kamen bei allen
Triebwagen
die gleichen Batterien zur Anwendung. Diese entsprachen im Aufbau zudem
den vorhandenen Modellen.
Zwei solche Behälter sollten zudem die für diese
Triebwagen
erforderliche
Spannung
erzeugen. Da-mit war eine Spannung von 36
Volt
Gleichstrom
vorhanden, was den üblichen Werten entsprach. Es waren die üblichen Bleibatterien, wie es sie bei zahlreichen anderen Fahrzeugen auch gab. Da sie jedoch mit dem üblichen Hebegerät nicht aus der Haube gehoben werden konnten, musste die Batterie in einer Werkstatt mit einem Kran aus dem Fahrzeug gehoben werden.
Zudem war die erforderliche Belüftung zum Schutz vor dem Knallgas
vorhanden, denn dieses gefähr-liche
Gas
wurde mit der Luftströmung aus dem Fahrzeug gezogen.
Da diese
Bleibatterien
durchaus ein ansehnliches Gewicht haben, wurden sie im Fahrzeug so
verteilt, dass die
Achslast
ausgeglichen war. Das Fahrzeug war so leicht, dass selbst eine
Batterie
darauf Auswirkungen haben konnte. Das hatte jedoch zur Folge, dass bei
einem Wechsel das Fahrzeug von beiden Seiten her zugänglich sein musste.
Ein Punkt mehr, dass der Wechsel nur in einer entsprechend ausgerüsteten
Werkstatt erfolgen konnte.
Soweit gab es zwischen den
Triebwagen
keine Unterschiede. Jedoch hatten die verbauten
Bleibatterien
keine unbeschränkte Lebensdauer. Sie mussten in der Folge wieder
aufgeladen werden. In diesem Bereich gab es Unterschiede und auch bei der
eigentlichen Steuerung mussten wichtige Anpassungen an die
unterschiedlichen Betriebsformen vorgenommen werden. Da sie vermutlich
schon gespannt auf die Ladung beim Modell mit
Dieselmotor
warten, beginnen wir damit.
|
|||
|
Steuerung CLm 2/4 |
|||
|
Die
Spannung
der
Bleibatterien und somit das
Steuerstromnetz waren die
einzigen elektrischen Teile des Modells mit
Dieselmotor. Daher wurde hier
auch der
Kompressor angeschlossen. Das hatte zur Folge, dass die
Batterie
durchaus stärker belastet wurde, als das beim elektrischen
Triebwagen
der
Fall gewesen ist. Ein Punkt, der natürlich bei der Ladung und der
Versorgung während dem Betrieb berücksichtigt werden musste.
Damit das überhaupt klappte, musste vom
Generator eine etwas höhere
Spannung
abgegeben werden. Im Betrieb wurde
das bei der
Beleuchtung bemerkt, da diese kurz ein wenig dunkler wurde.
Jedoch war das immer nur dann der Fall, wenn der
Triebwagen stand. In Bewegung versetzt wurde der Generator von einer der Laufachsen. Dazu wurde von dieser ein Riemen in Beweg-ung versetzt, der dann den Generator aktivierte. Diese Lösung kannte man von den Reisezugwagen.
Damit konnten
sicherlich auch deren Ersatzteile genutzt werden. Jedoch hatte diese Art
der
Batterieladung auch ihre Nachteile, denn der
Generator lief nur, wenn
sich der
Triebwagen bewegte und das auch nur ab einer bestimm-ten
Geschwindigkeit. Das hatte natürlich auch zur Folge, dass die Leistung des Dieselmotors eigentlich vollumfänglich dem Antrieb zur Verfügung stand. Dieser Motor musste aber gesteuert werden. Gerade die regelmässigen Besucher dieser Seite wissen, dass dabei wirklich ausgeklügelte Systeme verwendet wurden. Daher könnte man auch hier davon etwas erwarten. Jedoch war der Triebwagen wirklich ausgesprochen einfach aufgebaut worden.
Beim
Dieselmotor wurden die Bereiche überwacht, die man auch bei einem
Auto finden kann. So galt das für die Temperatur und den Öldruck. Nur eine
Einrichtung, die in diesem Fall den Motor abstellten, gab es schlicht
nicht. Es oblag daher beim Personal anhand der Anzeigen die Störung zu
erkennen und so den Schutz des Motors zu garantieren. Seit Ihr Nachwuchs
den Motor des Familienwagens killte, weil er nicht auf die rote Lampe
reagierte, wissen auch Sie was das bedeutet.
Dabei übernahmen diese die gleichen Aufgaben, wie
das beim elektrischen Modell der Fall war. Da hier jedoch eine leicht
ge-änderte Reaktion erfolgte, kommen wir nicht darum, diese ge-sondert
anzusehen. Die Sicherheitssteuerung arbeitete abhängig vom gefahrenen Weg. Dabei kam hier als Sicherheitselement die als «Schnellgang» bezeichnete Lösung zur Anwendung.
Dieser
Schnellgang wurde aktiviert, wenn das zur Bedienung am
Boden beim Lokführer montierte
Pedal nicht mit ausreichender Kraft
niedergedrückt wurde. Dabei erfolgte auf den ersten 50 Metern keine
Reaktion und anschliessend wurde eine akustische
Warnung ausgegeben. Alternativ dazu konnte diese Einrichtung auch mit dem Schalter für den Dieselmotor bedient werden. Fehlte auch dort die Be-dienung nach den Vorgaben, wurde nach einer Strecke von 100 Metern die Massnahmen ausgelöst.
Das bedeutete, dass der
Triebwagen mit einer Bremsung zum
Stillstand gebracht wurde und gleichzeitig der
Dieselmotor abgestellt
wurde. Das war nötig, weil sonst wegen dem
Antrieb
immer noch
Zugkraft
vorhanden gewesen wäre.
Es muss erwähnt werden, dass hier im Gegensatz zu den anderen Baureihen
keine
Zwangsbremsung erfolgen konnte, weil die dazu erforderliche
automatische Bremse fehlte. Die Einrichtung öffnete daher ein
Ventil, das
den
Bremszylinder mit dem maximalen Druck versorgte. Damit die
Achsen
jedoch nicht verschliffen wurden, musste der Lokführer mit dem
Auslöseknopf die
Bremskraft verringern. Wobei das in dem Fall eher
unwahrscheinlich wäre.
Diese
Wachsamkeitskontrolle arbeitete passiv und das
bedeutete, dass sie nur nach einer bestimmten Strecke vom Lokführer eine
definierte Reaktion verlangte. Dazu reichte das kurze He-ben des
Pedals. Ohne Reaktion des Lokführer kamen wieder die gleichen Massnahmen, wie beim vorgestellten Sicherheitselement zur Anwendung.
Diese wurden auch
aktiviert, wenn die eingebaute
Zugsicherung angesprochen hatte. Diese war
neu eingeführt worden und diese
Triebwagen sollten zu den ersten Fahrzeugen
gehören, die diese Einrichtung seit Ablieferung bekommen hatten. Dabei
löste diese Zugsicherung eigentlich nur den
Schnellgang ohne Wartefrist
aus.
Diese
Zugsicherung war nur mit der Schaltung «Warnung» versehen worden.
Diese war bei den
Vorsignalen vorhanden und eine
Haltauswertung gab es
weder auf dem Fahrzeug noch bei den Signalen. Speziell war jedoch, dass
diese Einrichtung auf den Strecken ohne
Beim
Drehgestell eins wurde für die
Zugsicherung in der Mitte ein Magnet
und seitlich je ein Empfänger montiert. Dabei aktivierte der mittige
Magnet bei der Einrichtung nach
Integra-Signum die im
Gleis montierten
Spulen. Diese wiederum sendeten zum Empfänger eine
Meldung. Diese musste
im
Führerstand mit einem
Quittierschalter bestätigt werden. Dieser
enthielt zudem eine orange Anzeige, die in dem Fall einfach löschte.
Jedoch konnte der
Triebwagen CLm 2/4 mit der üblichen
Sicherung auch unter
der
Fahrleitung verkehren. Das war meist der Fall, wenn er von der nicht
elektrifizierten
Nebenstrecke auf die
Hauptstrecke wechselte um einen
grösseren
Bahnhof zu erreichen. Dort konnte er natürlich dem elektrischen
Verwandten begegnen und dessen Steuerung wollten wir uns natürlich auch
noch ansehen. Dabei kommen aber durchaus bekannte Einrichtungen erneut
vor.
|
|||
|
Steuerung CLe 2/4 |
|||
|
Auch hier wollen wir damit beginnen, dass die
Batterien nicht eine
unbeschränkte Lebensdauer hatten. Daher mussten die
Bleibatterien auch
beim elektrischen Modell geladen werden und das ging hier deutlich
einfacher. Es wurde bekanntlich an den
Hilfsbetrieben eine
Umformergruppe
angeschlossen. Diese führten in dem Moment
Spannung, wenn der
Triebwagen
eingeschaltet wurde. Genau genommen war das der Fall, denn die
Schleifleiste den
Fahrdraht berührte.
Auch hier lag wegen
der Ladung der
Batterien die
Spannung
leicht höher als diese bereit
stellen konnten. Die
Leistung war zudem so bemessen worden das die
Steuerung und die
Beleuchtung ab dem
Umformer versorgt werden konnten. Gegenüber dem Modell mit Dieselmotor, wurde hier der eigentlichen Steuerung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei wurden elektrische Signale dazu genutzt, die vom Lokführer erteilten Anforderungen umzusetzen.
Das
war ein wesentlicher Bestandteil dieser Einrichtung bei elektrischen
Fahrzeugen und dazu wurden auch hier einfache
Steuerschalter benutzt. Wie
deren Bediengriff aussah, ist Bestandteil der Bedienung, die Funktion,
jedoch der Steuerung. Hier nun jeden Punkt aufzulisten wäre zu umfangreich. Daher wollen wir uns die Reaktion der Steuerung ansehen, wenn der Lokführer den Stromabnehmer heben wollte. Durch den geschlossenen Steuerschalter floss ein Strom zu einem EP-Ventil.
Dieses wurde erregt und öffnete die Leitung. Damit konnte die
Druckluft in den
Zylinder gelangen. Die
Feder führte anschliessend den
Vorgang aus und der
Triebwagen schaltete ein.
Damit nun aber dieser Vorgang ausgeführt werden konnte, musste auch
Druckluft vorhanden sein. Deren Erzeugung konnte vom Lokführer so
eingestellt werden, dass die Steuerung den Vorrat überwachte. Dieser
Druckschwankungsschalter sorgte daher dafür, dass der Vorrat sich immer im
Bereich von sechs bis acht
bar bewegte. Dabei regelte die Steuerung
eigentlich nur, wenn der
Schütz zum
Kompressor ein- beziehungsweise
ausgeschaltet war.
Das
hätte zu Folge, dass ohne Schutz die Motoren schwer beschädigt wurden.
Damit das nicht passierte, übernahm die Steuerung die erforderliche
Überwachung mit Hilfe von speziell dafür vorgesehenen
Relais. Neu war diese Lösung nicht, aber sie musste hier verändert werden. Überschritt der Strom den definierten Wert, konnte bekanntlich nicht der Hauptschalter ausgelöst werden. Aus diesem Grund wurden die Wendehüpfer, die bekanntlich auch als Trennhüpfer funktionierten, geöffnet.
Damit fiel
die
Zugkraft schlagartig aus und der Stromfluss verringerte sich. Damit
wurde das
Relais wieder zurückgestellt und die
Trennhüpfer konnten
eingeschaltet werden. Damit war jedoch ausgerechnet der Transformator nicht überwacht. Gab es dort ein Problem mit einem zu hohen Strom, führte die Abtrennung der Fahrmotoren nicht zum gewünschten Effekt.
In diesem Fall wurde der
Strom
nur durch die auf dem Dach montierte
Sicherung begrenzt. Sprach diese
jedoch an, konnte der
Triebwagen
nicht mehr aus eigener Kraft die Fahrt
fort-setzen. Es musste in der Folge eine
Hilfslokomotive angefordert
werden. Auch hier wurden die Sicherheitssteuerung und die Zugsicherung nach Integra-Signum eingebaut. Diese unterschieden sich zum Modell mit Dieselmotor nur darin, dass die Reaktion anders erfolgte.
Die Distanzen
und die Bedienung dieser
Sicherheitseinrichtungen unterschieden sich jedoch in keiner
Weise von den zuvor vorgestellten Fahrzeugen. Daher können wir uns in
diesem Fall eine ausführliche Vorstellung der Einrichtungen ersparen.
Sprach eine der
Sicherheitseinrichtungen an, konnte man hier ja nicht einfach den
Dieselmotor ausschalten. Bei der Bremsung konnte man die Lösung von den
anderen Modellen übernehmen und daher war auch hier die volle
Bremskraft
vorhanden, deren Wirkung der Lokführer verringern musste. Was natürlich
nicht erfolgte, wenn dieser ohne Bewusstsein war und gar nicht reagieren
konnte. Jedoch nahm man in dem Fall den Schaden in Kauf.
Dabei konnte der
Stromabnehmer erst wieder gehoben werden, wenn der
Steuerkontroller auf
null gedreht worden war. Da die
Trennhüpfer anfänglich noch geschlossen
waren, dauerte es einen kurzen Moment, bis die
Zugkraft ausfiel. Zum Schluss bleibt noch die Anzeige der Geschwindigkeit, die bei beiden Baureihen identisch war. Diese Anzeige wurde mit elektrischen Signalen ab dem benachbarten Drehgestell betrieben.
Ein Geber an einem
Radsatz erzeugte
eine
Spannung, die dann einen Zeiger in Bewegung setzte. Diese Lösung
wählte man, weil erwartet wurde, dass die bisherige mechanische Lösung bei
einer
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h nicht mehr korrekt funktionieren könnte.
Diese
Geschwindigkeitsmesser stammten aus dem Hause Hasler in Bern. Dabei
kamen nicht in beiden
Führerständen die gleichen Modelle zum Einbau. Im
Führerstand eins war ein Modell mit
Registrierstreifen zur
Fahrdatenaufzeichnung vorhanden. Im anderen Führerstand baute man jedoch
ein Gerät ein, das den Restweg auf den letzten 2 000 Metern aufzeichnete.
Dabei waren hier in diesem Bereich genauste Angaben ablesbar.
Damit können wir die Steuerung und die
Beleuchtung beschliessen und die
fertigen Fahrzeuge der Bedienung übergeben. Jedoch gab es gerade in diesem
Punkt grosse Unterschiede zwischen den Fahrzeugen. Ist ja klar, ein
Dieselmotor ist anders zu bedienen als eine
Hüpferbatterie. Aus diesem
Grund teilen wir die Fahrzeuge in diesem Bereich wieder und diesmal kommen
die elektrischen Züge zuerst. Wie üblich, können Sie hier zum
Dieseltriebwagen wechseln.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Damit
das Fahrzeug erkannt werden konnte, waren an den beiden
Damit
das Fahrzeug erkannt werden konnte, waren an den beiden  Dieses
rote Licht für die Signalisation der Fahrberechtigung, wurde mit einer
zweiten unmittelbar unter der oberen
Dieses
rote Licht für die Signalisation der Fahrberechtigung, wurde mit einer
zweiten unmittelbar unter der oberen
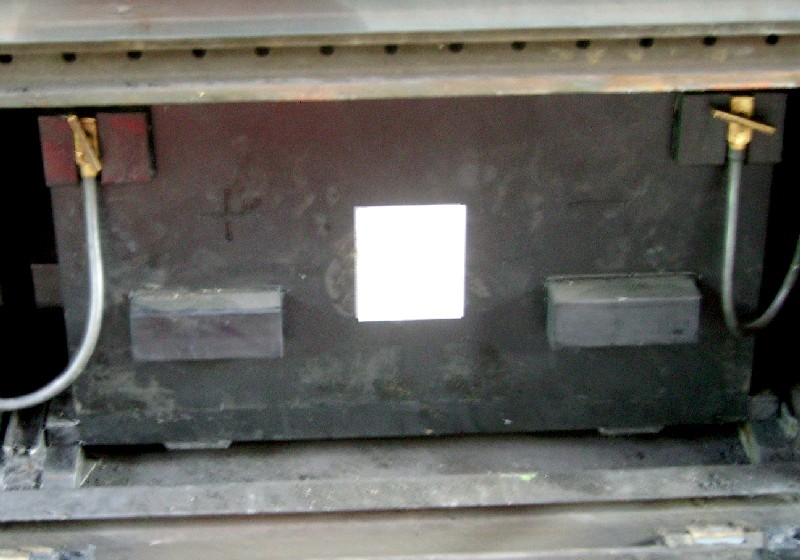 Im
hinteren
Im
hinteren
 Um die
Um die  Bei den beiden
Bei den beiden 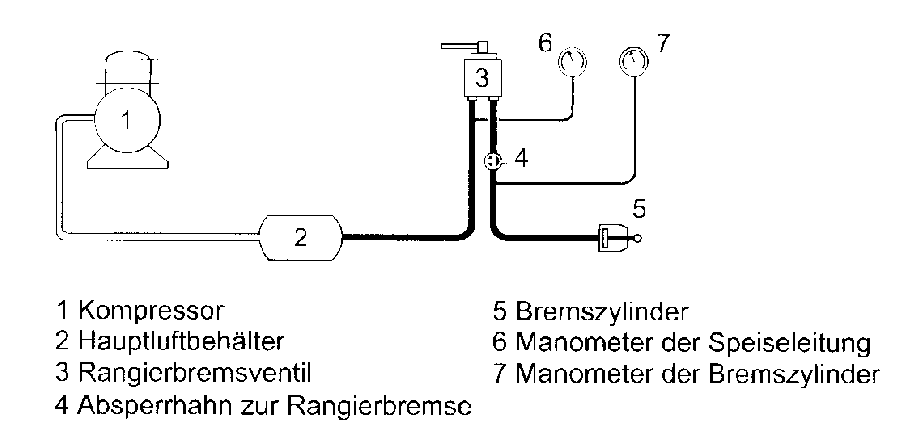 Wäre der Lokführer wieder reaktions-fähig, könnte er die Massnahmen mit
drücken des
Wäre der Lokführer wieder reaktions-fähig, könnte er die Massnahmen mit
drücken des
 Sobald das Fahrzeug eingeschaltet war, begann die
Sobald das Fahrzeug eingeschaltet war, begann die 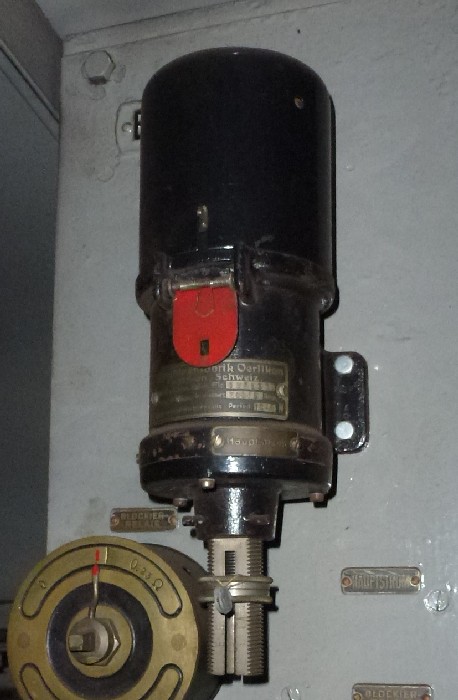 Weiter wurden durch die Steuerung auch andere Bereiche überwacht und das
waren teilweise die zugelassenen
Weiter wurden durch die Steuerung auch andere Bereiche überwacht und das
waren teilweise die zugelassenen
 Jedoch musste auch die
Jedoch musste auch die