|
Entwicklung und Beschaffung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
In erster Linie war
die BN federführend. Es mussten dringend neue
Triebfahrzeuge
her. Diese sollten vom noch nicht vollständig auf 20 Tonnen verstärkten
Oberbau
befahren können. Zudem sollten damit aber auch die Steigungen nach Les
Verrières und Le Locle ohne eine
Vorspannlokomotive
geschafft werden. All das noch mit einer
Höchstgeschwindigkeit,
die bei ungefähr 100 km/h lag kombiniert. Keine leichte Aufgabe?
Diese als
Re 4/4 geführte Maschine hätte für das von der BN verlangte
Programm ausgereicht. Zudem hätte man sich der Serie anpassen kön-nen und
so günstigere Exemplare erhalten. Bekanntlich sinkt durch die Menge der
Preis.
Obwohl die
Lokomotive
der
Staatsbahnen
zur Verfügung stand, war sie nicht ideal. Die leichten
Fahrmotoren
hatten Probleme und waren nicht besonders belastbar. Gerade schwere
Anfahrten in den Steigungen waren für die Motoren nicht sehr gut. Nur
schon diese Tatsache macht es eigentlich einfach, denn wenn man sich einer
Serie anschliesst, sollte die funktionieren. So gesehen müssten wir uns
nicht mehr damit befassen.
Die
Lokomotive
war auch in Bezug auf die Länge der
Bahnsteige
nicht ideal. Diese benötigte Platz und wenn man Argumente dagegen sucht,
kann diese nicht nach dem Bahnsteig stehen. Auf jeden Fall wurde auch
dieser Punkt in die Runde geworfen. Es war daher schnell zu erkennen, dass
man sich bei der BLS-Gruppe
nicht mit einer von der Schweizerischen Bundesbahnen SBB stammenden
Maschine anfreunden konnte.
Man kaufte in Spiez aus
Prinzip eigene Entwicklungen. Gerade seit der
Lokomotive
Ae 4/4 war man
von sich überzeugt und das Direktorium war auf dem richtigen Weg, auch
wenn das Modell der
Staatsbahnen die
Höchstgeschwindigkeit auf den Wert
von 125 km/h angehoben hatte. Der BN hätte diese bereits damals ganz gut
gestanden, aber eben, nicht mit einem Modell der Staatsbahnen, denn die
konnten ja nichts bauen.
Man musste wissen, was man wollte. Nur so konnte auch
die Bestellung ausgelöst werden. Wie so oft wollte der Betrieb das neue
Teil bereits im Einsatz haben, als die ersten Ideen für das neue Modell
gesammelt wurden. Das Pflichtenheft sah vor, dass die BLS-Gruppe unter der Leitung der BLS, zwei Triebwagen für die Bahn Bern – Neuenburg bestellen sollte. Vom Aufbau her sollten es Triebwagen sein.
Damit war klar, die leichten
Schnellzugslokomotive
sollte nicht weiter verfolgt werden. Das war ein deutlicher Hinweis an
die Industrie, denn nun muss-te neu gezeichnet werden und das für nur zwei
in Aussicht stehende Fahrzeuge. Die Triebwagen wurden in erster Linie gewählt, damit die kurzen Bahnsteige auf der Strecke opti-mal genutzt werden konnten.
Zudem erhoffte man sich, dass die
Achslasten
bes-ser eingehalten wurden. Bei
Lokomotiven war im-mer die Tendenz
vorhanden, dass diese etwas zu schwer gebaut wurden. Ein oder zwei Tonnen
über den Werten war kein Problem. Die BLS-Gruppe sah das natürlich anders
und daher diese Wahl.
Im
Pflichtenheft wurde ein
Triebwagen
mit Personenbeförderung erwartet. Dabei sollten in dem Fahrzeug
nur Sitzplätze in der dritten
Wagenklasse vorhanden sein. Das war damals
bei Triebwagen nicht selten der Fall und speziell war hier, dass noch von
der dritten Wagenklasse gesprochen wurde, denn damals begannen auch die
Verhandlungen der Bahnen über die Abschaffung der ersten kaum benutzten
Wagenklasse.
Auch bei den internationalen Zügen reisten die
Leute mit weniger Gepäck. Wo noch ein
Gepäckwagen benötigt wurde, blieb
dieser auf dem ganzen Laufweg im Zug. Beim Wechsel des
Triebfahrzeuges
wäre ein Umlad erforderlich ge-worden. Deutlich interessanter für uns werden jedoch die technischen Bestimmungen, die im Pflichtenheft aufgeführt wurden. Dabei lassen wir die Hinweise zur Spannung der Fahrleitung und zu den Normen der Geleise weg.
Diese waren, wie die
verbauten Zug- und
Stossvorrichtungen an Normen ge-bunden, und konnten
daher nicht verändert werden. In einem solchen Katalog mussten sie aber
aufgeführt werden.
Wie bei
Triebwagen
üblich,
sollten
Drehgestelle verbaut werden. Diese sollten mit
Fahrmotoren
versehen werden.
Laufachsen waren nicht zugelassen. Da man zudem von
zweiachsigen Drehgestellen ausging wurde die Typenbe-zeichnung bereits an
dieser Stelle aufgeführt. Die beiden neuen Fahrzeuge sollten daher als
Reihe Ce 4/4 geführt werden. Auf die Erwähnung eines
Indexes wurde
hingegen bei der BLS-Gruppe verzichtet.
Die vier verbauten
Triebachsen sollten über eine maximal erlaubte
Achslast von 16 Tonnen
verfügen. Einzuhalten war dieser Wert bei halber Besetzung und mit den
entsprechenden Vorräten. Noch erlaubten die
Oberbauten der BN keine
höheren Werte. Das galt jedoch für die meisten
Nebenlinien und dafür
sollten die beiden Modelle gebaut werden. Durch die Angabe der
Mittelwerte, konnten diese Lasten jedoch überschritten werden.
In diesem Punkt war von der halben
Leistung der
Lokomotive
Ae 4/4 gesprochen worden. Das ergab einen Wert von
2 000 PS. Damals wurden die Werte bei der Leistung noch in dieser Form
angegeben.
So mögen die Zahlen das
Problem nicht zu zeigen. Mit gegenüber der
Baureihe
Ae 4/4 nur vier Tonnen
weniger
Achslast war das schwer.
Triebwagen
sind länger und daher auch der
mechanische Teil etwas schwerer. Nicht vergessen werden darf aber die
Zuladung, die bildete auch noch einen Teil. Als ob das nicht genug war,
gab es auch weniger Platz und so konnten die Baugruppen nicht immer
optimal verteilt werden.
Mit dieser installierten
Leistung sollte der neue
Triebwagen
in der Lage sein, auf Steigungen von
bis zu 27 ‰ eine
Anhängelast von 200 Tonnen zu befördern. Lag deren Wert
bei 18 ‰, stieg die zugelassene Anhängelast auf 300 Tonnen an. So zeigten
die gemachten Angaben, dass auch die
Bergstrecke am Lötschberg zu den
Aufgaben gehören sollte. Indirekt wurde so vermittelt, dass es durchaus
eine kleine Serie geben könnte.
Die Erfahrungen mit der
Baureihe
Ae 4/4 zeigten, dass man sich bei der BLS-Gruppe noch nicht mit
der neuen schnellen
Zugreihe R anlegen wollte. Daher wurde auch keine
entsprechende
Zulassung verlangt. Mit der Angabe der
Höchstge-schwindigkeit
konnte man auch die Diskussionen umgehen, denn 110 km/h konnten auch mit
der neuen
Zugreihe A ausgefahren werden. Noch blieben die höheren Werte
bei den
Staatsbahnen.
Jahre später wurde die
Geschwindigkeit für nicht nach der
Zugreihe R verkehrende Fahrzeuge
angehoben. Die Wahl der
Höchstgeschwindigkeit war daher nicht voll
durchdacht worden und nur wenige Jahre später wurden mit 125 km/h auch die
Werte der
Baureihe
Re 4/4
erreicht. Somit war der
Triebwagen
aber auf
Zugkraft getrimmt worden und das ging nur wenn langsamer gefahren wurde.
Sicherlich ein Fehler, den die
Staatsbahnen später aufdeckten.
Damit hätten wir eigentlich
bereits die wichtigsten Punkte des
Pflichtenheftes aus Spiez erwähnt. Wer
umfangreiche Angaben über die Ausstattung und die Anzahl Sitzplätze
erwartete, lag falsch. Ausser dem Hinweis, dass dieses der dritten
Wagenklasse angehört, gab es keine Hinweise. Es wurde also ein
Triebfahrzeug verlangt, das auch als
Personenwagen genutzt werden konnte.
Details sollten später bereinigt werden.
So erwartete man eine grosse
Auswahl von Angeboten. Im Gegensatz zu den grossen
Staatsbahnen war die
BLS-Gruppe nicht verpflichtet eine Bestellung in der Schweiz vorzunehmen.
Daher konnten sich viele Hersteller um den Auftrag bemühen. Jedoch war
dieser wegen der geringen Stückzahl nicht besonders lukrativ. Niemand
konnte ahnen, dass sich daraus eine vielfältige Lösung für
Triebwagen
aller Art entwickeln sollte.
Trotzdem gab
es einen von der Firma Société Anonyme des Ateliers de Sécheron SAAS in
Meyrin bei Genève ausgearbeiteten Vorschlag. Dabei sollte bei diesem
Elektriker nur der Einbau der Ausrüstung und die Endmontage vorgenommen
werden. Die mechanischen Arbeiten sollten im Auftrag von der Firma Schweizerische Industriegesellschaft SIG in Neuhausen ausgeführt werden. In Neuhausen am Rheinfall konnte man mit den Leichtstahlwagen einen grossen Auftrag von Wagen für Reisezüge an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB gewinnen.
Man hatte daher viel Erfahrung
sammeln könnten. Besonders der benötigte leichte Aufbau war wich-tig und er
wurde schon beim Wagen angewendet. Genau wurde als Muster für den Triebwagen der BLS-Gruppe der zur gleichen Zeit von den Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB in Auftrag gegebene Triebwagen der Reihe CFe 4/4 genommen.
Da bei der BLS-Gruppe jedoch das
Gepäckabteil fehlte,
rückte auch die zweite Türe nach aussen und kam über dem
Drehgestell zu
liegen. Wegen dem Verzicht auf einen
Personenübergang konnte die
Frontpartie anders aufgebaut werden.
Dieses mit einer
Leistung von
1 470 kW oder 2 000 PS versehene Fahrzeug sollte am Besten den
Vorstellungen der BLS-Gruppe entsprechen. Jedoch sollten gerade im Bereich
des
Personenabtei sehr viele Merkmale der
Leichtstahlwagen vorhanden
sein. Mit der SAAS konnte die
Bahngesellschaft zudem den Hauslieferanten
nehmen, was eine gute Zusammenarbeit ergab. Der Hersteller wusste genau,
was der Kunde will.
Diese neuen
Triebwagen
sollten auf der
Bahnlinie zwischen Bern und Neuchâtel die alten Triebwagen
CFe 4/5
ablösen und so für neuen Schwung im Verkehr von Bern aus in Richtung Jura
und Paris ermöglichen. Den Triebwagen wurden dabei die Nummern 761 und 762
zugewiesen.
Auf die Anbringung eines
Indexes verzichtete die
BLS-Gruppe jedoch. Die im Betrieb wichtige Unterscheidung der Fahrzeuge
sollte alleine mit den Nummern erfolgen. Bei kleineren Serien ist das
durchaus eine praktikable Lösung und die BLS-Gruppe musste bekanntlich
auch die
Bahngesellschaften in der
Betriebsgruppe unterscheiden und das
wird gerade bei diesem Fahrzeug besonders, denn diese Praxis wurde hier
sogar noch aufgegeben.
Drei Jahre später bestellte die BLS-Gruppe bei den
beiden Herstellern einen weiteren
Triebwagen der
Baureihe Ce 4/4 für die
Gürbetalbahn GTB. Obwohl der Triebwagen eine gleich lautende Bezeichnung
erhalten hatte, handelte es sich um einen verbesserten und leichteren
Triebwagen. Damit wurde der Triebwagen vier Tonnen leichter und konnte nun
auch die bescheidenen
Achslasten auf der GBS einhalten.
Die Nummer für das Fahrzeug der GBS wurde mit 763
anschliessend zu den
Triebwagen der BN gewählt. Damit war klar, dass die
BN keine solchen Triebwagen mehr bekommen werden würde. Die BLS-Gruppe
hatte damit begonnen, den
Oberbau
der mitbetriebenen Bahnen auf das Level
von
Hauptstrecken zu bringen. So sollten auch auf diesen Strecken vor den
schweren Zügen vermehrt moderne
Lokomotiven verwendet werden.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
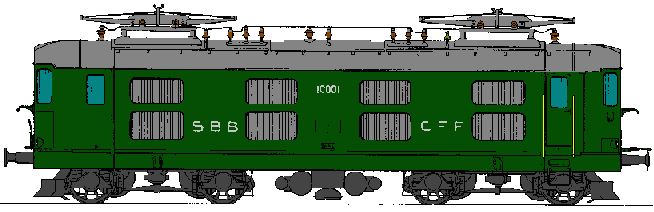 Leichter
konnte die Lösung eigentlich nicht sein. Als die Abklärungen begannen war
von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eine neue leichte
Leichter
konnte die Lösung eigentlich nicht sein. Als die Abklärungen begannen war
von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eine neue leichte
 Die BLS-
Die BLS- Speziell war eher, dass die
BLS-
Speziell war eher, dass die
BLS-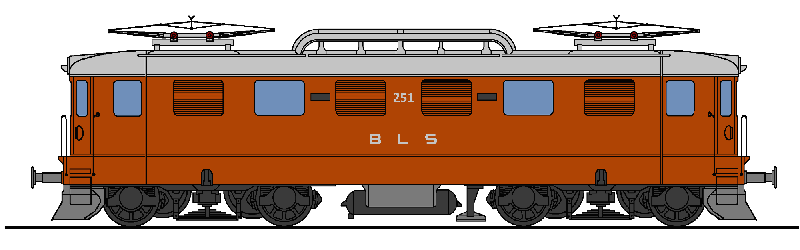 Soweit waren die Forderungen
des
Soweit waren die Forderungen
des
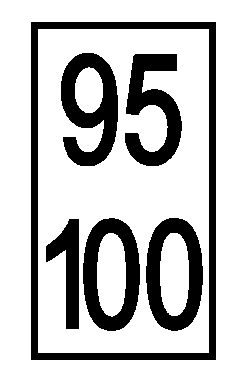
 Jedoch war die Rückmeldung
eher bescheiden. Viele Hersteller erachteten die hohe
Jedoch war die Rückmeldung
eher bescheiden. Viele Hersteller erachteten die hohe 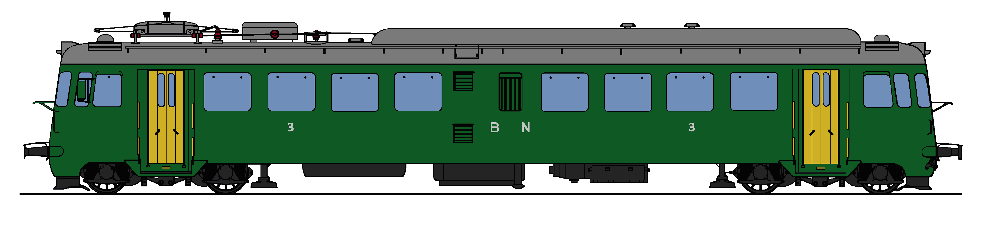 Die BLS-
Die BLS-